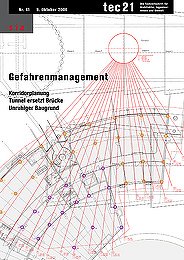Editorial
Das flaue Gefühl
Steht eine Wiederbelebung der CO2-freien Kernenergie bevor, wie kürzlich in den Medien zu lesen war? Viele wissenschaftlich begründete Erkenntnisse deuten darauf hin.
Kernkraftwerke setzen pro erzeugte Kilowattstunde weniger CO2-Äquivalente frei als Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke oder auch die Fotovoltaik. Damit würde aus dieser Sicht die Kernenergie zusammen mit der Wasserkraft an der Spitze der «klimafreundlichen» Stromproduzenten stehen. H.-M. Prasser, Professor für Kernenergiesysteme der ETH Zürich, stellt die Kernenergie in Bezug auf die Umweltbilanz sogar auf eine Stufe mit Wasserkraft, Windkraft und Biomasse. Fachspezialisten bestätigen ausserdem, dass aus wissenschaftlicher Sicht kein Zweifel bestehe, dass die sehr giftigen, radioaktiven Abfälle langfristig zuverlässig in Zwischen- und Endlager eingeschlossen und von der Umwelt dauerhaft isoliert werden können. Mit der Wiederaufbereitung der Brennstäbe würde schliesslich auch der Forderung nach nachhaltigem Verhalten entsprochen. Die Brennstoffausnutzung könne dadurch erhöht und die Abfallmenge verringert werden. Ein sicheres Atomkraftwerk scheint nach diesen Argumenten in unserer modernen Zeit den einzigen Weg darzustellen, den Spagat zwischen steigendem Energiebedarf und Umweltschutz zu meistern – wenn denn all diese Gesichtspunkte tatsächlich die Gesamtheit der Problematik beleuchten würden...
Bauliche Sicherheitsvorkehrungen und betriebliches Sicherheitskonzept werden beim Bau von Kernkraftanlagen zwar strikten Regeln unterworfen und auf ihre Einhaltung geprüft. Auch wird nicht nur verhindert, dass nach einer Kernschmelze das Grundwasser verseucht wird. Schutzhüllen aus Beton sollen zudem sogar dem Absturz eines Flugzeuges standhalten können. Trotzdem aber hängen die heiklen Entscheide in Notsituationen am seidenen Faden der menschlichen Reaktionsfähigkeit (Beinahunfall in Forsmark Schweden). Nicht zuletzt besteht auch stets die Gefahr, dass die baulichen Sicherheitsvorkehrungen nicht genügen, da Kräfte und Auswirkungen unterschätzt werden können. Das Risiko aufkommender Schadensbilder ist in vielen Fällen nicht mit definitiver Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, und eine hundertprozentige Sicherheit kann nie erreicht werden. Auch die verheerenden Langzeitfolgen einer zu berücksichtigenden Reaktorkatastrophe können für jede spezifische Situation nur äusserst schwierig abgeschätzt werden. Bedenken werfen auch die Zwischen- und Endlager auf, was aus gesellschaftskritischer Sicht die Ablehnung des Projektes in der Volksabstimmung im nidwaldnerischen Wellenberg bestätigt. Das Problem der definitiven Lagerung der Abfälle in der Schweiz ist bis anhin nicht gelöst. Einzig das Zwischenlager in Würenlingen sorgt heute für eine zwischenzeitliche «Versorgung» der Abfälle. Doch auch aus technischer Sicht stellt sich die Frage über das langfristige Verhalten der «versorgten» Abfälle in den Deponien. Die Meinung, dass das Wirtgestein des Endlagers während der erforderlichen Einschlusszeit von einigen zehntausend Jahren unverändert bleibt, weckt kein grosses Vertrauen. Im Gegenteil, das Wissen darum, dass im Boden hochgiftiges Material unsichtbar vor sich hin strahlt, weckt ein flaues Gefühl.
Einen Entscheid in dieser Grössenordnung zu treffen, fällt schwer. Die Unfallwahrscheinlichkeit bei Kernkraftwerken mag minimal sein und die Umweltverträglichkeit gute Werte aufzeigen, trotzdem aber können die maximalen Folgen verheerend sein. Clementine van Rooden
Inhalt
Korridorplanung
Cornelia Winkler, André Burkard
Wasser, Schnee, Lawinen und Fels gefährden Verkehrswege in Berggebieten permanent. Im Wallis hilft ein neues Planungsinstrument, die Sicherheit und Verfügbarkeit der Strassen in den Seitentälern zu optimieren.
Ein Tunnel als Tor zur Aussenwelt
Curdin Bischoff, Sven Fehler, Ruedi Krähenbühl
Beinahe hätte im Februar ein Felssturz das Calancatal in Südbünden isoliert. Dank Beobachung des Felsverhaltens konnte eine gefährdete Brücke noch rechtzeitig mit einem Tunnel hinterfahren werden.
Sicher bauen in unruhigem Grund
René Zurkirchen
Beim Bau eines unterirdischen Zwischenlagers für Brennelemente im Süddeutschen Neckarwestheim verhinderten Ausgleichsinjektionen die Entstehung von Gebäudeschäden wegen Setzungen und unerklärlichem Verhalten des Baugrunds.
Wettbewerbe
Neue Ausschreibungen und Preise / Öffentliches «Gewächshaus»: Mehrzweckhalle in Ried / Sternbilder - Usters neue Weihnachtsbeleuchtung / Weisshorngipfel in Arosa: «Promenade architectural» mit Fensterband
Magazin
Bauen mit Naturgefahren / Beschwerden gegen die Erweiterung des Steinbruchs Campiun bei Sevelen gutgeheissen / Werdende Wahrzeichen
Aus dem SIA
Produkte
Impressum
Veranstaltungen
Ein Tunnel als Tor zur Aussenwelt
(SUBTITLE) Seit einem Jahr können die Bewohner des Calancatals ein instabiles Felsengebiet sicher unterfahren
Eine beschleunigt bewegte Felsmasse drohte die Brücke Val d’Infern zum Einsturz zu bringen und das Calancatal in Südbünden für Monate von der Umwelt abzuschneiden. In nur zwei Jahren entstand unter schwierigen Randbedingungen ein Umfahrungstunnel. Ein halbes Jahr nach dessen Eröffnung stürzten 20000 m³ Fels nieder und rissen die alte Brücke in die Tiefe. Die über zehn Jahre dauernde messtechnische Überwachung ermöglichte fundierte Risikoanalysen und liess den Zeitpunkt des Felsabbruchs präzis vorhersagen.
In der Südabdachung Graubündens führt die Zufahrtsstrasse vom Misox über die zwei Tunnels verbindende Brücke des Val d’Infern in das Calancatal (Bild 1). Die Felsrippe des Tunnels Süd ist stark entfestigt und verursachte jährlichen Block- und Felssturz. Aufgrund der geologischen Abklärungen musste längerfristig mit einem Absturzvolumen von 3000 bis 30 000 m³ Gneis gerechnet werden. Seit 1995 stellte man geodätische Felsverschiebungen von 20 mm / Jahr mit beschleunigender Tendenz fest (Bild 2). Dem Risiko, dass im Fall einer bei Nacht durch Felssturz niedergerissenen Brücke aus dem Tunnel fahrende Automobilisten ungebremst in den Felsschlund stürzen, begegnete man mit einer automatischen Strassensperrung. Beim Überschreiten von kritischen Messwerten diverser im Felsen versetzter Deformationsmessgeber wurde der Verkehr über eine Rotlichtanlage aufgehalten.
Risikoanalyse verlangt Baumassnahme
Periodische Analysen der Verschiebungsmessungen, des sich verändernden Risikos und verschiedener Varianten von Interventionsmassnahmen führten 2003 zum Entscheid, die Gefahrenstelle mit einem Tunnel zu umfahren (Bild 3). Den Zeitpunkt des Absturzes von > 3000 m³ Fels erwartete man in 1 bis 3 Jahren. Massgebend für den raschen Tunnelentscheid war das Ergebnis einer Ingenieuruntersuchung, wonach bereits ein kritischer Treffer eines 2-m3-Blocks aus 30 m Fallhöhe die Brücke zum Einsturz bringen kann (Bild 4). Ein solcher Block konnte sich irgendwo und jederzeit aus der 100 m hohen Felswand lösen. Als Sofortmassnahme gegen dieses gesteigerte Risiko stellte man eine Hilfs-brücke bereit, die im Ereignisfall zwischen die beiden Tunnels eingeschoben werden konnte. Zusammen mit der vorgängig erforderlichen Felssäuberung und Sicherung musste trotzdem mit einem Strassenunterbruch von 1 bis 2 Monaten gerechnet werden.
Ein wesentliches Ergebnis der über Jahre hinweg stets ausgebauten messtechnischen Überwachung war, dass der geologische Prozess der Felsentfestigung in diesem spröden Gebirgstyp aufgeschlüsselt werden konnte. Es wurde eine Abhängigkeit der Felsdeformationen von der Jahrestemperatur und von den Niederschlägen festgestellt. Sinkende Temperaturen lösten im Herbst jährliche Deformationsschübe von maximal 5 mm / Tag aus, die bei Niederschlägen bis um einen Faktor 2 erhöht wurden. Im Sommer stellten sich die Verschiebungen bei steigenden Temperaturen vollständig ein, und Kluftwasser vermochte keine Rolle mehr zu spielen[1].
Tunnelprojekt unter Zeitdruck
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und zur Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindung ins Calancatal wurden die Varianten eines Umfahrungstunnels und der Ausbau einer Forststrasse auf der gegenüberliegenden Talseite untersucht. Als wirtschaftlich günstigere Lösung erwies sich das Hinterfahren der kritischen Felszone mit einem 292 m langen Tunnel.
Das Projekt sah vor, die Felsrippe lediglich in 30 m Tiefe zu hinterfahren. Das Südportal befindet sich 30 m vor dem alten Tunnel Süd. Im Norden mündet der Umfahrungstunnel spitzwinklig in den bestehenden Tunnel ein. Die alte Steinschlaggalerie beim Portal Nord wurde abgebrochen und neu erstellt.
Das hufeisenförmige Normalprofil weist bei einer Fahrbahnbreite von 7 m einen Ausbruchquerschnitt von 65 bis 68 m² auf (Bild 5). Die Gewölbesicherung erfolgte mit Spritzbeton, Netzen und Ankern. Auf eine flächenhafte Abdichtung wurde verzichtet. Lokale Nassstellen wurden mit einer Folie abgedichtet und das Gebirgswasser gezielt zur Sohle geleitet. Die Entwässerung erfolgte im Mischsystem. In den Banketten waren die Werkleitungen angeordnet. Auf ein Innengewölbe wurde verzichtet.
Aufgrund der jüngsten geologischen Risikobeurteilung galt es, mit dem steigenden Vortrieb möglichst rasch den Tunneldurchstich zu erreichen und im Falle eines verfrühten Felsabbruchs notfalls den Innenausbau unter einspurigem Verkehr zu realisieren. Dies erforderte vom Projektverfasser ein Projekt, welches verschiedene Szenarien berücksichtigen konnte, und vom Bauherrn rasche Entscheide. Innerhalb eines knappen Jahres musste das Auflage-, das Genehmigungs-, das Bau- sowie das Submissionsprojekt inklusiv der gesamten Ausschreibung der Bauarbeiten erstellt werden. Um trotz der knappen Zeit auch den Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, war eine enge Zusammenarbeit zwischen Projektverfasser und Bauherr notwendig.
Die engen Platzverhältnisse und die Auflage, dass der Verkehr ins Calancatal während der ganzen Bauzeit aufrechtzuerhalten war, stellten erschwerende Anforderungen dar. So konnten die Baustelleninstallationen nur auf einer Strassenhälfte erfolgen. Beide Voreinschnitte mussten für den Ereignisfall die Möglichkeit einer autonomen Baustellenversorgung haben. Das spitzwinklig an den Tunnel Nord anschliessende, mehrspurige und unter Verkehr zu erstellende Verzweigungsbauwerk stellte das bautechnische Kernstück dar (Bild 6).
Um mit dem Sprengvortrieb nicht einen Felsabsturz zu provozieren, wurde das Bauprogramm des Tunnelausbruchs auf die sommerliche Ruhephase der Gebirgsverschiebungen, d.h. auf die Zeit von Mai bis September, ausgelegt. Dies gab den Takt für die gesamten Projektierungsarbeiten vor. Trotz der gemäss geologischem Bericht zu erwartenden guten Felsqualität war zur Minimierung der Erschütterungen ein Kalottenvortrieb mit 3 bis 4 m Abschlagslänge und in Nähe der kritischen Sturzmasse eine reduzierte Länge von 1 m vorgesehen. Der Strossenabbau sollte erst nach dem Durchstich erfolgen. Die messtechnische Überwachung der Felsrippe wurde mit zusätzlichen Messpunkten und einer automatischen, geodätischen Vermessung ausgebaut. Alle Messdaten wurden über einen zentralen PC bezüglich kritischer Grenzwerte überprüft. Bei deren Überschreitung löste es einen Baustellenalarm sowie die Sperrung der Strasse aus. Via Internet hatten alle am Bau Beteiligten den aktuel-len Datenzugriff.
Für den Fall einer ungewollten Brückenzerstörung wurde mit einer Studie abgeklärt, ab welchem Felsvortriebsstand das Einschieben der vorbereiteten Hilfsbrücke nicht mehr sinnvoll war, sondern ein beschleunigter Tunnelvollausbruch den kürzeren Verkehrsunterbruch ermöglicht hätte.
Schwierigkeiten der Ausführung
Der einspurig durch die Baustelle rollende Verkehr mit den täglich vom Steinbruch Arvigo passierenden Sattelschleppern behinderte die Bauabläufe enorm. Um Platz zu gewinnen, wurde zuerst der Voreinschnitt Süd ausgebrochen. Ungünstige Felsverschneidungen führten wiederholt zu Niederbrüchen und erschwerten die vorgesehenen Ankerarbeiten.
Um im kurzen Tunnel von 292 m Länge die vorgesehene Vortriebsleistung möglichst rasch zu erreichen, mussten die Arbeitsabläufe des Sprengvortriebs schon nach kurzer Anlaufzeit optimiert sein. Die gegebenen Randbedingungen erschwerten dies stark. Die zulässige Sprengstoffmenge und der Bohrraster wurden anhand der entlang der beiden Tunnels, der Brücke und der absturzgefährdeten Felsrippe durchgeführten Erschütterungsmessungen festgelegt und laufend angepasst. Dies erlaubte es, bereits nach kurzer Vortriebsstrecke vom vorgesehenen Kalottenvortrieb auf einen zeitsparenden Vollausbruch umzustellen. Einzig wo zu Ausbruchsbeginn die Gneisbänke im Streichen der Felsrippe verliefen, wurden die vorgegebenen Richtwerte vereinzelt überschritten. Die Materialbewirtschaftung und der Bauablauf mussten der neuen Ausbruchsart angepasst werden.
Im ungestörten Fels erfolgte die Sicherung in der Ausbruchsklasse II und in der kurzen Störzone in der Klasse III. Die Vortriebsleistung erreichte 30 bis 40 m pro Woche. Am 7. Oktober 2004 konnte der Durchstich - gefeiert werden. Dies knapp vor den im Herbst einsetzenden Deformationsschüben der Felsrippe. Anschliessend erfolgte der Endausbruch des Verzweigungsbauwerks. Der aus dem bestehenden Tunnel heraus teilweise mit Stahlbögen ausgeführte Arbeitsvorgang war nur mit einer von 20.30 bis 5 Uhr dauernden Verkehrssperrung möglich. Um Mitternacht wurde den Talbewohnern ein 15-minütiges Fenster zur Rückkehr an ihren Wohnort geöffnet. Die Niederschlagsperiode im November führte im Tunnel zu unerwartet starken Wassereinbrüchen, was grössere Flächen von Abdichtungen erforderte.
In den Ferien von Weihnachten bis Mitte Januar konnte der Verkehr während der Periode der grössten Felsdeformationen bereits durch den neuen Tunnel geführt werden. Der Tunnel erhielt eine provisorische Trasseebefestigung mit Recyclingasphalt sowie eine Notbeleuchtung. Aufgrund der anhaltend starken Deforma-tionen verlängerte man diese Verkehrsführung bis Mitte Februar, was eine starke Behinderung der Abdichtungs- und Spritzbetonarbeiten zur Folge hatte.
Der Abbruch der Galerie und der Bau des neuen Portalbauwerks Nord mit dem über enge Radien geführten Schwerverkehr stellte höchste Ansprüche an die Arbeitssicherheit. Beispielsweise musste ein zu hoch beladener, im Gerüst verkeilter Lkw durch Ausgraben befreit werden. Die über der alten Galerie liegende, steile Felswand musste nach Sprengarbeiten wiederholt gereinigt und lokal mit Felsnägeln gesichert werden. Im August konnte während der Bauferien die Elektromechanik installiert werden. Nach 1.5 Jahren intensiver Bauzeit und andauernder Verkehrsbehinderung feierte man am 28. September 2005 im Calancatal die Eröffnung des lang ersehnten Umfahrungstunnels Val d’Infern. Mit Ausnahme eines unglücklicherweise durch Spritzbeton eingedeckten Personenwagens blieben die Bauarbeiten ohne Unfälle.
Rechtzeitiger Felssturz
Dass man den Umfahrungstunnel rechtzeitig erstellt hatte, wurde ein halbes Jahr nach dessen Eröffnung auf eindrückliche Weise zur Gewissheit. Am 3. Februar 2006 stürzten 20 000 m³ Fels nieder und rissen die Brücke in die Tiefe (Bild 7). Anhand der beibehaltenen, messtechnischen Überwachung war es möglich, das Absturzdatum zu erkennen und dem einmaligen Naturschauspiel vor Ort beizuwohnen (Bild 9). Erst kurz vor dem Felsabbruch wurde die Portalzerstörung des Tunnels Süd sichtbar (Bild 8). Wie die spätere Datenauswertung zeigte, führte das Abtauen des Schnees zu erhöhtem Kluftwasserdruck, was die Verschiebungsgeschwindigkeiten um einen Faktor >10 erhöhte und damit die über keine Stabilitätsreserve mehr verfügende Felsrippe zum Absturz brachte. Anhand der Fotoanalyse waren das Versagen des unter hohen Spannungen stehenden Rippenfusses und das Nachbrechen der überlagernden Felsmassen erkennbar. Von der ehemaligen, 30 m langen Brücke blieb in der Calancasca nur noch ein 1/8 m³ grosser, runder Betonblock übrig.TEC21, Mo., 2006.10.09
Literatur
1 Krähenbühl R.: Temperatur und Kluftwasser als Ursache von Felssturz. Bulletin angewandte Geologie 9/1, Juli 2004
09. Oktober 2006 Curdin Bischoff, Ruedi Krähenbühl, Sven Fehler