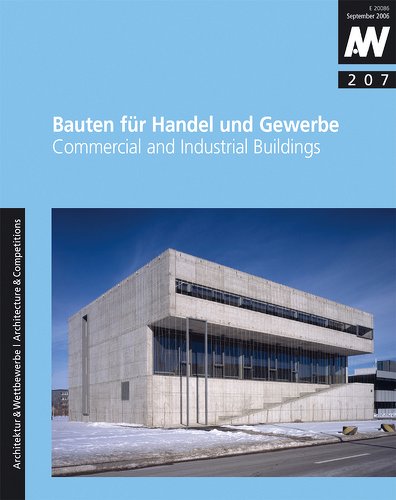Editorial
Der Wunsch, wieder einmal eine Ausgabe der AW zum Thema Gewerbebauten zu machen, hatte buchstäblich nahe liegende Gründe. Von den Redaktionsräumen in der obersten Etage des Verlagshauses, das sich inmitten eines typischen Gewerbegebiets in Stuttgart befindet, bietet sich ein ausgezeichneter Blick auf das, was mittelständischen aber auch größeren Unternehmen zum Thema Gewerbebau so alles einfällt – und das ist ganz offensichtlich nicht viel, zumindest nicht viel Ermutigendes: Hier ein völlig unstrukturierter Bürokomplex mit Lochfassaden und dem fast schon obligatorischen phallusförmigen Treppenturm in Ganzglasoptik, dort ein Reifenhändler, der den alten Werkstatt- und Montagebereich neben seinem zweigeschossigen Satteldachhäuschen unlängst durch einen Maßstab sprengenden Quader aus Betonfertigteilen ersetzt hat, im Hintergrund die Filiale eines führenden Lebensmittel-Discounters im stereotypen Einheitslook. Diese Eindrücke aus dem Nahbereich sind zweifellos übertragbar auf die meisten Gewerbegebiete in Deutschland beziehungsweise Europa. Bei der großen Mehrzahl der Gebäude für Handel und Gewerbe spielt »Architektur« ganz offensichtlich immer noch eine untergeordnete Rolle. Im Regelfall sehen wir uns mit den immer gleichen, weitgehend gesichtslosen und daher austauschbaren Zweckbauten konfrontiert, die nach rein wirtschaftlichen Kriterien errichtet wurden. Kaum eines dieser Gebäude besitzt das, was man bei einem Menschen als »Ausstrahlung« bezeichnen würde, also etwas, was es sympathisch und damit – im positiven Sinne – beachtenswert macht. Ganz sicher aber müssen sich die Unternehmen in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und steigenden Konkurrenzdrucks zunehmend etwas einfallen lassen, um Kunden und Auftraggeber auf sich aufmerksam zu machen beziehungsweise auch künftig an sich zu binden. Das Auftreten einer Firma wird von der Öffentlichkeit nicht nur anhand eines unverwechselbaren Logos, regelmäßiger PR-Maßnahmen und Messeauftritten, eines ansprechend gestalteten Briefpapiers oder eines modernen Fuhrparks beurteilt, sondern zunehmend auch anhand des baulichen Erscheinungsbilds, mit dem sie sich nach außen darstellt. Weitsichtige Unternehmer sollten in einer funktionalen und zugleich qualitätvolle Architektur ihrer Bauten nicht nur die Möglichkeiten sehen, Produktionsabläufe zu optimieren oder eine angenehmere Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiter zu schaffen, sondern vielmehr auch die Chance, sich so von den Mitanbietern signifikant zu unterscheiden und die eigenen Werte und Qualitäten nach außen zu kommunizieren. Wie dies mustergültig umgesetzt werden kann, möchten wir Ihnen gerne mit den ausgewählten Beispielen in diesem Heft zeigen. Arne Barth
Inhalt
Zum Thema
Architektur als Marketinginstrument | Jons Messedat
Beispiele
Repro- und Datenhaus in München-Riem | Florian Nagler Architekten
Druck- und Medienhaus in Augsburg | Ott Architekten
Produktionsgebäude in Lustenau | marte.marte architekten
Unternehmenszentrale in Klaus | Oskar Leo Kaufmann | Albert Rüf
Betriebsgebäude in Baden | ARTEC Architekten
Montagehalle und Schulungszentrum in Neukirch | Barkow Leibinger Architekten
Lackier- und Karosseriebetrieb in Abstatt | m_architekten
Modellbauwerkstatt in Wolfratshausen | Allmann Sattler Wappner Architekten
Gewerbebau in Amsterdam | Evelo Vandenberg architecten
Sportfachgeschäft in Innsbruck | Tatanka
Supermarkt in Mannheim | AJR Architekten
Supermarkt in Bad Liebenzell | Peter W. Schmidt
Warenhaus in Kuressaare | Alver Trummal Arhitektid
Ausstellungsgebäude in Erkheim | a.ml und partner
Ausstellungsgebäude in Owingen | Architektengruppe Überlingen
Projekte
Produktionshalle in Aerzen | Neugebauer + Rösch Architekten
Büro- und Einkaufszentrum in Hamburg | NÄGELIARCHITEKTEN
Wettbewerbe
Produktionsgebäude in Schübelbach
Erweiterung eines Firmengebäudes in Lenzkirch
Architektur als Marketinginstrument
Irgendwo unterwegs, an der Grenze vom Landschafts- zum Stadtraum, gerät man zwangsläufig in die „Zwischenstädte“ der Peripherie mit einem typischen Branchenmix aus Handel und Gewerbe. Oftmals haben diese Gebiete vielversprechende Namen wie Gewerbe- oder Technologiepark, die der Volksmund dann salopp als Gewerbesteppe oder Speckgürtel bezeichnet. Gas, Food, Lodging ist hier kein Problem. Sogar mehr noch, der Großhandelskonzern ist hier ebenso vertreten wie das unmögliche Möbelhaus und die üblichen Discounter für allerlei Konsumgüter. Haushohe Informationstafeln sollen eine Orientierungsmöglichkeit zu den dort ansässigen Unternehmen geben. Das Gesamtbild, das sich dem Besucher bietet, ist jedoch meist ebenso unübersichtlich und unverbindlich wie dieser Schilderwald. Es dominieren blasse Standardhallen von der Stange, die allenfalls mit Elementen des Corporate Design wie Schrift, Logos und einem typischen Farbkanon belegt sind. „Dekorierte Kisten“ sowie die uniformen Filialen weltweit operierender „Brands“ tragen dazu bei, dass Gewerbegebiete immer ähnlicher werden und räumliche Identität oder regionale Bezüge kaum noch zu spüren sind. Spätestens hier wird deutlich, dass Bauten für Handel und Gewerbe mehr leisten müssen als die Bereitstellung einer wirtschaftlich und technisch optimierten Hülle. Besonders vor dem Hintergrund des wachsenden Leerstandes von anonymen und vergleichbaren Gewerbeflächen ist es heute unumgänglich, mit einer nachhaltigen Corporate Architecture, eine wirklich gute und Identität stiftende Adresse zu schaffen.
Es sind nicht allein die „harten“ Tatsachen wie Leistungen und Produkte, sondern vor allem Meinungen und Empfindungen, die die Menschen heutzutage bewegen. Durch Architektur können räumliche Bilder und Vorstellungen erzeugt werden, die unternehmerische Werte und Haltungen sichtbar kommunizieren. Dabei werden auch „weiche“ Faktoren wie Sympathie, Emotionen und Aura transportiert. Marken- und Marketingstrategen haben dies erkannt und gelernt, über immer neue Trends und Moden Absatzmärkte zu sichern. Wie aber kann Architektur einem Unternehmen in seiner Gesamtwirkung nach innen und außen als Marketinginstrument nachhaltig dienlich sein? Auf den ersten Blick scheinen die Ausgangspositionen von Architekten und Unternehmern von unterschiedlichen Bedürfnissen und Visionen geprägt zu sein. Die Architektur ist, von temporären Erscheinungsformen auf Messen und Ausstellungen einmal abgesehen, eher auf Dauerhaftigkeit ausgelegt, die jenseits von Produktionszyklen und der Lebensdauer von Produkten liegt. Für Unternehmen stehen betriebswirtschaftliche Aspekte, die Absatzpolitik und schließlich zufriedene Kunden und Mitarbeiter im Vordergrund. Beispiele dafür, dass dies keine Gegenpole sein müssen, finden sich seit dem Beginn der großen gesellschaftlichen und technischen Veränderungsprozesse im vergangenen Jahrhundert.
Mit dem Wechsel vom manuell hergestellten Unikat zum reproduzierbaren Massenprodukt wandelte sich neben der Produktion auch die Architektur der Produktionsstätten. Während sich das Erscheinungsbild der frühen Gewerbebauten noch an aristokratischen und klerikalen Vorbildern orientierte, schlugen sich später neue Möglichkeiten der industriellen Produktion und die fordistische Serienfertigung in deren Gestaltung nieder. Im ersten Falle war der Wunsch nach einer gesellschaftlichen Aufwertung des Unternehmertums die treibende Kraft. Die Werksanlagen und Verwaltungspaläste, wie die der Krupps in Essen und der Borsigs in Berlin, dienten vornehmlich der Repräsentation, um der staatlichen Macht ebenbürtig entgegenzutreten. Der Einfluss der neuen technischen Entwicklungen wurde beispielsweise bei der Zusammenarbeit von Walter Gropius mit Carl Benscheid, dem Inhaber der Faguswerke in Alfeld an der Leine deutlich. Der Fabrikant war für die damals avantgardistischen Vorschläge des Architekten aufgeschlossen und übertrug Gropius 1911 die künstlerische Gestaltung für sein bereits im Bau befindliches Fabrikgebäude. Die Fassaden aus Stahl und Glas sorgten für einen enormen Bekanntheitsgrad des Gebäudes und seines Bauherren. Ein erfolgreiches „Branding“, um es mit den Begriffen des heutigen Marketing auszudrücken.
Ein weiteres Beispiel ist der zwischen 1936 und 1939 von Frank Lloyd Wright gebaute Firmensitz des amerikanischen Unternehmens S.C. Johnson & Son in Rascine, nördlich von Chicago. Nicht nur die markante Gebäudeform mit stromlinienförmigen Elementen, sondern vor allem der sakral anmutende Innenraum mit den typischen Pilzstützen, ist bis heute nachhaltig mit dem Unternehmen verbunden. Der Architekt selbst schätzte die Wirkung auf die Mitarbeiter nicht gerade unbescheiden ein: „Dieses Gebäude inspiriert die Menschen zur Arbeit, genauso wie eine Kathedrale zum Gottesdienst einlädt“. Dass Architektur für Unternehmen neben der Kommunikation nach außen auch die inneren Strukturen von Unternehmen sichtbar machen kann, hat Frei Otto in den 1980er Jahren mit den zeltartigen Produktionspavillons für die Firma Wilkhahn in Bad Münder eindrucksvoll bewiesen. Die Einführung der Gruppenarbeit, mit der Bildung von internen ProfitCentern, wird hier durch die Aufgliederung der einzelnen Produktionsschritte in separate Bauvolumen räumlich umgesetzt. Gleichzeitig dienen die markanten Gebäude bis heute erfolgreich als „Signature-Buildings“ und werden in Broschüren und sekundären Publikationen des Unternehmens werbewirksam in Szene gesetzt. Qualitätvolle und außergewöhnliche Gewerbebauten sind oftmals das Resultat einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Gestaltern mit engagierten Unternehmern, die das Marketingpotenzial ihrer Firmengebäude frühzeitig erkannt haben. Namen wie Walther Rathenau, Adriano Olivetti oder Philip Rosental bis hin zu Rolf Fehlbaum und Berthold Leibinger, um nur einige zu nennen, stehen für Bauten, die Unternehmenskultur dreidimensional manifestieren. Die aufgeschlossene, mäzenatische Grundhaltung hat sich trotz pragmatischer Kostenargumente langfristig ausgezahlt.
Bei größeren, nicht vom Inhaber geführten Konzernen, durchlaufen die relevanten Entscheidungsprozesse eine Vielzahl von Ebenen. Vom Bauherrn zum Bauherrenvertreter, von der Marketingabteilung zum Markenstrategen und schließlich zum Architekten. Hier kommen Corporate Design Manuale zum Einsatz, in denen Vorgaben für alle Elemente des Erscheinungsbildes definiert sind. An der Hochschule für Gestaltung in Ulm wurde in den 1950er Jahren erstmals eine strategische Verbindung zwischen den einzelnen Gestaltungsdisziplinen wie dem Grafikdesign, der Produktgestaltung und der visuellen Kommunikation hergestellt. Auf dieser Basis wurde das Corporate Design zu einem Werkzeug in der strategischen Unternehmensführung. Die Firma Siemens entwickelte beispielsweise mit Gunter Standke, einem ausgewiesenen Richard Meier Schüler, ein Corporate Design Manual, das für alle Niederlassungen einen einheitlichen Auftritt zum Ziel hatte. Sein Leitsatz „Architektur ist Ordnung, und in der Ordnung liegt die Freiheit“ weist auf den Grundgedanken hin, weltweit gleiche Qualitätsmaßstäbe anzusetzen. Übergeordnete Designstrategien sind für Global Player sowie weitverzweigte Mischkonzerne und deren Marken hilfreich, um weltweit einheitlich wiedererkannt zu werden. Doch die einmal festgelegten Vereinbarungen sollten ständig hinterfragt werden, um einer dynamischen Weiterentwicklung von Unternehmen und Marken gerecht zu werden.
Bauaufgaben für Gewerbe und Industrie standen bisher oft im Schatten von Bauwerken aus dem kulturellen und öffentlichen Bereich. In jüngster Zeit findet jedoch eine Verschiebung in der Wahrnehmung von Architektur für Unternehmen im öffentlichen Raum statt. Durch die finanziellen Zwänge, denen Kulturinstitutionen zunehmend unterworfen sind, übernehmen Unternehmen verstärkt die Rolle von kulturellen Impulsgebern. Die traditionellen Träger und Vermittler von Identität stiftenden Merkmalen werden von den internationalen Codes der Konsumgüterindustrie abgelöst. Marken übernehmen immer mehr die Funktion von Bedeutungsträgern und werden zu neuen Leitbildern stilisiert. Es entstehen aufwändige Marken- und Erlebniswelten mit einer Mischung aus Handel, Entertainment und kulturellen Angeboten. Global agierende Konzerne, wie beispielsweise die Automobilindustrie oder internationale Mode-Labels, setzen auf einen Imagetransfer von spektakulären Bauwerken auf die eigenen Produkte. Bei einigen Architekten ist die „typische Handschrift“ der Entwürfe selbst zu einem Marketinginstrument geworden, das in diesem Kontext gerne werbewirksam eingesetzt wird. So kann es vorkommen, dass ganz ähnliche Architekturformen für Bauherren aus Kunst und Kommerz realisiert werden.
Auch für kleinere Betriebe, die sich mit nur einem Bauwerk in einem lokalen Umfeld präsentieren, bedeutet Architektur als Marketinginstrument einen klaren Wettbewerbsvorteil. Im Gewerbebau stehen aber ökonomische Fragestellungen meist vor architektonischen Argumenten. Wichtig ist es, hier darauf hinzuweisen, dass qualitätvolle Architektur keineswegs teurer ist als eine vermeintlich billige Standardlösung. Die Strategien für eine stimmige Corporate Architecture müssen durchaus nicht besonders kostspielig oder extrovertiert sein. So kann ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen, beispielsweise durch den Einsatz von Materialien, die mit Anstand altern, auf ein besonderes Umweltbewusstsein hinweisen. Auch die respektvolle Integration in den landschaftlichen oder städtebaulichen Kontext wird langfristig zu einem positiven Image nach außen führen. Innovative und ergonomisch optimierte Arbeitsplätze mit besonderen Angeboten für die Belegschaft sind das beste Marketing nach innen, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Gewerbebauten, die durch ein aufgesetztes Branding ausschließlich auf einen Nutzer zugeschnitten sind, müssen bei einer Nachnutzung oftmals mit erheblichem Aufwand neutralisiert werden. Eine vorausschauende Planung mit flexiblen Konzepten, die auf Veränderungsprozesse eingehen können, schlägt sich in den langfristigen Betriebskosten positiv nieder.
Der Wert von Marken nimmt stetig zu und so ist es nicht verwunderlich, dass Corporate Architecture als deren räumliche Verkörperung zukünftig an Stellenwert gewinnt. Latente Vorbehalte und unnötige Polarisierungen im Spannungsfeld von Architektur und Marketing werden zugunsten einer interdisziplinären und partnerschaftlichen Zusammenarbeit in den Hintergrund treten. Die zunehmende Unschärfe zwischen den klassischen Berufsfeldern und Gestaltungsdisziplinen bietet die Chance, neue und inspirierende Räume für die analoge Begegnung mit Unternehmen, Menschen und Marken zu schaffen. Dann werden auch die austauschbaren „Zwischenstädte“ zu einprägsamen Orten, an denen es Freude macht, Neues zu entdecken und zu verweilen.Architektur + Wettbewerbe, Do., 2006.09.14
14. September 2006 Jons Messedat