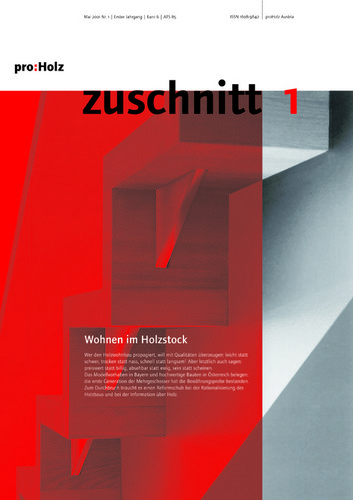Inhalt
Zum Thema
Modellvorhaben Bayern
Text: Karin Sandeck
Schlussfolgerungen Modellvorhaben
Text: Hannes und Rotraut Weeber
Qualität und Quantität des Holzgeschoßwohnbaus in der Steiermark
Text: Walter Kuschel
Von Holzwegen
Text: Hubert Riess
Umfrage
Hat der Holzsystembau eine Zukunft in der Wohnungsproduktion?
Umfrage unter Architekten, Ingenieuren und Unternehmern
Schlussfolgerungen
(SUBTITLE) Vielfältiges Nachbild, vielstimmiger Nachklang. Nachuntersuchung von zehn bayrischen Modellvorhaben in Holz.
Die bautechnische, wirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Nachuntersuchung des Modellvorhabens stellt die Erfahrungen mit der Holzbauweise und ihre Bewertung vor allem aus der Sicht der Baubeteiligten und der Bewohner dar. Daran lassen sich auch Perspektiven für die künftige Anwendung von Holzsystembauweisen im Geschoßwohnungsbau erkennen.
Die Auswahl von zehn Wohnanlagen gibt das breite Spektrum der Gebäudetypen und ihrer Konstruktionen wieder. Sie umfasst sowohl frühe Projekte als auch Nachfolgeprojekte und unterschiedlich große Wohnanlagen mit 16 bis 132 Wohneinheiten. Von den mehrfach realisierten Gebäudetypen wurde jeweils ein Beispiel ausgewählt. Die Wohnanlagen sind regional gestreut und in sehr unterschiedliche städtebauliche Umgebungen eingebunden.
Lösungsansätze bei den Konstruktionen
Die Bauteile eines Objekts weisen nicht immer einheitliche Bauarten oder Konstruktionsweisen auf. Bei den bautechnischen Lösungsansätzen haben sich Kombinationen von Bauteilen in verschiedenen Bauarten herausgebildet: Holzrahmenwände werden zum Beispiel mit Brettstapeldecken oder Holz-Beton- Verbunddecken kombiniert. Die Gründe dafür liegen weniger im technischen oder wirtschaftlichen Bereich. Ausschlaggebend ist, dass an die betreffenden Bauteile nicht nur unterschiedliche, sondern auch jeweils sehr hohe Anforderungen gestellt sind, die mit einer »Allround-Konstruktion« kaum erfüllt werden könnten. Die Heterogenität dieser Lösungen ist also typisch für die neueren konstruktiven Ansätze geworden und sie kontrastiert vor allem mit dem amerikanischen Ansatz.
Dort wird Rationalisierung gerade durch möglichst einheitliche Konstruktion und Produktionsweise erreicht. Dieser Vorzug geht aber verloren, wenn höhere Ansprüche immer mehr zusätzliche Vorkehrungen nötig machen. Heterogenität der Konstruktionen ist allerdings ein bekanntes Problem der Bautechnik, das auch die Bauschadensforschung oft beschäftigt. Es stellt sich also vor allem die Frage, ob die Verschiedenartigkeit der Elemente - etwa schalltechnisch guter Geschoßdecken und Treppen zum Beispiel in Beton oder unempfindlicher Fassaden aus zementgebundenen Materialien - den Wohnungsbau in Holzbauweise »belastet« oder nicht. Die Modellvorhaben konnten aber zeigen, dass solche Probleme mit dem Fachwissen der Unternehmen, Ingenieure und Architekten vermeidbar oder lösbar sind.
Ausgangssituation im Konstruktiven
Unter den Konstruktionsweisen war vor allem die Holzrahmenbauweise schon allgemein bekannt, sie war bei den frühen Projekten des Modellprogramms ausschließlich eingesetzt worden. Bei den nachfolgenden Projekten wurde zum einen der Holzrahmenbau weiter entwickelt - der Vorfertigungsgrad wurde zum Beispiel erhöht - zum anderen dachten Architekten und Unternehmen über neue Möglichkeiten nach und setzten diese um. So entstand die erstmals in Aichach eingesetzte und auch in Ingolstadt- Buxheimer Weg verwendete Dickholz-Bauweise. Die Brettstapel-Bauweise, auch eine Entwicklung des modernen Holzbaus, kam im Rahmen der Modellvorhaben erstmals in Schweinfurt, also bei einem der späten - erst 1998 fertiggestellten - Bauvorhaben, zum Einsatz. Die Bewohner schätzen an dieser Bauart, dass die Holzdecke sichtbar belassen werden kann, die Wohnräume werden dadurch aufgewertet.
Erarbeitung der Konstruktionen im Projektablauf
Bei Projekten in Holzbauweise kommen Fragen der Konstruktion früher ins Spiel als zum Beispiel beim Bauen »Stein auf Stein«. Der Ansatz des Modellprogramms, zuerst einen Typenwettbewerb durchzuführen, hat dem Rechnung getragen. Eine hochwertige und kostengünstige Bauausführung erfordert auch die frühzeitige Mitwirkung des ausführenden Betriebs. Soweit mit dem Projekt zugleich ein Bausystem neu oder weiter entwickelt wird, sind auch Kooperations- und Vertragsformen wichtig, die bis in die Ausführungsphase technische Entwicklungsarbeit zulassen, ohne dass gleich teure Nachtragsangebote folgen. Viele Projektbeteiligte registrieren im Übrigen, dass beim Holzbau durchgängig eine gewisse Disziplin und Genauigkeit verlangt ist.
Vorfertigung
Eine besonders intensive Zusammenarbeit der Beteiligten fand zum Beispiel in Erlenbach statt. Architekten, Fachingenieure und Generalunternehmer bildeten ein eng kooperierendes Team, das mehrere Wohnanlagen in Folge realisierte. Der Generalunternehmer ließ die Pläne des Architekten ein Optimierungsprogramm durchlaufen, um die Holzstärken, den Holzverbrauch und den Maschineneinsatz zu optimieren. Dabei erwies es sich als Vorteil, dass durch Ausschreibung und Bauvertrag alle wesentlichen Qualitäten so weit fixiert waren, dass sie der strengen Rationalisierung nicht zum Opfer fielen. In Zusammenarbeit mit Generalunternehmer und Sanitärunternehmen wurden Installationswände entwickelt, die vorgefertigt auf die Baustelle kamen. Ein hoher Vorfertigungsgrad dieser Art trägt dazu bei, dass geforderte und erwartete Qualitäten sicher erreicht werden und er verkürzt die Bauzeit.
Hohe Vorfertigungsgrade sind mit allen hier eingesetzten Bauarten realisierbar - mit Ausnahme der Holz-Beton-Verbund-Decken bei der Verwendung von Ortbeton. Die Möglichkeiten der Vorfertigung wurden aus heutiger Sicht noch nicht bei allen Modellvorhaben ausgeschöpft, was aber auch mit den Terminbindungen zusammenhängen wird, die keine beliebigen Entwicklungs- und Rüstzeiten zulassen.
Was sollte man nachahmen, was sollte man vermeiden? Empfehlungen.
Außenwände
_Äußere Bekleidung gegen Verwitterung geschützt durch Details, die eine rasche und vollständige Trocknung nach Niederschlägen sichern (»konstruktiver Holzschutz«), etwa Brettschalungen mit gutem Wetterschutz durch Dachvorsprünge; weniger heikle Anstriche (Farbton, Produktauswahl), um auf übliche Instandhaltungsintervalle zu kommen; kritisch sind knappe Abstände der Holzverschalungen vom Boden.
_Damit Reparaturen unauffällig bleiben und sich nicht aus ästhetischen Gründen ausweiten, können vor Ort bewitterte Materialien als »Ersatzteile« für die Außenbekleidung vorgehalten werden.
Innenwände
_An Innenwänden und den Innenschalen der Außenwände sollten ohne Schaden überall Bilder und Dekorationen angebracht werden können; es sollte den Mietern bekannt und verständlich sein, wo Hängemöbel angebracht werden können und wo nicht, am besten sollte das in einem bestimmten Bereich (Höhe) umlaufend möglich sein.
Installationen
_Wichtig ist es, Konstruktion und Installation sauber voneinander zu trennen, nur so lassen sich Basteleien auf der Baustelle sicher vermeiden.
_Dies wird durch eine Holzrahmenwand mit vorgesetzter Innenschale erleichtert, eventuell ein weiterer Grund, deren Mehrkosten in Kauf zu nehmen.
_Beispielhaft ist die vorgefertigte Installationswand.
Vereinfachte Konstruktionen
_Neue Bauarten, zum Beispiel Dickholz-Bauteile und Brettstapel-Bauteile, bieten in vielen Fällen einfachere Detaillösungen.
_Dickholz-Deckenplatten können für den Laubengang einfach auskragen, es entstehen dabei keine wesentlichen Wärmebrücken (Ingolstadt).
_Brettstapeldecken können für Laubengang und Balkon auskragen, die Konstruktion hat zufrieden stellende Schallschutzeigenschaften, am Auflager ist keine akustische Trennung notwendig (Schweinfurt).
_Die oft höheren Quadratmeter-Preise dieser Bauteile können je nach Umständen dadurch kompensiert werden, dass sie einfachere Details ermöglichen.
Holzwerkstoffe
_Die Bedeutung von Bauteilen aus Holzwerkstoffen wird weiter zunehmen; so sind TJI-Träger, damals noch aus den USA importiert (München-Altperlach, Nürnberg), jetzt auch in Europa verfügbar.
_Durch die Anwendung von Holzwerkstoffen lässt sich in vielen Fällen der Materialeinsatz optimieren. Importierte Bauteile (nicht holzbauspezifisch)
_Auf das Importieren von Bauteilen wie Fenster, Türen, Schließanlage sollte verzichtet werden, wenn nicht gewährleistet ist, dass sich ohne unverhältnismäßigen Aufwand Ersatzteile beschaffen lassen. Für »sichere« Produkte besteht in der Regel eine Vertriebsorganisation im Inland.
Auswahl von Unternehmen
(gesucht waren vor allem Generalunternehmer, aber auch Einzelgewerk- Vergabe war möglich).
_Bewährter Ansatz: die als Generalunternehmer beauftragte Firma sollte sowohl im Holzbau erfahren sein, als auch die Generalunternehmer-Aufgaben qualifiziert wahrnehmen können.
_Ob Generalunternehmer von Insolvenz bedroht sind, ist bei Vergabe nicht ohne Weiteres erkennbar, zumal auch die Unternehmen selbst sich darüber unter Umständen nicht im Klaren sind oder ihre Risiken unterschätzen; dies ist insbesondere auch bei Firmen denkbar, die zuvor nicht als Generalunternehmer tätig waren; Möglichkeiten der Früherkennung sowie Auffang-Strategien müssen sich weiter entwickeln.
_Dass auch bei größeren Holzbau-Projekten eine Einzelgewerkvergabe möglich ist und gut funktionieren kann, zeigt das Projekt in Sulzbach-Rosenberg; mit dem Holzbau wurde eine Zimmerei beauftragt, diese ließ in Tschechien Elemente vorfertigen und montierte sie selbst; ein erfahrener und engagierter Bauherr übernahm die Rolle des Projektsteuerers.
Zusammenarbeit
_Unabhängig davon, welche Art von Unternehmen gewählt wird, ist die Zusammenarbeit zwischen Planung und Ausführung bei Systembauweisen und komplex ineinander greifenden Gewerken ein entscheidender Faktor für den Projekterfolg.
_Diese Zusammenarbeit ist sowohl bei Generalunternehmer- als auch bei Einzelgewerk-Vergaben möglich, das zeigen die Projekte in Erlenbach und Sulzbach-Rosenberg (Bauherr aus der Baubranche und Architekt).
Projektserie
_Sehr sinnvoll ist es, mit Folgeprojekten auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit aufzubauen, die Projektserie war ein Ziel des Modellvorhabens; durch die Wiederholungen werden Qualität und Kosten optimiert und es stellt sich auch im Holzbau die Routine ein, die bei anderen Bauarten als gegeben vorausgesetzt wird.zuschnitt, Di., 2001.05.15
15. Mai 2001 Rotraut Weeber, Hannes Weeber
Qualität und Quantität des Holzgeschoßwohnbaus in der Steiermark
Im holzreichsten Bundesland Österreichs, der Steiermark, bestand der Wunsch, den Geschoßwohnbau auch konstruktiv in Holz auszuführen. Die Umsetzung sollte nach den Stmk. Wohnbauförderungsbestimmungen erfolgen. Wichtig war dabei der Erfahrungsaustausch mit den benachbarten Ländern. Ab 1993 wurden die neuen Holzbauten in Bayern von Vertretern der Steirischen Landesverwaltung besichtigt und intensiv hinterfragt: Die mehrgeschoßigen Wohnhäuser etwa in Ingolstadt, Schwabach, Nürnberg, Aichach, Waldkraiburg und die Holzsystembauten für Aussiedler in Hemau, Ambach, Sulzbach- Rosenberg, Neu-Ulm und Schweinfurt.
Die ersten Holzbauten in der Steiermark wurden dann nach Planungswettbewerben bzw. Gutachterverfahren ausgewählt, zum Teil als Forschungsvorhaben deklariert ausgeführt, bauphysikalisch güteüberwacht und auch einer genauen Kostenkontrolle unterzogen. Dies gilt besonders für die Bauvorhaben Veitsch, Gaishorn, Graz. Bayer- bzw. Faunastraße. Parallel zu dieser Entwicklung hat Architekt Hubert Riess an der Umsetzung von Judenburg als Auftragsplaner für die wag Linz gearbeitet. Mit Einführung des novellierten Baugesetzes 1995 wurden die holzdiskriminierenden Gesetzesbestimmungen beseitigt. Generell wurden baustoffneutrale Regelungen angestrebt; weiters wurde das Kleinhaus mit drei statt bisher zwei Geschoßen neu definiert und die Eigenverantwortlichkeit von Planer, Bauherr und Bauführer besonders betont.
Die steirischen Beispiele im Geschoßwohnbau wurden in verschiedenen Holzbausystemen umgesetzt. Waren es anfangs Konstruktionen in Kleinplattenbauweise für Wände und Decken, welche auf die Baustelle halb fertig geliefert wurden und dann zimmermannsmäßig, auch bei extremen Witterungsbedingungen, montiert und an der Baustelle mit verschiedenen Professionisten fertig gestellt wurden, wird derzeit eher die Großplattenbauweise ausgeführt. Dabei werden Wände und Decken samt Installationen und Fensterabschlüssen in der Montagehalle gefertigt. Die Endmontage erfolgt größtenteils durch die Holzbausystem- Hersteller: In der Steiermark unter anderen die Firmen Kohlbacher, Kulmer, KLH, Holz-Bau- Weiz, Compacthaus, Harrer und Fröhlich. Die Holzspanplatten wurden in den Hintergrund verdrängt und größtenteils durch Massivholz wie Seitware- Bretter ersetzt bzw. durch hochdruckverleimte, kreuzweise geschichtete Bretter zu tragenden Vollholzelementen für Wände, Decken und Stiegen verbunden. Bei Stiegenhäusern, Fluchtwegen und Fassadenausführungen wurde auf den Brandschutz besonders Bedacht genommen.
Bauphysikalisch war sowohl das Problem der Schalllängsleitung zu lösen als auch eine geeignete Deckenkonstruktion zu finden, welche die geforderte Trittschalldämmung bei übereinander liegenden Wohnungen erfüllt. Aus Bayern waren keine optimalen Lösungen zu erhalten. Bei Gaishorn 1, Donnersbachwald und Graz fielen die Messergebnisse günstig aus (Deckenkonstruktionen in Rahmen- und Füllelementen bzw. genagelter Brettstapeldecke mit Ortbetonestrich und abgehängter, biegeweicher Deckenuntersicht). Bei Veitsch 1 waren die Anforderungen nicht so hoch, da es sich um ein reihenhausartiges Bauvorhaben handelte.
Um alle Voraussetzungen zu optimieren, wurde beim Bauvorhaben in Judenburg vorerst nur das erste Haus mit 6 Wohnungen von der Rechtsabteilung 14 (RA 14) des Landes Steiermark zur Errichtung (Bauphysik- Eignung) freigegeben. Nach positiven Messergebnissen aller Bauteile im Verbund konnte das Gesamtbauvorhaben mit 42 Wohnungen realisiert werden. Durch die positive Zusammenarbeit von Planer, Bauherr, Behördenvertreter, Bauleitung, ausführenden Firmen einschließlich der begleitenden Kontrolle durch den eingesetzten Bauphysiker und Holzbauexperten wurde das Bauvorhaben im vorgegebenen Kostenrahmen als Musterobjekt fertig gestellt und den Bewohnern 1998 übergeben.
Es folgten weitere »Pilotprojekte« in Langenwang, Mürzsteg, Lassing, Rinnegg, Übelbach, Trofaiach, Leoben- Leitendorf und Frohnleiten. Die von der RA 14 von 1994 bis jetzt betreuten 62 Holzbauvorhaben mit insgesamt 1.218 Wohneinheiten sind größtenteils, das heisst cirka zu 87%, entweder bereits fertig gestellt, befinden sich im Bau oder vor Baubeginn. Das sind 54 Bauvorhaben mit insgesamt 1.068 Wohneinheiten, welche einem Holzbauvolumen von etwa 200 Wohneinheiten pro Jahr bzw. rund 8% der Geschoßbauförderung in der Steiermark entsprechen. Darüber hinaus befinden sich 8 Geschoßbauvorhaben mit insgesamt 150 Wohnungen in Planung und werden in den nächsten 1 bis 2 Jahren umgesetzt.
Um den Ablauf der konstruktiven Planung und der Umsetzung reibungsloser zu gestalten, wurde das Institut für Hochbau und Industriebau der TU Graz unter der Leitung von Univ.-Prof. Horst Gamerith beauftragt, die bauphysikalische Eignungsprüfung bis zu jenem Zeitpunkt durchzuführen, wo alle Holzbauhersteller ihre Leitdetails vorgelegt haben und durch die Kontrolle auf der Baustelle die erforderlichen Gütewerte für den Schall-, Brand-, Feuchte- und konstruktiven Holzschutz, sowie für die Haus- und Solartechnik und die Dauerhaftigkeit erfüllt werden. Wünschenswert ist, dass durch diese intensive planerische Tätigkeit eine hohe Holzbauqualität mit minimierten Baumängeln entsteht und die Holzbaukosten bei ökologisch fortschrittlicher Qualität im Rahmen des geförderten Geschoßwohnbaues Platz finden. Damit soll jene Holzbauakzeptanz bei der steirischen Bevölkerung erweckt werden, die es ermöglicht, künftig im sozialen Wohnbau verstärkt mit Holz bauen zu können.zuschnitt, Di., 2001.05.15
15. Mai 2001 Walter Kuschel
Von Holzwegen
Der Holzwohnbau ist für Hubert Riess zu einer persönlichen Leidenschaft und zu einer professionellen Passion geworden. Mit seinen die Marktbedingungen ausreizenden Holzbauten und seinen pointierten Wortmeldungen zum Holzbau hat er dessen Rahmenbedingungen in Bayern und in Österreich beeinflusst. Ein Bekenntnis zur permanenten Reform der Holzarchitektur.
Was mich im Augenblick am meisten beschäftigt: Wie kann ich meine architektonische Arbeit auf einem einmal gewonnenen Niveau stabilisieren? Durch welche Veränderung vermag ich respektable Standards des Holzwohnbaus unter sich verschärfenden kulturellen und ökonomischen Verhältnissen zu halten? Konkreter: Wie kann ich den wenigen, unter wirtschaftlichem Druck stehenden Holzbauanbietern, die sich mit meiner Hilfe am Markt etabliert und offensiv in die Modernisierung und Rationalisierung der Produktionsanlagen für den Holzrahmenbau investiert haben, durch eine verbesserte Planung begegnen, dass die architektonische Qualität nicht kaputt geht.
Der Holzbau ist im Baugeschehen eben noch immer nicht gleichberechtigt und kein Selbstläufer. Ich habe mich bei meinen Projekten ab Waldkraiburg an fast allen Teilsystemen eines Wohnbaus versucht, um diese intelligenter und »schöner« zu gestalten, und bin damit prompt über den herkömmlichen Kostenlimits gelandet. Mit großen finanziellen Einbußen ist es trotzdem gelungen, diese Bauten umzusetzen. Die meisten Wohnbaugenossenschaften wählen den niedrigeren Preis, weil Abstriche in der Architektur bekanntlich nicht wehtun. Wenn man in Holz baut, ist man heute jedenfalls politisch korrekt; der baukulturelle Aspekt darf nichts kosten. Meine Bauten in Judenburg, Mürzsteg und Trofaiach waren in ihren Ambitionen letztlich durch den Qualitätsanspruch der bestellenden Genossenschaft abgesichert und dadurch vor unautorisierten Vereinfachungen des Holzbauanbieters geschützt.
Nachdem es im geförderten Wohnbau in der Steiermark Usus wurde, Bauten materialoffen mit denselben Kostenobergrenzen auszuschreiben, also die Ziegel-, Beton- oder Holzbauweise wahlweise zuzulassen, haben Holzbauunternehmer ihre Kompetenz im Ausreizen von Abwicklung, Logistik und Preisbildung entdeckt und auch den üblichen genossenschaftlichen Besteller überzeugen können. Gleichzeitig besteht in der Steiermark oder in Wien die erklärte landespolitische Bereitschaft, beachtliche Wohnbaukontingente in Holz errichten zu lassen.
Die Chance für Wohnbau aus Holz, die in Bayern und der Steiermark seinerzeit zunächst auf politischer Ebene eingeräumt wurde, wird hier wie dort trotz Förderung nur dann vermehrt aufgegriffen werden, wenn zusätzlich zu den schon geforderten Standards eine reibungslosere Bauabwicklung in der Hand von Komplettanbietern zu erwarten ist. Wollen die Landespolitiker den Holzbau, dann müssen sie diese Entwicklungschancen aufrecht erhalten, sei es explizit durch baukulturelle Bekenntnisse oder implizit über ökologische Richtlinien in den Fördergrundsätzen. Wenn, wie wir es bisher nicht können, zeittypische Zielkataloge erfüllt werden müssen, gewinnt das Holz an Rang. So bieten Energiesparhäuser große Chancen für den Geschoßwohnbau, weil die Ökoambition gesellschaftspolitisch etabliert ist und sich hervorragend über den Holzbau einlösen lässt: Niedrigenergie zieht am besten.
Zudem möchte ich den Schritt zu Massivholzelementen propagieren, um manches Vorurteil oder manche Befürchtung gegenüber dem Holzbau wegen Formänderung, Hohlraumgehalt, Entflammbarkeit, Brandausbreitung, Vielschichtigkeit im Aufbau, Folien u.s.w. aus dem Weg zu räumen. Mein Anliegen wäre, dass Plattenelemente wie etwa aus Kreuzlagenholz, eventuell in Raumzellen vorgefertigt, auch das Raummilieu bestimmen. Über qualifizierte Leitprojekte hätten die Vorteile dieses Produktes (immense Verwertungschance für Schwachholz, hohe Form- und Brandbeständigkeit, bessere Oberflächenqualitäten durch Einsatz gewünschter Holzsorten in den Deckschichten) bereits lanciert werden müssen, getragen von qualifizierter Architektur. Dazu wäre intensive Entwicklungsarbeit notwendig, bei der alle Projektbeteiligten gleichzeitig gefordert sind.
Wenig Sinn sehe ich in der ständigen Neuerfindung von Holzbausystemen aus wissenschaftlicher Profilierungssucht, falschverstandenem unternehmerischem Kalkül oder regionalpolitischer Eitelkeit. Mir geht es um die Perfektionierung des Erreichten oder des Begonnenen auf einem österreichischen Standard. Das so Eingesparte muss in andere Qualitäten verlagert werden oder der Holzbau tatsächlich günstiger an die Nutzer weitergegeben werden.
Für mich liegt die primäre Herausforderung in einer dem Holz adäquateren Architektursprache. Zudem wird Holz nicht seinem Potenzial entsprechend von den Herstellern in den Gesamtbauprozess eingegliedert, der Holzbauer muss als Generalunternehmer auftreten. Die Baustelle muss also so weit wie nur möglich in die Halle verlagert werden. Es fehlen attraktive systemgerechte Projekte dafür. Derzeit werden im Holzbau noch zu viele Arbeitsgänge verlangt. Das führt zu einer zu geringen Wertschöpfung, zu wenige Firmen steigen in den Holzwohnbau ein. Der Besteller sehnt sich nach einer unproblematischen Realisierung auf der Baustelle, gewährleistet durch eine integrierte Vorschau von Planung und Produktion. Hier liegt die noch ungenutzte Hauptchance für den Baustoff Holz: leicht statt schwer, trocken statt nass, schnell statt langsam, leichtsystematisch statt schwerarchaisch.zuschnitt, Di., 2001.05.15
15. Mai 2001 Hubert Rieß