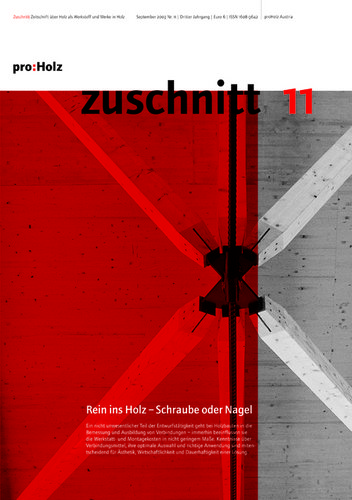Editorial
Das Thema gab es ja schon lange. Es tauchte regelmäßig in den Redaktionssitzungen auf, hieß einmal Verbindungen, dann Verbindungstechnik oder Verbindungsmittel und fand in jeder Jahresplanung Erwähnung, ohne eingehender diskutiert zu werden. Fest stand, dass es als wichtig genug befunden wurde, ihm einen ganzen Zuschnitt zu widmen. Als man sich zusammenfand, um Erscheinungstermin und Heftinhalt festzulegen, als es darum ging, Anregungen und Wünsche zum Inhalt zu sammeln, wucherten die unterschiedlichsten Vorstellungen üppigst und unstrukturiert.
Das Thema sollte komplex und tiefgehend abgehandelt werden, Entwicklung und Geschichte der Holzverbindungen seit der Steinzeit sollten ebenso Platz finden wie die hohe Kunst japanischer Holzverbindungen oder die Art und Weise, Verbindungen ebenso primitiv wie wirksam mit Seilen herzustellen. Generationen von Pfadfindern bekommen diese Verbindungstechnik als Basiswissen heute noch vermittelt. Es wurde angeregt, klassisch-mechanische Verbindungen und Sonderlösungen zu trennen, nach »punktförmigen, linearen und flächigen Verbindungen« zu ordnen, nach dem Materialverbund »Holz-Holz, Holz-Beton, Holz-Glas« zu unterscheiden. Die Renaissance der zimmermannsmäßigen Verbindungen, also jener Holz-Holzverbindungen, die im allgemeinen kraftschlüssig wirken, mittels CNC-Technik (Computer numerical control, siehe Zuschnitt 9, Seite 26) dürfe nicht fehlen, hieß es. Das Thema Verbindungen sollte auf dem Stand der Technik, anwenderbezogen und problemorientiert abgehandelt werden. Angesichts der fast erschlagenden Fülle an Vorschlägen zum Inhalt zeigte sich zweierlei: einmal, dass eine Ordnungsstruktur, eine Kategorisierung vonnöten sei und zugleich, dass es unmöglich sein würde, das Thema in seiner ganzen Bandbreite und Komplexität in eine Zuschnitt-Nummer zu packen. Die Verbindungstechnik musste eingegrenzt werden auf einen Umfang, der im traditionell schlanken Zuschnitt Platz finden kann, ohne oberflächlich behandelt zu sein. Der »Morphologische Kasten, frei nach Zwicky« tauchte auf. Er fand als Ordnungsstruktur Erwähnung, aus der man schwerpunktartig jene Verbindungen oder Verbindungsmittel herausnehmen sollte, die Entwicklungspotenzial haben. Keiner fragte genauer nach, wer Zwicky und dieser ominöse Kasten sei. Eine Bildungslücke? Wer ihn nicht kannte, hatte wohl eine vage Vorstellung. Als zu umfassend verworfen, ging Zwickys Kasten in der Diskussion wieder unter. In die kam nun - kraftvoll stählern - der Nagel und mit ihm der Vorschlag, sich im Zuschnitt doch ausschließlich ihm und seiner Vielfältigkeit, seiner Potenz und zugleich Einfachheit zu widmen. Ein ganzes Heft nur für den Nagel? Manchen schien das doch zu puristisch und man einigte sich darauf, auf den universellen Überblick zwar zu verzichten, sich statt dessen aber den stift - oder stabförmigen Verbindungsmitteln, bei denen die Nägel eine Art Prototyp bilden und ihrer Entwicklung zu widmen - ausführlich und facettenreich. Sie finden im Zuschnitt nun den Versuch einer geordneten Übersicht über das komplexe Thema «Stabförmige Verbindungsmittel«, ihre Charakteristik und ihre Anwendungsmöglichkeit, dann einen Fachartikel über das Potenzial von Schrauben, deren Entwicklung sich bekanntlich von der der Nägel ableitet, einen Beitrag über die neueste Entwicklung bei Stabdübeln, die ihren vorläufigen Höhepunkt im auch für Laien bestechend leistungsfähigen selbstbohrenden Stabdübel findet, in der Folge ein Anwenderbeispiel zu vorgenanntem und schließlich eine sehr persönlich gehaltene, fast philosophische Betrachtung konstruktiver Verbindungsmittel mit den Augen des Praktikers Wolfgang Pöschl. Überlegungen zum Brandschutz von Knoten und Verbindungen runden das Thema ab, während Geschichte und Wesen des »Matador«, jenem seit 100 Jahren unverwüstlichen Holzbaukasten aus Klötzen und stabförmigen Verbindungsmitteln, in den Holzrealien die feine Würze des Themas bilden.
P.S. Wenn Sie ebenso neugierig geworden sind wie wir und genau wissen wollen, was der »Morphologische Kasten, frei nach Zwicky« denn sei, dann lesen Sie weiter und folgen Sie unserer Recherche. Das Wort »Morphologie« entstammt dem Griechischen und bedeutet in enger Übersetzung soviel wie »Lehre von den Gebilden, Formen, Gestalten, Strukturen« und deren zugrundeliegenden Aufbau- bzw. Ordnungsprinzipien. Als Morphologie kann man also jede nach bestimmten Prinzipien hergestellte Ordnung bezeichnen. Überträgt man das Merkmal »Ordnung« auf das Denken, dann bedeutet Morphologie soviel wie »Lehre vom geordneten Denken«. Schließlich versteht man unter dem Begriff auch die vergleichende Betrachtung zweier Ordnungen, Systeme usw. mit ihren Aufbau- und Wirkungsprinzipien, um aus dieser Gegenüberstellung Erkenntnisse abzuleiten.
Der Schweizer Astrophysiker und unkonventionelle Universalgelehrte Fritz Zwicky (1898-1974) gilt als profiliertester Morphologe des 20. Jahrhunderts. Die von ihm begründete Morphologie hat zum Ziel, alle logisch denkbaren Möglichkeiten einer Problemstellung systematisch zusammenzutragen, Denk- und Handelsblockaden aufzubrechen und kreative Denkprozesse methodisch zu gestalten. Ein wahrhaft hoher Anspruch, den Zwicky mit seinem Morphologischen Kasten verbindet. Das Thema der Verbindungen nach dieser Methodik abzuhandeln, könnte Anspruch und Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit sein - den Rahmen und die Möglichkeiten des Zuschnitt übersteigt es bei weitem. Karin Tschavgova