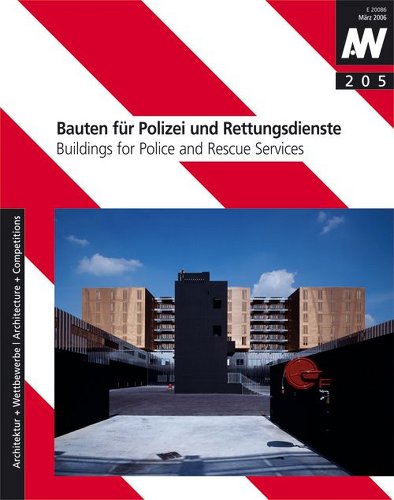Editorial
Schon seit ein paar Jahren lässt sich ein erhöhter Neubau- beziehungsweise Sanierungsbedarf für Gebäude der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste beobachten. Vielerorts sind die momentan genutzten Bauten durch das Anwachsen der Gemeinden mittlerweile vollständig ausgelastet; zudem hat die ständige Vergrößerung der Aufgabenbereiche der Rettungskräfte zu einer Zunahme der technischen Ausrüstung geführt, die sinnvoll und vor allem auch »im Trockenen« untergebracht werden muss. Auch wenn viele Stadtkassen derzeit leer sind, werden für die Finanzierung der Projekte zunehmend neue Wege gefunden (beispielsweise im Rahmen von so genannten Public Private Partnership Projekten), so dass auch für Architekten in diesem Bereich verstärkt Wettbewerbe und Aufträge zu erwarten sind. Feuer- und Rettungswachen zählen jedoch – ebenso wie Gebäude für die Polizei – zweifellos zu den anspruchsvollsten Bauaufgaben, die es gibt. Nicht nur, weil die Bauten trotz Ihrer vergleichsweise beträchtlichen Größe meist eine zentrale Lage in Städten und Gemeinden einnehmen und damit eine große Wirkung nach außen, in mancher Hinsicht sogar Anziehungskraft haben. Vielmehr sind es die enorm hohen Anforderungen hinsichtlich der Funktionalität und Sicherheit, die diese Bauaufgabe an die Planer stellt. Wo bei einem anderen Gebäude, einer Stadthalle etwa oder einer Schule, längere Wege und ungünstige Funktionszuordnungen zugunsten der räumlichen Gesamtwirkung schon einmal billigend in Kauf genommen werden und die Architekten somit einigermaßen »freie Hand« haben, hätte dies bei einer Feuer- oder Rettungswache mit Sicherheit fatale Folgen. Jede falsch positionierte Treppe, jede schlecht belichtete Fahrzeughalle oder unübersichtliche Ausfahrt kann die Rettungskräfte im Ernstfall entscheidende Minuten kosten oder selbst zur Ursache für Unfälle werden. Ganz wesentlich für diese hochgradig effizienten Zweckbauten ist aber auch die Tatsache, dass bei ihnen zwei ganz unterschiedliche Bereiche zwangsläufig oft sehr eng miteinander verzahnt sein müssen – der »Technikbereich« (Fahrzeuge, Werkstätten und Übungseinrichtungen) und der »Personalbereich« (Aufenthalts- und Schlafräume). Hierbei funktional sinnvolle Lösungen zu finden, die auch gestalterisch ansprechend sind, ist auch für erfahrene Architekten nicht immer ganz einfach. Doch gerade die innenräumlichen Qualitäten, insbesondere in den Wohn- und Aufenthaltsbereichen, tragen wesentlich dazu bei, dass sich das im Schichtdienst befindliche Personal wohl fühlt und nach schweren Einsätzen entsprechend ausruhen und regenerieren kann. Wie diese Anforderungen von Architekten vorbildlich umgesetzt werden können, zeigen zahlreiche Bauten in dieser Ausgabe von Architektur + Wettbewerbe. Bei Volker Staabs Servicezentrum auf der Münchner Theresienwiese schaffen beispielsweise vier Innenhöfe ruhige Oasen für die Einsatzkräfte inmitten des Oktoberfestrummels. In der Hauptfeuerwache von Utrecht von Claus en Kaan Architecten gibt es hingegen ein großes »Wohnzimmer« mit angeschlossenem Fitnessbereich und Außenterrasse. Und in Nanterre integrierten Jean Marc Ibos und Myrto Vitart auf vorbildliche Weise gar die Wohnungen für die Familien der Feuerwehrleute in das Gesamtprojekt. Arne Barth