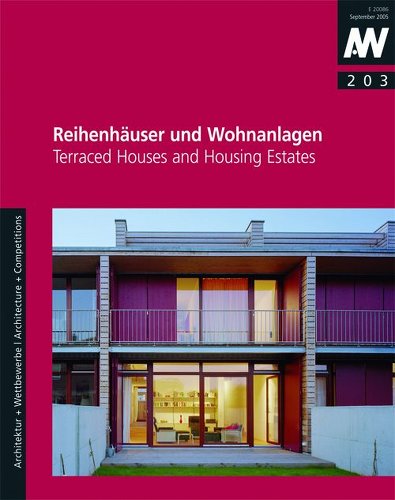Editorial
Aktuelle Umfragen belegen, dass die deutschen »Häuslebauer« nach wie vor von einem freistehenden Einfamilienhaus träumen. Rund zwei Drittel der Bevölkerung wünscht sich ein Haus, »um das man herumgehen kann«, und scheint dabei die fatalen Folgen dieser Entwicklung – den unablässigen Flächenfraß etwa oder die damit verbundene zunehmende Belastung durch den Individualverkehr – völlig auszublenden. Verwunderlich ist dies nicht, hat doch der Staat diese Wunschträume durch die Pendlerpauschale und die Eigenheimzulage jahrelang tatkräftig subventioniert. Auch wenn die Tendenz mittlerweile weg vom Neubau und hin zu gebrauchten Immobilien geht, ändert dies nichts an der Tatsache, dass für eine nachhaltige, zukunftsorientierte Entwicklung des Wohnungsmarktes ein grundsätzliches Umdenken erforderlich ist. Eine stärkere Förderung des verdichteten Wohnungs- und Siedlungsbaus – auch innerhalb der Kernstädte – wäre dazu ein geeignetes Mittel. Die Vorteile liegen auf der Hand: Durch Reihenhaussiedlungen und kompakte Wohnanlagen können nicht nur der fortgeschrittenen Zersiedelung und dem drohenden Verkehrsinfarkt Einhalt geboten, sondern in einem erheblichen Umfang auch Kosten eingespart werden (beispielsweise durch eine günstigere Flächenausnutzung der Grundstücke, die Verminderung der Heizkosten durch geringere Außenwandanteile oder die Möglichkeiten der seriellen Vorfertigung von Bauteilen), so dass für junge Familien Wohnraum wieder bezahlbar wird. Auch negative Folgen der Suburbanisierung für das soziale Gefüge können durch verdichteten Wohnungs- und Siedlungsbau verhindert werden, die offenkundige Ausgrenzung von Minderjährigen, Behinderten, Älteren oder sozial Schwachen etwa, für die es in Zonen mit niedriger Bevölkerungsdichte oft nur ein beschränktes Angebot an Dienstleistungen und öffentliche Einrichtungen gibt, oder die zunehmende Gettoisierung städtischer Gebiete durch die Abwanderung derer, die es sich leisten können. Doch leider führt dieses Thema bei vielen Gemeinden und Bauträgern nach wie vor ein Schattendasein und so wundert es auch nicht, dass die Nachfrage nach solchen Wohnformen bei der Bevölkerung gering ist und der Wohnungsbau gemeinhin als Stiefkind deutscher Architekten gilt. In der Schweiz, in Österreich, in Dänemark und vor allem in den Niederlanden (siehe Seite 2ff.) ist das bekanntermaßen anders. Das Ziel müsste sein, auch hierzulande verstärkt gute Architekten dafür zu gewinnen, um das Feld nicht nur den Bauträgern mit ihren eintönigen Plänen aus der Schublade zu überlassen. Wie innovative, nachhaltige und gestalterisch ansprechende Lösungen für einen verdichteten Wohnungs- und Siedlungsbau aussehen können, zeigen die ausgewählten Beispiele in diesem Heft. Arne Barth