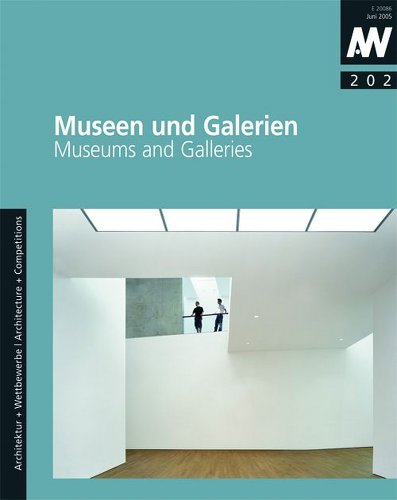Editorial
Ungeachtet weltweiter ökonomischer Krisen ist das Interesse der Menschen an Museen und Ausstellungen seit Jahren ungebrochen. Allein in Deutschland wurden bei der letzten statistischen Erhebung im Jahr 2002 mehr als 100 Millionen Museumsbesucher gezählt – Tendenz steigend. Doch nicht nur in der Bundesrepublik, die mit über 6000 öffentlich zugänglichen Sammlungen mittlerweile ohnehin über die größte »Museumsdichte« der Welt verfügt, auch anderorts lässt sich kaum eine einigermaßen bedeutende Stadt ausmachen, die trotz angespannter Haushaltslage in den letzten Jahren nicht wenigstens ein neues Ausstellungsgebäude eröffnet hat oder zumindest den Baubeginn eines solchen vermelden konnte.
Zeitgenössische Museen zählen mittlerweile zu den am meisten beachteten Bauten im öffentlichen Raum. Immer mehr Gemeinden – auch kleinere oder solche, die zumindest unter kulturellen Gesichtspunkten bislang eher weiße Flecken auf der Landkarte waren – setzen dabei auf den »Bilbao-Effekt«. Seit Frank O. Gehry 1997 in der baskischen Hauptstadt für die Guggenheim-Stiftung eine seiner Aufsehen erregenden Bauskulpturen errichtete, die jährlich mehr als eine Million Besucher anlockt, wünschen sich viele Städte ebenfalls ein »Markenprodukt von einem Stararchitekten« und hoffen auf eine kulturelle und wirtschaftliche Initialzündung – nicht selten vergeblich.
Dass die spektakulären, meist selbst zu Kunstwerken erhobenen Gebäude oft wichtiger geworden sind, als die dort ausgestellten Exponate, scheint kaum jemanden zu stören. Im Gegenteil: Die meisten Museen werden derzeit ganz bewusst als »hybride Gebäude« geplant und nicht als neutrale, rein funktionale »Behälter« für die dort gesammelten und zur Schau gestellten Natur- und Kunstgegenstände. Großzügige Foyer- und Aufenthaltsbereiche, Cafés, Bars und Restaurants, Shops und Buchhandlungen, Auditorien und Kinosäle, Bibliotheken, Studienzentren und Konferenzbereiche sind bei der zunehmenden programmatischen Komplexität vieler Museen mittlerweile Standard und werden gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten zu ganz anderen Zwecken – beispielsweise für Modeschauen oder Produktpräsentationen – genutzt. Die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz verwischen zunehmend. Aufgrund der hohen Bau- und Betriebskosten sind sich die Leiter und die Kuratoren der Museen und Galerien bewusst, dass sie sich auf einen Spagat einlassen müssen, um den Anforderungen der Sponsoren und den Wünschen der großen Masse der Besucher so weit wie möglich und eben noch vertretbar entgegen zu kommen. Den anzustrebenden »goldenen Mittelweg« beschreibt Michael Eissenhauer, der Präsident des Deutschen Museumsbundes, wie folgt: »Eine Architektur, die auf die Plätze zwingt und definiert, dass ein bestimmtes Bild nur an diesem Ort gestellt oder gehängt werden kann, ist sicherlich nicht eine Museumsarchitektur, die uns weiterbringen kann. Aber eine Museumsarchitektur, die eine eigene Geste entwickelt und eine Selbstständigkeit formuliert und sich selber auch provozierend nach außen artikuliert, muss für eine starke Sammlung überhaupt kein Handicap sein, sondern eine Herausforderung.« Die Mehrzahl der Architekten der in diesem Heft vorgestellten Bauten und Projekte ist diesen Weg mit Erfolg gegangen.
Arne Barth