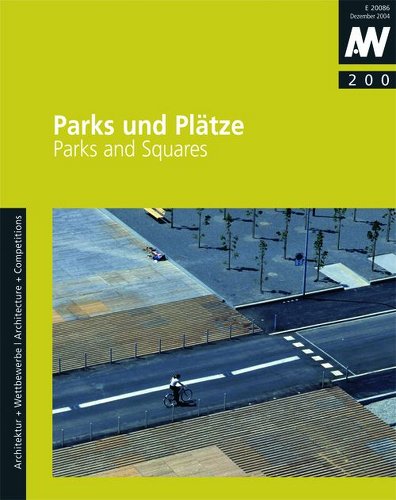Editorial
Wenn Sie dieses Heft aufmerksam durchblättern, fällt Ihnen möglicherweise etwas auf: Während wir uns bei der fotografischen Dokumentation von Gebäuden – egal ob es sich dabei um Schulen, Wohnhäuser, Bibliotheken, Kirchen oder Kulturzentren handelt – längst damit abgefunden haben, dass die Architektur meist autark, das heißt reduziert auf die Darstellung der Räume ohne jegliche Anzeichen menschlicher Existenz gezeigt wird, tauchen auf den Bildern von Plätzen und Parks immer wieder Menschen auf, bevölkern Fußgänger, Radfahrer, Stehende, Sitzende oder Liegende die Szenerie. Anders als bei Gebäuden scheinen funktionierende urbane Freiräume sich auch auf Bildern primär über die Anwesenheit von Menschen zu legitimieren. Ein »öffentlicher Raum« ohne Öffentlichkeit erweckt schnell den Eindruck trostlos oder gar bedrohlich zu sein und lässt auf eine mangelnde Akzeptanz seitens der Bevölkerung schließen.
In der Tat gab und gibt es solch heruntergekommene, schlecht genutzte oder gar brachliegende Flächen in vielen Städten zuhauf. Aufgrund der fehlenden eigenen finanziellen Möglichkeiten vertrauten Städte und Gemeinden das Problem in der Vergangenheit oft privaten Investoren und Projektentwicklern an, die in den Innenstädten riesige Einkaufspassagen nach amerikanischem Vorbild errichteten – als »urbane Anziehungspunkte« und überdachter Ersatz für tatsächliche öffentliche Freiräume.
Im Nachhinein hat sich gezeigt, dass diese Entwicklung meist in die falsche Richtung ging. Auch wenn die Probleme Sicherheit und Sauberkeit in den »Plazas«, »Centern«, »Passagen« oder »Galerien« durch den Einsatz Wachschutz, Überwachungskameras und allnächtliche Putzkolonnen gelöst werden, unterliegen diese Orte eben privatwirtschaftlicher Kontrolle und können daher nur bedingt als »öffentlich« bezeichnet werden. Die Menschen sollen dort in erster Linie konsumieren – für herumtollende Kinder ist in den Hausordnungen ebenso wenig Platz wie für Straßenmusiker, Hundebesitzer, Erholungssuchende oder größere Menschenansammlungen. Die Sterilität und Einförmigkeit dieser Shopping-Malls mit ihren immergleichen Filialisten und Franchiseunternehmen lässt zudem eine Aneignung oder gar Identifikation seitens der Bevölkerung nicht zu.
Gerade die Erkenntnis, dass derartig künstlich geschaffene städtische Räume beliebig austauschbar sind, hat dazu geführt, dass in vielen Städten mittlerweile ein Umdenken stattgefunden hat. Man ist wieder dazu übergegangen, sich auf die Aufwertung des tatsächlichen öffentlichen Raums zu besinnen und diesen als wichtiges Element der Stadtentwicklung und als kommunalpolitische Herausforderung zu betrachten. Für die Attraktivität einer Stadt zählen nicht nur Aspekte wie Sicherheit und Sauberkeit, sondern auch die Unterscheidbarkeit von anderen Städten. Plätze und Parks werden von der Bevölkerung wieder verstärkt als ein Teil urbaner Lebensqualität und als eine Bühne des öffentlichen Lebens wahrgenommen. Der unverwechselbar gestaltete Freiraum ist wieder zum Thema geworden – auch für Architekten. Mit 17 realisierten Beispielen, vier Projekten und den Ergebnissen von drei hochkarätigen internationalen Wettbewerben wollen wir in dieser, mittlerweile 200. Ausgabe von AW Architektur + Wettbewerbe dazu einige Anregungen geben. Arne Barth