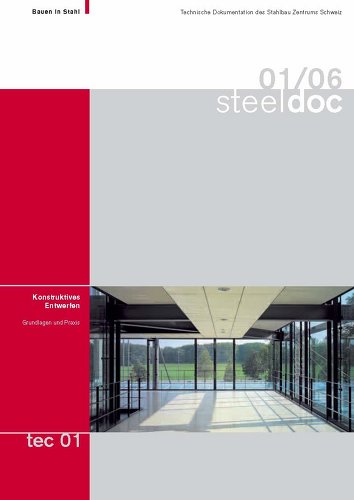Editorial
Bauen in Stahl ist ein konstruktiver Prozess. Schon beim ersten Entwurf muss sich der Planer Gedanken zur Tragstruktur, zu Spannweiten und Stützenabständen machen. Denn beim Bauen mit Stahl fügt sich das eine zum anderen. Ist die Wahl des Strukturrasters getroffen, so entsteht aus Stützen, Balken und Verstrebungen ein stabiles Skelett, das als Grundlage für den Einbau von Decken, Wänden und der Gebäudehülle dient. So einfach die Sache im Grunde ist, umso ausschlaggebender ist die Wahl der Elemente und die Kenntnis ihrer Funktionsweise. Es gibt Stützen, Träger und Deckenelemente aller Art und Grösse, die sich zu einem Ganzen fügen. Die Fügung bestimmt nicht nur das Tragsystem, sondern auch den Raum selbst. Was die Griechen «Tektonik» nannten, ist beim Stahlbau höchst legendig. Es ist die Baukunst des Fügens von tragenden und raumabschliessenden Elementen zu einem Ganzen. Das ist Architektur.
Das vorliegende Heft ist eine Sonderausgabe von Steeldoc mit technischem Schwerpunkt. Es ist die erste Ausgabe dieser Art, und sie widmet sich dem konstruktiven Entwerfen mit Stahl. Die Einführung ist eine Bestandesaufnahme der bisherigen Möglichkeiten des Bauens mit Stahl. Der Text stützt sich grösstenteils auf einen ausführlichen Artikel von Alois Diethelm, der im Handbuch «Architektur konstruieren» von Andrea Deplazes im Birkhäuser Verlag erschienen ist. Der zweite Teil widmet sich den Grundlagen des konstruktiven Entwerfens mit Stahl, d. h. der Tragstruktur, den Elementen und deren Anschlüssen sowie dem Aspekt des Brandschutzes. Dieser Teil gibt einen Überblick über die Konstruktionsprinzipien des Stahlbaus und zeigt die gängigsten Konstruktionsdetails. Ausführliche Literatur hierzu ist im Anhang aufgeführt. Grundlage für dieses Kapitel bilden diverse Quellen, unter anderen die bestehenden Publikationen des SZS und insbesondere das Buch «Conception des charpentes métalliques» von Manfred Hirt und Michel Crisinel (EPFL), aus dem viele der Plandarstellungen stammen. In einem dritten Teil werden Architekturbeispiele aus der Praxis dokumentiert, die jeweils einen besonderen konstruktiven Aspekt des Stahlbaus verdeutlichen. Diese Texte stammen wiederum grösstenteils von Alois Diethelm aus dem oben erwähnten Handbuch und wurden mit aktuellem Bildmaterial ergänzt.
Diese Ausgabe ist eine Planungshilfe für das Bauen mit Stahl. Sie soll die Konstruktionsprinzipien des Stahlbaus aufzeigen und dazu anregen, mit diesen Prinzipien neue Wege in der Architektur zu beschreiten. Denn «jedes Material ist nur soviel wert, wie was man aus ihm macht» – sagte schon Mies van der Rohe. Wir wünschen viel Vergnügen und Einsichten beim Studium der folgenden Seiten. Evelyn C. Frisch