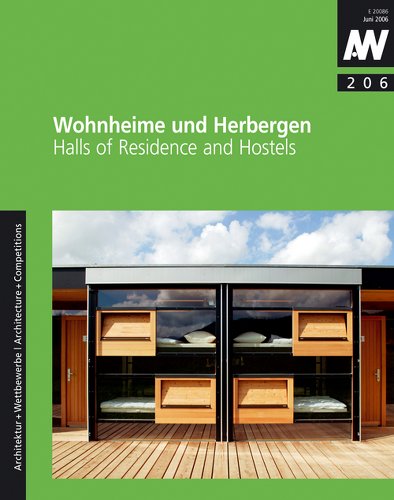Editorial
Zugegeben: Während meiner gesamten Studienzeit habe ich nie in einem Studentenwohnheim gewohnt. Vielleicht sollte ich besser sagen: Ich musste nie dort wohnen, denn die häufig in die Jahre gekommenen Wohnheime, in denen einige meiner Kommilitonen anfangs untergebracht waren, machten auf mich einen alles andere als erstrebenswerten Eindruck. Nicht etwa, weil ich als frisch gebackener Architekturstudent bereits besonders hohe Ansprüche an die Gestaltung der Heimstätten gehabt hätte. Der permanente Platzmangel, der geringe Individualraum, die aufgezwungene Gemeinschaft mit unzugänglichen Mitbewohnern oder die Tatsache, dass fast jede Nacht irgendwo eine private Zimmerparty den nicht daran Beteiligten den Schlaf raubte, waren auch für sporadische Besucher wie mich unverkennbar. De facto hielt es niemand von meinen Bekannten länger als ein, zwei Semester in einem Wohnheim aus – wer konnte wechselte sobald wie möglich in eine WG oder bezog eine eigene Studentenbude. Dass sich die Situation in den vergangenen Jahren sogar noch verschlechtert hat, offenbart eine aktuelle statistische Erhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW). Unter anderem wurde dabei festgestellt, dass die Zahl der Studenten, die das Wohnheim als Wohnform bevorzugen mittlerweile von 20 auf 11 Prozent gesunken ist und sich derzeit über die Hälfte der Heimbewohner für andere Wohnformen entscheiden würde. Lediglich die meist recht günstige Lage der Wohnheime zur Hochschule und die preisgünstigen Mieten vor allem in Ballungszentren wurden positiv bewertet. Tatsache ist, dass die aktuelle Wohnraumnachfrage der Studierenden nicht mehr mit dem angebotenen Wohnraum übereinstimmt. Die örtlichen Studentenwerke und andere Träger haben diese negative Entwicklung erkannt und versuchen ihr zunehmend mit Umbauten und Sanierungen der bestehenden Wohnheime entgegenzuwirken. Da die Hörerzahl in den nächsten Jahren wieder ansteigen wird – Prognosen gehen von einer Zunahme von derzeit zwei auf 2,5 bis 2,7 Millionen Studenten aus – muss an vielen Hochschulstandorten zusätzliche Wohnfläche geschaffen werden. Das DSW schätzt diesen akuten Bedarf auf insgesamt rund 21.000 Wohnplätze – reichlich Arbeit also für Architekten. Von ihnen sind dabei nicht nur zeitgemäße sondern vor allem auch kostengünstige Konzepte gefragt, da es um die finanziellen Kapazitäten der Bauherren nicht besonders gut gestellt ist.
Nicht viel anders sieht es bei den Jugendherbergen aus. Auch hier haben sich in den letzten Jahren – vor allem aufgrund der wachsenden Konkurrenz von Billighotelketten – die Ansprüche der Gäste und damit auch die Anforderungen an die Häuser verändert. Die Zeiten von großen Schlafsälen, Gruppenwaschräumen, Bettruhe um 22 Uhr und einem Pott Muckefuck am Morgen sind längst vorbei. Die Besucher erwarten heute gut ausgestattete Zimmer mit Dusche und WC, ein Zugangssystem mittels Chipkarte, eine Cafeteria mit Snack-Angebot, Fitnesseinrichtungen, Tagungs- und Seminarräume und vieles mehr. In Deutschland sind fast 600 Häuser im Deutschen Jugendherbergswerk organisiert, die nach und nach durch Renovierungen, Erweiterungen oder Neubauten auf einen einheitlichen Qualitätsstandard gebracht werden sollen. Wo dieser Standard aus Architektensicht liegen könnte, zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe der »AW«. Arne Barth
Inhalt
Zum Thema
Hier wohne ich | Arno Lederer
Beispiele I
Studentenwohnanlage in Hof | Bez + Kock Architekten BDA
Studentenwohnanlage in Zürich | Marc Langenegger
Studentenwohnanlage in München | bogevischs buero, Hofmann Ritzer Architekten
Studentenwohnheim in Garching | Fink + Jocher
Studentenwohnheim in Paris | Atelier Seraji
Studentenwohnheim in Amsterdam | Claus en Kaan Architecten
Schülerwohnheim in Schwäbisch Gmünd | Lederer + Ragnarsdóttir + Oei
»Micro-compact home« und »O2 village« in München | Lydia Haack + John Höpfner Architekten und Horden, Cherry, Lee Architects
Bausystem »Study Case« | Lutz + Roos Architekten
Projekt
Wohnheim für Musikstudenten in Kopenhagen | Dorte Mandrup Arkitekter
Beispiele II
Jugendherberge in Bremen | Raumzeit
Jugendherberge in Possenhofen | Hierl Architekten
Jugendcamp in Passail | Holzbox ZT GmbH
Berghütte »Cristallina« in Bedretto | Baserga & Mozzetti
Jugendherberge in Zermatt | Bauart Architekten
Wohnheim für Geistig Behinderte in Hokkaido | Sou Fujimoto Architects
Wettbewerbe
Mädcheninternat in Bad Gleichenberg
Studentenwohnheime in Frankfurt am Main
Studentenwohnheime in Münster
Hier wohne ich
Früher, als der Postweg die Menschen über weite Entfernungen verband, kamen in und nach den Schulferien bunte Karten zu Hause an. Es waren nicht wenige darunter, auf denen Hotels und Pensionen in Traumlandschaften abgebildet waren. Auf deren Fassaden hatte der Absender nicht selten ein Kreuz gekritzelt: »Hier wohne ich« stand am Rande der Karte, und schon hatte man ein Bild davon, wie der Freund oder die Verwandten auf dem kartierten Balkon oder hinter der Fensterbrüstung Besitz von dem überlassenen Raum genommen hatten. Von Freunden oder Anverwandten, die sich in anderen Formen des Wohnens auf Zeit aufhielten, bekam man solche Bildergrüße nicht. Bestenfalls eine Jugendherberge warb da für sich, das Kreuz des Kugelschreibers aber fehlte. Herbergen und Heime eigneten sich nicht dazu, als Postkartengruß versandt zu werden. Natürlich lag das nicht nur an der Architektur, sondern mehr an der Einrichtung als solcher.
Das Heim oder die Herberge ist eigentlich die einfachste Form von Hotel, das für einen längeren Aufenthalt gedacht ist. Es sollte nicht nur dem einfachen Übernachten dienen: Es trägt bereits die Kategorie des Wohnens in sich. Deshalb müsste es viel mehr noch als das Hotel die Idee des Wohnens transportieren. Diese Art des bescheidenen Wohnens zielt auf Menschen, die (noch) nicht oder nicht mehr über viel Geld verfügen. Nicht umsonst fallen einem beim Wort »Heim« nicht gerade schöne Dinge ein: »Heim« riecht nach dünnem Tee, weichem Brot und heller Wurst. Vor der Architektur, die – handelte es sich um Altbauten – nicht einmal so schlecht sein musste, kam die Heimleitung, meistens in Form von Personen, die deutsche Tugenden verkörperten: Ordentlichkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit. Kein Wunder, dass Architektur in solchen Fällen eine nachrangige Stellung innehatte.
Ein Heim hat meistens einen Träger. Und im Regelfall sind diese Träger – wie Kirche, Vereine oder Studentenwerke – Bauherren, die knapp bei Kasse sind. Sie kalkulieren mit einem Gemisch aus Zuschüssen, Mieten und Beiträgen. Deshalb achten sie nicht nur hinsichtlich der Errichtung auf Kosten, sondern sie schauen mit Argusaugen auf den Unterhalt, der zum einen das Gebäude, zum anderen die Kosten für das Personal betrifft. Dem Architekt wird schon bei den ersten Strichen, die er aufs Papier bringt, das Gebot der Sparsamkeit und der Robustheit mit auf den Weg gegeben. Denn nicht immer ist die Klientel so sorgsam und vorsichtig, wie das etwa Hotelgäste sind.
Wo man nicht zur Unterbringung der Bewohner auf alte Häuser zurückgreifen konnte, galt bei Neubauten, insbesondere jenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, die Prämisse der absoluten Sparsamkeit, was in Deutschland mit dem Gebot nach Fantasielosigkeit gleichgesetzt wurde. Man hatte das Gefühl, die Sparsamkeit beginne bereits in den Büros, in denen auf einen möglichst geringen Verbrauch von TK-Mienen geachtet wurde. Außen Reibeputz und asymmetrisch geteilte Fenster, bestehend aus Lüftungs- und Putzflügel. Innen Marmoleumböden, denen man nicht ansehen sollte, dass eventuelle Staubwolken wie Kumuli die ungekehrten Bereiche zudeckten. Auf den braunbeige lackierten Stahlgestellen der Betten lagen graue Decken, deren einzige Zierde eine beschriebene Borde war. »Fussende« war da zu lesen, was ausländische Gäste zu einer ergebnislosen Suche durch ihr Dictionnaire führte.
Von dieser Art Heimen und Herbergen unterschieden sich Studentenheime, wenigstens teilweise. Offensichtlich hatte man hier eine Klientel vor Augen, der man einen lockeren Umgang mit den überlassenen Räumlichkeiten zutraute. Ja, in manchen Fällen findet man in den frühen Jahren der Republik ganz erstaunliche Qualitäten, die man auch als progressive Wohnformen betrachten könnte. Eines der wenigen Beispiele, die dazu in den Sinn kommen, ist das Studentenwohnheim des Ateliers 5 auf dem Stuttgarter Campus im Pfaffenwald. Inzwischen hat es von seinem ursprünglichen Charme leider erheblich eingebüßt, die Anpassung an die Energieeinsparungswut hat den Häusern zweifelsohne nicht gut getan.
Den Unterschied zwischen dieser Anlage und solchen, die eher für Kinder des schwäbischen Mittelstandes gebaut scheinen, ist immens. Die einzelnen, gut proportionierten Baukuben sind in einer Dichte zusammengefügt, die an die Enge von Tessiner Bergdörfern erinnert. Die Auflösung führte zu Zwischenräumen und Wegen, die in herkömmlichen Beispielen nicht zu finden sind. Die Häuser funktionieren wie Mosaiksteine, die ein gemeinsames Ganzes bilden. Ganz erheblich unterstützte die Materialwahl, Sichtbeton und Glattstriche, unifarbene Böden und funktionelle Fernsterteilung das intellektuelle Konzept und die Verwandtschaft zu »Halen« oder »Thalmatt« war nicht zu übersehen.
Nicht nur Studentenheime, auch solche, in denen Auszubildende eine Übergangszeit zubringen, und solche, die Gästen aus anderen Ländern dienen, hinterlassen prägende Eindrücke. Diese Gebäude erzählen etwas über die Kultur unseres Landes. Man kann an ihnen ablesen, wie wir mit Gästen umgehen, die über einen schmalen Geldbeutel verfügen und wie unsere Wohnvorstellungen sich darstellen. Solche Häuser, die der jungen Generation dienen, tragen auf jeden Fall zur Geschmacksbildung bei – mehr als Schulhäuser, Verwaltungsbauten und Universitäten. Denn in Heimen wird gewohnt, was gleichzeitig bedeutet, dass sie dem privaten Aufenthalt dienen. Und nur im privaten Raum, der umfassend dem Wohnen, Arbeiten, Schlafen dient, also dem gesamten Tages- und Nachtablauf, entfällt die Distanz zu den Dingen, die einen in anderen Gebäuden umgeben: Die Aneignung von geschmacklichen Zu- und Abneigungen findet im Wohnumfeld sehr viel stärker statt.
Aus diesem Grunde sind Heime und Herbergen durchaus als wichtige Botschafter der örtlichen Kultur zu verstehen. Hinterlässt die dort angetroffene Architektur einen positiven und bildenden Eindruck, wird man sich nicht nur gerne daran später erinnern, sondern wird auch gerne bei eigenen Anschaffungen, sofern man zu Geld gekommen ist, auf diese Erfahrung zurückgreifen. So gesehen sind solche Herbergen Bildungseinrichtungen, die einen »Return of Money«-Effekt bewirken können. Da unsere Gesellschaft weniger architektonischen, sondern mehr ökonomischen Argumenten folgt, muss man diesen Gesichtspunkt immer wieder betonen.
Dieses Argument zieht natürlich nicht bei Häusern, die anderen Gruppen zur Unterbringung dienen. Zu Heimen oder Herbergen gehören ja auch Einrichtungen, die man nicht der Ausbildung oder Reise wegen besucht, sondern die am anderen Ende des Lebensbogens stehen. Hier besteht einfach eine menschliche Verpflichtung, unabhängig vom ökonomischen Zwang, zu anspruchvollen Raumqualitäten, die auf die spezifische Situation abgestimmt sind. Das bedeutet ruhige und dennoch allmählich wechselnde Lichtsituation, die den Tag in seinem Ablauf miterleben lässt. Materialien, die landläufig als natürlich bezeichnet werden, und deren Musterung zum Beispiel einen Wachstumsprozess erkennen lässt. Details, die von Hand gemacht sind und denen eine tradierte Ausführungspraxis zugrunde liegt. Eine schöne Beziehung nach draußen, sowohl in dem Bereich vor dem Gebäude als auch in der Flur- oder Aufenthaltszone des Hausinneren.
Es ist erstaunlich, wie sicher Bauherren, besser gesagt deren Vertreter (meistens trifft man auf eine Armada selbsternannter Bauherrenvertreter), über die Geschmacksanforderungen ihrer Klientel Bescheid wissen. Man glaubt, die Vorlieben der Kunden nicht nur zu kennen, sondern auch die gestalterischen Kniffe zu wissen, wie auf den Markt zu reagieren ist. Dass es sich damit um eine Spekulation handelt, die auf der Grundlage der eigenen ästhetischen Vorstellungen beruht, wird meistens verkannt.
Wohnen auf Zeit ist dem Wohnen in fremden Möbeln gleichzusetzen. In Heimen oder Herbergen gibt es keine (und wenn schon, dann nur verschwindend kleine) Flächen, die die Unterbringung eigener Gegenstände ermöglichen. Man lebt nicht in einem Ambiente, das man selbst ausgewählt hat und das deshalb durch die eigene Geschichte mit einem selbst verbunden ist. Insofern ist auch die Wahl der Möbel und der weiteren Ausstattung keine, die dem persönlichen Geschmack von Bauherr oder Pächter entspricht, sondern die der architektonischen Botschaft des Hauses entsprechen sollte. Neben den einzelnen Zimmern betrifft das vor allem die Ausstattung von Speise- und Aufenthaltsräumen. Wenn dort Leuchten und Stühle, Tische und Theken einen roten Faden vom Detail zum Ganzen erkennen lassen, wird die Akzeptanz sehr viel höher sein als bei Angeboten, die in allen Bereichen die geschmackliche Uneinigkeit von Bauherr, Pächter und Architekt aufzeigen. Erst dann, wenn hinsichtlich der Durchgängigkeit alles im Lot ist, kann der Bewohner getrost eine Postkarte seiner Herberge in die Hand nehmen und wie früher mit einem Kreuz sein Fenster markieren – und auf die Rückseite mit Stolz schreiben: »Hier wohne ich«.Architektur + Wettbewerbe, Fr., 2006.07.07
07. Juli 2006 Arno Lederer