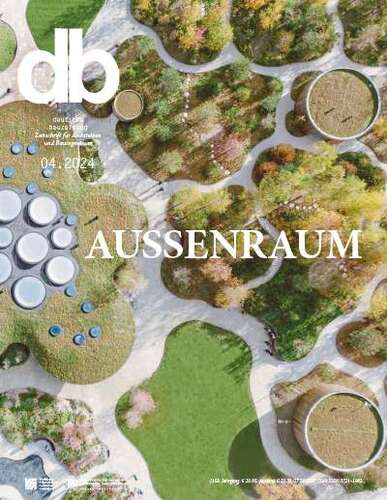Editorial
Resiliente Stadtplanung ist darauf ausgerichtet, urbane Systeme widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Herausforderungen zu gestalten. Müssen sich Städte künftig schneller an neue Bedingungen anpassen, kann Künstliche Intelligenz ein Schlüssel hierfür sein, um in kurzer Zeit und mit knappen Ressourcen auf extreme Ereignisse reagieren zu können. Der ETH Zürich Lehrstuhl Gramazio Kohler Research, zusammen mit Müller Illien Landschaftsarchitekten und Timbatec AG entwickelten mit Industrie- und Forschungspartner eine 22,5 m hohe, bepflanzte architektonische Skulptur namens »Semiramis«, die im Frühjahr 2022 auf dem Areal des Tech Clusters Zug (CH) errichtet wurde. Vier Roboterarme bauten die Struktur aus Holzplatten, basierend auf einem Entwurf, der durch einen maßgeschneiderten Machine-Learning-Algorithmus generiert wurde. Da auf dem Gelände nur an wenigen Orten Bäume gepflanzt werden können, entstand diese Idee der Bepflanzung. Die Skulptur soll als Bild des kreativen und intelligenten Umgangs mit Natur und Technologie im Quartier dienen.