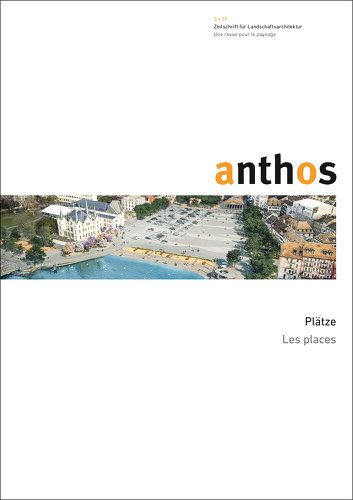Editorial
Für einmal ist es tatsächlich so, dass früher alles einfacher war: als der öffentliche Raum noch als solcher ablesbar, und – was nicht nur logisch klingt, sondern auch in der räumlichen Anordnung sinnhaft ist – vom privaten Raum durch den halböffentlichen getrennt war. Heute ist es schwieriger. Zwar nehmen wir an, dass Plätze öffentliche Räume sind und damit im Besitz der Allgemeinheit – also von uns allen! –, kommissarisch vertreten durch die öffentliche Hand, die sich aus vielerlei Steuergeldern aus verschiedenen Quellen trägt. Und hier fängt das Problem an. Immer mehr vermeintlich öffentlicher Raum wird privatisiert.
Umgebungsgestaltungen von Überbauungen ebenso wie «Privatstrassen» oder Plätze rund um grössere Dienstleistungsnutzungen oder Grossgewerbe: Der Novartis Campus ist ein solcher Raum, ebenso wie das Maag-Areal entlang des Gleisbogens in Zürich. Während es sich beim Campus um eine Art Spezialraum handelt, den man einigermassen bewusst als Gast betritt, ist die Umgebungsgestaltung des Maag-Areals im Rahmen der Arealentwicklung entstanden: Die Stadt hat Gestaltung, Erstellung, Unterhalt und Pflege mittels Sonderbauvorschriften Privaten übertragen (auf der Gegenseite der Waagschale bekommen diese dafür mehr Ausnützung).
Wenn dereinst alle von ihren Hausrechten Gebrauch machen und «ihren» Raum reglementieren, wird der Stadtraum zu einem unübersichtlichen Patchwork aus Regeln, Geboten und Verboten. Dann ist nicht nur der Raum nicht mehr lesbar, weil die Eigentumsverhältnisse nicht sichtbar sind, dann ist auch nicht mehr transparent, wer an welchem Ort was darf und wer was nicht. In der Tendenz schliessen diese Mechanismen die Schwächsten unserer Gesellschaft aus, weil alle anderen «nichts zu verstecken» haben und es ihnen keine Mühe macht, ständig gefilmt und auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden. Es klingt absurd, aber es ist ein Privileg, Kameraüberwachung nicht zu fürchten. Nicht immer können wir frei wählen, ob wir in den Augen des Staates etwas zu verbergen haben oder nicht, ob wir an einem Ort erwünscht sind oder nicht. Es ist hier wie überall: Wenn wir uns gemeinsam auch für die Schwächeren einsetzen, kommt das uns allen zugute. Wir leben in einer Solidargemeinschaft, und die Grenzen zwischen Nehmen und Geben sind mitunter fliessend. Oder können sich umkehren. Kurz: Wir tun gut daran, keine zusätzlichen Grenzen zu schaffen. Auch im öffentlichen Raum nicht.
Ach ja, die Plätze: Sie müssen heute (wie auch früher) einer Vielzahl Anforderungen gerecht werden an Nutzung, Gestaltung und das Klima, nachhaltig erstellt, resilient und günstig im Unterhalt sein. Das Gute daran: Das haben LandschaftsarchitektInnen alles bestens im Griff – für die Fragen der Zugänglichkeit und Hoheit über den öffentlichen Raum aber sind wir als Gesellschaft gefordert.
Sabine Wolf
Inhalt
Marie Bruun Yde, Steffan Robel: Stadt ohne Autos
Toni Weber, David Gadola: Postplatz Solothurn
Patricia Lussier: Hommage an die Frauen von Montréal
Silvie Theus: Partizipation von Kindern und Jugendlichen
Mariann Künzi, Annina Baumann: Visionen für das Zürcher Kasernenareal
Hannes Lindenmeyer: Leben auf den Plätzen
Till Rehwaldt: Das Grüne Herz von Siegen
Lieblingsplätze
Yves Bonard, Julie Dubey, Marco Ribeiro: Plätze gemeinsam gestalten
Sophie Boichat-Lora: Ein Baumschulplatz in Lille
Cristina Woods: Eine Geschichte von Luft und Liebe
Jakub Szczęsny: Gustaw Zieliński Square
Pascal Posset: Oben Himmel – unten Stadt
Gustaw Zieliński Square
Astana gilt als das Dubai des Landes mit Indoor-Strandresorts, Zelten nachempfundenen weitläufigen Einkaufszentren, goldenen Kuppeln und viel Glas. Nahezu alle grossen Bauwerke der Stadt wurden erst ab 1998 erbaut, dem Jahr, als Astana die Hauptstadt Kasachstans wurde. Während die Superlative Touristen anziehen, ist abseits ein kleines Platzprojekt entstanden, das auf die Bedürfnisse der hier lebenden Menschen reagiert.
Astana, ein zwanzig Jahre lang geträumtes Projekt einer Metropole, die mitten in der Steppe gebaut wurde, tritt in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein. Nach Jahren des Baus öffentlicher ikonischer Objekte, die sowohl von lokalen Büros als auch von internationalen Star-Architekten entworfen wurden, um internationale Sichtbarkeit zu erzeugen und ein Hauptstadtgefühl zu initiieren, beginnt die Stadt nun, öffentliche Investitionen zu überdenken. Neue Infrastrukturen entstehen – von Bushaltestellen und Fahrradverleihsystemen über Fussgängerbrücken bis hin zu öffentlichen Räumen. Als Ergebnis einer Reihe von Gesprächen über die Zukunft der Gesellschaft Astanas mit Askhat Saduov, einem jungen, aber einflussreichen Teil des Planungsbüros von Genplan-Stadt, wurden wir gebeten, einen neuartigen öffentlichen Raum vorzuschlagen.
Wir wählten einen Ort, an dem die Repräsentation der neuen Kasacher Mittelschicht nicht das Thema war, weil der lokale soziale Kontext hier ein anderer war. In der Altstadt, die sich Celinograd nennt, am Rande des Universitätscampus und einer Arbeitersiedlung aus «Khrushtchovkas»1, haben wir einen interessanten dreieckigen Überrest im Schnittpunkt von zwei sich überlagernden städtischen Rastern gefunden. Das Grundstück blieb leer und ungenutzt, obwohl es sich an der Kreuzung zweier wichtiger Strassen befindet, bedeutend ist insbesondere die «Kenesary», die zur Brücke zwischen Celinograd und dem neuen Astana führt. Die Platzierung der Installation an diesem Ort steht in tiefem Kontrast zur von Repräsentation besessenen Neustadt. Umgeben von vorgefertigten Mehrfamilienhäusern aus den 1960er-Jahren, Wettstuben aus den 1990er-Jahren und leeren Grundstücken für die zukünftige Entwicklung ist das Projekt wie ein symbolischer Unterbau des Traumprojekts von Präsident Nasarbajew und des Architekten Kisho Kurokawa; dieser Ort wird von den Menschen bewohnt, die die Traumstadt tatsächlich mit ihren eigenen Händen erbauen.
Beobachtung als Entwurfsgrundlage
Zusammen mit Askhat haben wir beschlossen, dass wir einen Raum schaffen würden, den die Menschen interpretieren können; an dem sie gerade nicht die vorprogrammierten, stereotypen Apparate von repräsentationsgebundenen Parks finden. Ein begrenztes Budget und die Teppichklopfstange vor unserem Büro, das inmitten genossenschaftlicher Wohnsiedlungen in Warschau liegt, brachten uns auf die Idee eines Rahmens, an dem die Menschen ihre temporären Sitz- und Liegemöglichkeiten befestigen können: Hängematten, Schaukeln, Seile, Bretter aus Holz, et cetera. Der Standort erforderte eine grosse Höhe, sodass die Installation nicht nur die BewohnerInnen der umliegenden Gebäude, sondern auch jene des gesamten Stadtteils anziehen würde. Die gewählten Farben stammten von der zweifarbigen kasachischen Flagge, einem Set aus Blau und Gelb, das jeder dort als vertraut empfinden würde. Die Farbwahl war auch durch unsere Fragezeichen motiviert: Würde die Bevölkerung unsere Installation mögen und wissen wollen, wie man die Anlage nutzt, wie man sie nicht beschädigt, wie man sie sich aneignet?
Parallel zur Planung der Installation in einem dreieckigen Teil des Grundstücks wurden wir beauftragt, den gesamten Raum zu entwickeln und dabei erneut ein sehr begrenztes Budget zu berücksichtigen.
Unsere Beobachtung war, dass die Menschen unter den rauen Bedingungen des kontinentalen Klimas der Steppe in heissen Sommern schattige Plätze wählen, um sich zu entspannen, unter Bäumen zu sitzen und Schach zu spielen, eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in Kasachstan. Wir beschlossen, dieses Gefühl der Nutzung informeller Räume nachzuahmen, indem wir lokale Bäume pflanzen und einfache Bänke hinzufügen. Das Budget sah schwarzen Asphalt vor, der zu einem perfekten Hintergrund für Kreidezeichnungen und Klassenspiele für Kinder wurde.
Der Tag der geplanten Eröffnung mithilfe von Aktivisten des in Almaty ansässigen Festivals ArtbatFest bewies, dass die Menschen diese Art von Raum brauchten und dass unser Ansatz sinnvoll war – alle Altersgruppen fanden dort ihren Raum für Aktivität.anthos, Mo., 2019.06.03
03. Juni 2019 Jakub Szczęsny