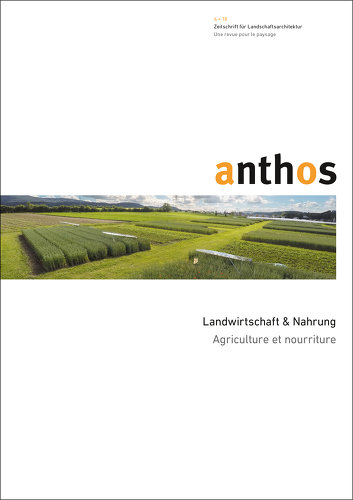Editorial
Immer mehr unserer Gebäude sind nach den Standards der 2000-Watt-Gesellschaft errichtet. Das heisst, sie sind in den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch und sozial) optimiert und bieten alles, was es braucht, um mit den geforderten 2000 Watt pro Person und Jahr zu leben. Die detaillierten Rechnungen sind im Internet zu finden, zentral ist: 2011 hatten wir einen globalen – die Verbräuche unterscheiden sich in den Weltregionen erheblich! – durchschnittlichen Energiebedarf von rund 2500 Watt; in der Schweiz liegt der Wert aktuell bei 5000 Watt.
Wenn Gebäude und ganze Areale 2000-Watt-kompatibel sind, bedeutet das auch, dass sie die Verantwortung dafür, ob wir die Zielwerte erreichen, an uns zurückgeben: Entscheidend ist dann unser Konsumverhalten. Neben unserer Mobilität – ob bei der Empfehlung zu Elektrofahrzeugen die graue Energie im Gesamtlebenszyklus betrachtet wird, ist nicht immer ganz klar – ist vor allem unsere Ernährung massgeblich.
Einige der hier grundlegenden Entscheide kann jede/r Einzelne jederzeit treffen, zum Beispiel, ob wir weiterhin Fleisch essen. Ein Kilo Schweinefleisch verursacht gleich viel CO2 wie 80 Kilo Kartoffeln; für die Produktion eines Kilos Rindfleisch wird 15,4 Kilo CO2 emittiert, bei Linsen 0,7. Werden hier Äpfel mit Birnen verglichen, um plakative Zahlen zu haben? Nein, gerechnet wird mit CO2-Äquivalenten; der Wert von verschiedenen Treibhausgasen wird auf CO2 umgerechnet, und hierin stecken auch die Werte der investierten Primärenergie.
Bei einer ganzen Reihe weiterer zentraler Fragen aber sind die Antworten und Entscheidungen nicht so einfach. Wie viel Einfluss haben wir tatsächlich darauf, was auf unseren Tellern landet? Wie viel wissen wir darüber, wo es produziert wurde und zu welchen Bedingungen? Wie können wir eine ernährungssegregierte Gesellschaft verhindern, in der sich nur Wohlsituierte «gute» Nahrungsmittel kaufen können?
Einigen der aufgeworfenen Fragen sind wir in der Ausgabe nachgegangen. Es geht um den Zustand unserer Böden, neue – oder besser gesagt wiederentdeckte – Anbaukonzepte, solidarische Landwirtschaft, systemische Fragen zur Zukunft von Landwirtschaft, Gesellschaft und Marktwirtschaft, internationale Beispiele und die Rolle der Landschaftsarchitektur in Agrar- und Kulturlandschaften.
Um es kurz zu machen: Es gibt viel zu tun, und wir können es erneut nur gemeinsam angehen. Für den Beginn wunderbar wäre, wenn sich jede/r bis Ende des Jahres Gedanken über den persönlichen Ressourcenverbrauch machen würde. Wie viel Fläche konsumiere ich für Wohnen und Arbeiten, wie sieht meine Mobilität aus, wie meine Ernährung?
Inhalt
Köbi Gantenbein: Wein macht Landschaft und Architektur
Émilie Gruit: Eine resiliente Agrarlandschaft formen
Clémence Bardaine, Roland Vidal: Der Geschmack von Agrarlandschaften
Interdepartementale Arbeitsgruppe Fruchtfolgeflächen: Fruchtfolgeflächen nachhaltig sichern
Tina Siegenthaler: Solidarische Landwirtschaft Solawi
Augustin Tempier: Terre de Mars, Marseille
Tex Tschurtschentaler: Gemeinsam produzieren und konsumieren
Renate von Davier: Les Jardins de Cocagne, Genf
Mathilde Rue: Agroforstwirtschaftliche Projekte im Entstehen
Sarah Symanczik, Martina Lori: Boden als Grundlage unserer Ernährung
Dania Genini: Grosse Vielfalt auf kleiner Fläche Christian de Carné Carnavalet, Joris Masafont, Jean-Pierre Clarac: Agrovoltaik als stadtplanerisches Instrument zur Rückgewinnung von Agrarlandschaften Marco Kaufmann, André Stapfer, Ulysses Witzig: Mehrwert in der Mülimatt
Roman Häne: Wir sind parat!
Moana Werschler: Vision zur Stärkung der Seeländer Gemüseproduktion
Mareike Jäger: Bäume erobern den Acker zurück
Sabine Wolf: Kontrovers diskutiert: «Smart Farming»
Agrovoltaik als stadtplanerisches Instrument zur Rückgewinnung von Agrarlandschaften
Das französische Gesetz vom 17. August 2015 über den Energiewendeprozess für grünes Wachstum zwingt die Gemeinden, mehr für die Energieeffizienz in ihren Gebieten zu tun. Das Departement Alpes Maritimes plant die Errichtung grosser, dezentraler Photovoltaikanlagen.
Im Mai 2016 gab die Interessengemeinschaft des regionalen Naturparks Préalpes d’Azur PNRPA Empfehlungen für die Entwicklung von Photovoltaikprojekten in ihrem Perimeter ab. Entsprechende Anlagen sollen mit dem lokalen Umspannwerk Valderoure verbunden werden; im Rahmen eines Workshops konnten geeignete Grundstücke bestimmt werden. Der Workshop mit dem Namen «OFF» stand unter Aufsicht des Wissenschaftsrats des Naturparks und bestand aus einer Gruppe angehender Landschaftsarchitekt_ innen der Hochschule für Landschafts architektur ENSP Versailles-Marseille.
Die Stromversorgung des Departements Alpes Maritimes ist heute zu 90 Prozent vom Hochspannungsübertragungsnetz aus Avignon abhängig. Der Küstenstreifen verfügt über hunderte Hektaren Dachflächen, die solar genutzt werden könnten, doch ist die Installation entsprechender Anlagen nach wie vor die Ausnahme. Ausserdem wirtschaftet das Departement mit einer Million Einwohner:innen und zwölf Millionen Besucher:innen im Bereich der Agrarproduktion defizitär.
Das Hinterland könnte seinen politischen und gesellschaftlichen Einfluss mit dem Hebel der erneuerbaren Energie wieder ins Gleichgewicht bringen – jedoch nicht auf Kosten seiner Landschaften. Die bisherigen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (AEE) sind Stückwerk, und das Gebiet wird nach und nach regelrecht «zersiedelt», da ein Gesamtkonzept völlig fehlt.
Landwirtschaft und Agro-Photovoltaikanlagen
Aufgrund dieser Feststellungen kommt der Workshop OFF in seinem Schlussbericht zum Ergebnis, dass Landwirtschaft und Stromerzeugung unter Ausnutzung des strategischen Standorts des Umspannwerks verbunden werden müssen. Die Errichtung von Photovoltaik-Gewächshauskomplexen auf einer Fläche von mehreren Dutzend Hektaren ist eine neue Idee, die für Volksvertreter:innen und Bevölkerung insbesondere die folgende Frage aufwirft: Welche Auswirkungen können diese Agro-Photovoltaikanlagen auf unsere einzigartigen Felslandschaften haben?
In Absprache mit dem Wissenschaftsrat, Volksvertreter:innen und Einwohner:innen der Region haben wir eine Landschaftstypologie mit potenziellen Standorten künftiger AEE-Anlagen erstellt. Unsere Überlegungen bezogen sich insbesondere auf Photovoltaik-Gewächshausmodule und die Gestaltung des biointensiven Gemüseanbaus – die echten Innovationen des geplanten Photovoltaikkonzepts. Wir sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Agrovoltaik, die für die Industriebetriebe wenig rentabel ist, eine Voraussetzung für die Genehmigung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sein muss. Durch die Verbindung von biointensivem Gemüsebau mit einer intelligenten Gestaltung der Solaranlagen auf dem Gebiet des PNRPA werden die historischen Beziehungen zwischen dem Mittelgebirge und dem Küstengebiet wieder mit Inhalt gefüllt. Diese Arbeit ist in der Kurzdarstellung «Énergies renouvelables: quels paysages en transition dans les Préalpes d’Azur» zusammengefasst, die den Auftakt zu einer Machbarkeitsstudie bildet[1].
Zusätzliche Einnahmen
Bei der geplanten Agrovoltaik erfolgen Gemüseanbau und Energieerzeugung zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Durch die Errichtung von AEE-Anlagen mit Freiflächen-Modulen und Photovoltaik-Gewächshäusern wird das wirtschaftliche und soziale Gleichgewicht der Küsten- und Bergregionen wiederhergestellt, denen das Departement Alpes Maritimes seinen Namen verdankt. Die Agrovoltaik wird zur wohlverdienten Wiederauferstehung der verarmten und seit einem halben Jahrhundert so gut wie aufgegebenen Gebiete beitragen. Die lokale Bevölkerung wünscht sich diesen Aufschwung: Ein aktiveres soziales Leben, mehr Beschäftigungschancen, höhere Einkommen und eine Erneuerung der Generationen. Die Beschäftigungskapazitäten der künftigen Gemüsebauern und die indirekten Arbeitsplätze werden die erwarteten zusätzlichen Einnahmen bringen.
Die Landwirtschaft ist nach wie vor in lokalen Genen verwurzelt, wobei die Infrastrukturen der Vorfahren noch vorhanden sind: Quellen, Bewässerungskanäle, Trockensteinmauern und Wirtschaftswege sollen im Zuge der Umgestaltung zu Agrar- und Energielandschaften saniert werden. Die Region Haut Estéron wird durch die Agrovoltaik-Anlagen einen positiven Wandel sowohl seiner einzigartigen Landschaften als auch seiner sozialen Landschaft erfahren. Die Bewohner des PNRPA stehen heute vor einer politischen Entscheidung, die ein eindrucksvolles Beispiel für territoriale Solidarität innerhalb eines Departements sein wird.
Anmerkung:
[01] Die Broschüre des Parc naturel régional des Préalpes d’Azur steht als pdf zur Verfügung: / Ce guide du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est téléchargeable sur le lien suivant: https://bit.ly/2NkwQsf [3.10.2018].anthos, Fr., 2018.11.23
23. November 2018 Christian de Carné Carnavalet, Joris Masafont, Jean-Pierre Clarac