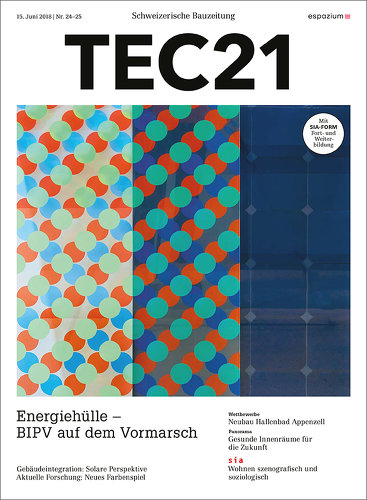Editorial
Die Sonne liefert Energie frei Haus! Auch wenn diese Erkenntnis nicht neu ist und obschon die Kosten für Photovoltaikmodule seit Jahren sinken, wird in der Schweiz immer noch deutlich weniger Solarenergie produziert, als technisch und wirtschaftlich machbar und für eine erfolgreiche Energiewende erforderlich wäre.
Wissenschaftler beschäftigen sich deshalb zurzeit intensiv mit der Frage, wie man möglichst viel Photovoltaik ins Gebäude bringen kann – integriert in die gesamte Gebäudehülle. Entscheidend ist dabei vor allem, die Potenziale bei den unzähligen Bestandsbauten auszuschöpfen, die es in den kommenden Jahren energetisch zu ertüchtigen gilt und die für eine konsequente Umsetzung der Energieziele eine architektonische und baukulturelle Herausforderung darstellen.
Dieses Heft widmet sich zum einen den Möglichkeiten von gebäudeintegrierter Photovoltaik (BIPV) im Rahmen von Stadterneuerungsprozessen, zum anderen den technischen und ästhetischen Fragen, die es in diesem Bereich zu beantworten gilt. Architekten, Wissenschaftler und Hersteller versuchen gemeinsam, eine neue Ausdrucksform für BIPV zu entwickeln und ihr so zu breiter Akzeptanz zu verhelfen. TEC21 hat sich bereits in den Ausgaben 46–47 und 48/2017 mit der Thematik befasst.
Die heutigen technischen Möglichkeiten erlauben eine enorme individuelle Gestaltungsfreiheit für Photovoltaikelemente, deren ästhetische Vielgestalt wiederum eine fast beliebige Anwendungsvielfalt eröffnet – künftig sind sie wohl sogar als bedruckte Werbefläche am Gebäude einsetzbar. Wir befinden uns zwar erst am Anfang dieser neuen Entwicklungen, aber hier scheint einiges an Potenzial für die «Energiehülle» der Zukunft zu liegen.
Viola John