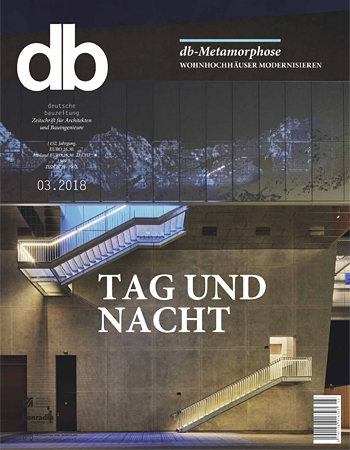Editorial
Licht in der Architektur – Licht in der Stadt. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigen Gebäude ihr zweites Gesicht. Zuweilen ein zufälliges, im besten Fall aber ein geplantes und durchkomponiertes.
Wie viel Licht benötigt gute Architektur und welchen gestalterischen Stellenwert nimmt Lichtplanung ein bzw. sollte sie einnehmen?
Oder eben, wie wenig Licht benötigt Architektur? Zuweilen gar keins, wie beispielsweise der Hyundai Pavillon des britischen Architekten Asif Khan auf dem Olympia-Areal in Pyeongchang. Das besondere Schwarz des Künstlers Anish Kapoor besteht aus einer extrem feinen, dreidimensionalen Nanostruktur, die 99 % des Lichts schluckt. Tag ist hier gleich Nacht. Ganz im Gegensatz zum virtuellen Himmel in der fensterlosen Messwarte einer Raffinerie, der die Nacht zum Tag macht, um die bunkerartigen Arbeitsplätze für die Mitarbeiter im Schichtdienst humaner zu gestalten. | Ulrike Kunkel
Stilvoll inszeniert
(SUBTITLE) Erzbischöfliches Berufskolleg in Köln-Sülz
Was für ein Auftritt! Ein mehrfach geknicktes Gebäude schließt die Ecke zwischen Berrenrather und Universitätsstraße im (weiteren) Kölner Universitätsviertel ab und gibt der Straßeneinmündung in diesem von starkem Auto-Verkehr geprägten Areal endlich eine überzeugende Fassung. Herzstück des Projekts ist das organisch geformte Atrium, das gleichermaßen Verkehrsfläche, Begegnungsstätte, Aula und Lichtraum ist. Doch auch alle übrigen Bereiche des Gebäudes zeichnen sich durch eine sorgsame, differenzierte und wohlüberlegte Lichtplanung aus. Leider noch keine Selbstverständlichkeit.
Über Jahrzehnte zog sich die städtebauliche Ordnung dieses Areals hin. Bereits in den späten 60er Jahren entstand das Ensemble des Katholischen Studentenheims, das sich um ein wahres architektonisches Kleinod, die betonbrutalistische, skulpturale Kirche Hl. Johannes XXIII von dem Bildhauer Josef Rikus herum gruppiert. Nun schließt das Berufskolleg an diesen Komplex an und gibt ganz nebenbei auch der Kirche eine platzräumliche Fassung.
Auch farblich scheint das Kolleg auf die Kirche in rohem Sichtbeton antworten zu wollen. Der polygonal geknickte, von keinem Standort aus im Ganzen zu erfassende Bau nach einem Entwurf von 3pass Architekt/innen Stadtplaner/innen Kusch Mayerle BDA zeigt eine glatte Fassadenfläche, schließen doch die großen Fenster bündig mit der Fassade aus dänischen Klinkern ab. Aus der Fernsicht zeigen sich die Ziegel im Sonderformat von nur 4 x 22,5 cm der dänischen Firma »Petersen Tegl« als hellgraue Fläche, aus der Nahsicht hingegen farblich ungemein differenziert, von Hellgrau über verschiedene Grün-Grau-Töne bis zu dunklem Anthrazit abgestuft und selbstverständlich nach dem Zufallsprinzip über die Fassadenfläche verteilt.
Ein drei doppelte Flügeltüren breiter Haupteingang in dem schräg gegen die Straße und ihre Baufluchtlinie gestellten Bauteil lädt großzügig ins Innere ein. Sofort ist man im Hellen: Ein weitläufiges, gebäudehohes Atrium, gefasst durch die umlaufenden Galerien der drei Stockwerke, wird überwölbt von einer filigranen Stahlkonstruktion, die kein festes Dach, sondern eine semitransparente EFTE-Kunststoffhülle trägt. In der Untersicht scheint das insgesamt dreilagige Kunststoffgewebe abwechselnd konvex und konkav geschwungen, und zwar in nebeneinander liegenden Bahnen jeweils gegensinnig. Die drei Geschossgalerien sind organisch geformt, sie folgen ganz unterschiedlichen Kurvenverläufen, überlagern sich oder ziehen sich zurück. Der amöbenhaften Form der Öffnung gen Himmel folgt die Dachkonstruktion aus gegeneinander jeweils leicht schräg gestellten, segmentbogenförmigen stählernen Dachträgern unterschiedlicher Spannweite.
Differenziertes Lichtkonzept
Auffällig ist die Helligkeit im Gebäudeinnern. Das Tageslicht, so reichlich es durch die Kunststoffhülle einfällt oder besser -fließt, würde nicht ausreichen, um bis in die übereinanderliegenden, das Atrium umrundenden Balustraden und Verkehrsflächen zu gelangen. Das Konzept der Lichtplaner von Licht Kunst Licht sieht daher umlaufende Lichtbänder vor, die unmittelbar an den Rand der mit Holzwolle-Leichtbauplatten bekleideten Decken gesetzt sind. Sie zeichnen den Verlauf, die Kurvigkeit der Balustraden nach, sie verhindern, dass der Raum an den Rändern in unklare Dämmerung absinkt. Zugleich werden die Verkehrswege gleichmäßig von oben ausgeleuchtet. Die Anordnung der Lichtleisten in der Höhe bringt es mit sich, dass sie über die Türen aller Lehr- und Funktionsräume hinweggezogen werden können. Lediglich die »offenen Lernräume« bilden Aussparungen – Freiflächen, die durch großflächige Befensterung geradewegs nach außen, auf die viel befahrenen Straßen und die heterogene Stadtlandschaft dieses Areals schauen. Diese Zwischenzonen zwischen Lernen und geselligem Beisammensein sind zudem durch Parkett in dunklem Holz ausgezeichnet.
Grundsätzlich ist das Holz im Hause aber hell: Kiefern-/Fichtenholzlaminat in sehr weißer Beizung. Es hebt sich kaum von den Betonwänden ab. Türrahmen, Brüstungen, Geländer, Handläufe sind in Holz gehalten. Nur die Sonderräume Cafeteria und Bibliothek haben von den Innenarchitekten Keggenhoff & Partner dunkles Holz bekommen, als Parkettboden sowie gefaltete Decken und Wandbekleidung. Dunkles Holz ist auch das Material der »Lichtplomben« – Aussparungen in den Betonbrüstungen, in denen sich Lichtleisten mit sechs nebeneinander angeordneten Downlights verbergen. Sie dienen der besonderen Ausleuchtung etwa des großen Atriums, über dem eine an der Bedachung befestigte Beleuchtung von vorneherein ausschied. Im Übrigen dient das Atrium nicht nur als Verkehrsfläche, sondern kann auch für Veranstaltungen genutzt werden. Die einläufig hinaufführende Treppe, die gegenüber dem Haupteingang beginnt und das Atrium gegen seinen schmaleren Fortgang in die Tiefe des Gebäudes hinein begrenzt, hat in ihrem unteren Teil, zwischen EG und 1. OG, neben den Treppenstufen auch solche mit doppeltem Höhenabstand zum darauf Sitzen. Über den schmaleren Teil des Atriums führen Brücken, je nach Stockwerk unterschiedlich angeordnet, sodass sich in diesem hinteren Teil reizvolle Verschränkungen von Bauteilen je nach Blickwinkel des Betrachters ergeben.
Die Materialität des Gebäudes ist hingegen sehr klar und übersichtlich. Die Fassaden werden von den Klinkern geprägt; im Innern dominiert Sichtbeton alle Wände. Er ist glatt, nicht schalungsrau wie bei der benachbarten Kirche, ohne jedoch seine »einfache« Herkunft und Herstellung zu leugnen. Dazu kommt das Holz in zwei Helligkeitsstufen und das Metall der Fensterrahmen. Die Betonwände werden innerhalb der Schülerschaft kontrovers bewertet, wie Architektin Judith Kusch berichtet, die auch nach der Fertigstellung des Gebäudes in engem Kontakt mit Bauherren und Nutzern steht. Sie hebt zugleich hervor, dass es bislang auch nicht die geringsten Anzeichen von Vandalismus gibt.
Die Bibliothek verdient besondere Erwähnung. Sie ist im Grundriss an herausragender Stelle angeordnet: an der Gebäudeecke, die von beiden kreuzenden, verkehrsreichen Straßen umflossen wird. Große Fensterflächen machen sie im Wortsinne zum Schaufenster. Die vom Eingang her fächerartig sich spreizenden Bücherregale geben den Blick in die ganze Raumtiefe frei. Lesetische hingegen sind unmittelbar an den Fenstern angeordnet. Holzboden und Holzdecke exakt in jener Fläche, die die Regale aufspannen, unterstreichen den noblen Charakter. Es ist, als wollte das Berufsbildungskolleg hier, in unmittelbarer Nähe der Universität und ihrer zahlreichen Institutsbauten, ihren Anspruch als Bildungsstätte subtil, aber doch erkennbar unterfüttern. – Ehe nun allerdings Bedenken hinsichtlich des traditionellen Bildungsträgers Buch aufkommen, sei erwähnt, dass die Klassenräume durchweg auf gängigem Stand der Technik mit Whiteboards und dergleichen ausgestattet sind. Überhaupt die Klassenräume: Sie folgen der unregelmäßigen Form des Gebäudegrundrisses und sind ebenfalls polygonal geknickt. Dies wiederum bilden die Lichtleisten in der Decke ab, jeweils drei an der Zahl, die den ganzen Raum blendfrei ausleuchten. Sie alle sind, wie Projektleiterin Stephanie Große-Brockhoff betont, sorgsam vor Ort gefertigt und auf Gehrung geschnitten, um auch nicht den kleinsten dunklen Rest-Winkel zu lassen. Und natürlich bündig in die Decken eingepasst.
Die durchgängige Helligkeit des Gebäudes – und nebenbei erwähnt, aber alles andere als nebensächlich: die erstaunliche Ruhe aufgrund sehr wirksamen Schallschutzes – lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass dies ein Lernort durch und durch ist, ein Ort der Konzentration, der Zielorientiertheit; und wenn man, mit Blick auf den katholischen Träger der Einrichtung, ketzerisch sein wollte, könnte man sagen: ein Ort protestantischen Bildungseifers. Doch der ist, wie soziologische Untersuchungen belegen, längst konfessionsübergreifend verankert.db, Mo., 2018.03.05
05. März 2018 Bernhard Schulz
Alpenglühen
(SUBTITLE) Talstation der Giggijochbahn in Sölden (A)
Ein Lichtblick im österreichischen Skiparadies Sölden: Im vielfarbig schillernden Umfeld touristischer Einrichtungen strahlt die Talstation der neuen Giggijochseilbahn in jeder Hinsicht große Ruhe aus. Blickfang des markanten Bauwerks ist ein dezent illuminiertes, tag- und nachtwirksames Alpenpanorama.
In der Werbung inszeniert sich der österreichische Skiort Sölden als »Hotspot der Alpen« – und genau so sieht er auch aus. An die Zeiten, als die Gemeinde im Tiroler Ötztal ein bäuerlich geprägtes Straßendorf war, erinnert allenfalls noch die Straße. Einige Gebäude links und rechts der kilometerlangen Ortsdurchfahrt geben sich zwar nach wie vor als Kuhstall, Tenne oder Rodelhütte aus, aber die Namen verweisen heute auf Cafés, Après-Ski-Lokale und Nachtclubs. Hinzu kommen Hotels, Pensionen, Sportbedarfs- und Modegeschäfte sowie einige wenige kommunale Bauten wie etwa das angenehm schlichte Gemeindehaus. Geprägt wird das Straßenbild indes von einer eklektischen Showarchitektur, die gern das Urige mit dem Coolen mixt und selbst tagsüber teilweise von Leuchtreklamen überstrahlt wird. Nachts vermag solch ein »Hotspot« durchaus zu faszinieren – vorausgesetzt man sieht ihn mit den Augen eines vergnügungshungrigen Skiurlaubers, anderenfalls kommt man sich schnell wie ein Taliban auf der Reeperbahn vor.
Technotrack versus Alpensymphonie
Doch es gibt zwei Bauwerke in Sölden, die sich nicht in dieses eindimensionale und etwas maliziöse Bild fügen. Es handelt sich um die Talstationen der beiden Seilbahnen, die insofern das ökonomische Rückgrat des Orts bilden, als sie das riesige Söldener Skigebiet erschließen und damit den touristischen Betrieb überhaupt erst ermöglichen. Sowohl die 2010 fertiggestellte Gaislachkogelbahnstation am südlichen Ortsausgang als auch ihr Pendant im Norden, die 2016 errichtete Giggijochbahnstation, können sich sehen lassen – bei Tage, aber auch in der glitzernden Söldener Nacht. Dann präsentiert sich die auf einem massigen Sockel errichtete Glashalle der südlichen Station als großer, vielfarbig schillernder Leuchtkörper. Licht dient hier der spektakulären Inszenierung der exponierten Seilbahntechnik; es ist laut wie ein Technotrack und feiert das Leben als knallbunten Spaß. Ganz anders wirkt der von einem leuchtenden Band umkränzte Turm der Giggijochbahnstation. Das heruntergedimmte Licht dient hier der Illumination eines umlaufenden Alpenpanoramas. Es ist blau. Es ist leise. Und es unterstreicht auf dezente Weise die fast sakrale Anmutung des hohen Turmbaus.
Beide Anlagen sowie die jeweils zugehörigen Bergstationen entstanden nach Plänen des Architekturbüros Obermoser aus Innsbruck. In Sölden ist Johann Obermoser so etwas wie der Baumeister vom Dienst. Auf dem Gaislachkogl hat er das mondäne Bergrestaurant »Ice-Q« errichtet, in dem 2015 Teile des James-Bond-Streifens »Spectre« gedreht wurden; unweit davon entsteht derzeit mit der Bond-Erlebniswelt »Elements 007« ein weiteres Werk des Innsbruckers. Von ihm stammt außerdem der Entwurf des Shuttle-Aufzugs, der von der Ortsmitte aus die niedriger gelegenen Abfahrten erschließt.
Im Übrigen hat sich Obermoser weit über Sölden hinaus als Seilbahnexperte einen Namen gemacht. Die Giggijochbahn ist sein sechstes Projekt dieser Art – und ein ganz besonderes dazu: Dank der vom Unternehmen Doppelmayr bereitgestellten Technik gilt die Anlage als die leistungsfähigste Seilbahn der Welt. Bis zu 4 500 Wintersportler vermag sie pro Stunde auf den Gipfel ihrer Träume zu transportieren.
Starker Solist auf grosser Bühne
Das Bauwerk verkraftet den Ansturm ohne Weiteres. Selbst in der Hauptstoßzeit zwischen 8 und 10 Uhr morgens, wenn die Skifahrer zu Tausenden anrücken, bilden sich keine Warteschlangen auf dem Vorplatz. Fortlaufend sickern die Massen ins Gebäudeinnere ein, wo sie von Rolltreppen, Aufzügen, Passagen und Einstiegszonen aufgenommen und rasch weitergeleitet werden. »Früher gab es hier Schlangen ohne Ende«, sagt Christoph Neuner, der das Bauvorhaben als Projektleiter begleitet hat. »Aber nicht nur in logistischer Hinsicht ließ die Vorgängerstation zu wünschen übrig, sie hat auch viel zu viel Raum beansprucht.« Da die neue Station auf verhältnismäßig kleinem Grund steht, hält sie Distanz zu den umgebenden Hotels, Gaststätten und Parkhäusern. Wie ein Solist auf weiter Bühne zieht sie die Blicke des Publikums auf sich.
Was von der nahen Hauptstraße aus wie ein runder Turm wirkt, entpuppt sich in der Seitenansicht als lang gestrecktes Volumen mit U-förmigem Grundriss. Die gefräste und hydrophobierte Betonschale des Baus kontrastiert sehr schön mit der Metallhülle der umlaufenden Bahnsteigebene, auf der die 10-Personen-Gondeln eintreffen und abfahren. Die Plattform wurde auf 13 m angehoben, um den Fußabdruck des Gebäudes auf dem Grundstück zu minimieren. Aber nicht nur deshalb. Durch die erhöhte Lage verringert sich der Anstiegswinkel der Seilzüge, was den Bahnbetrieb erleichtert. Außerdem ermöglicht der hohe Bahnsteig eine direkte Verbindung zur Skipiste und zum angrenzenden Parkhaus.
Auch in anderen Bereichen folgt die Formgebung den vielfältigen funktionalen Anforderungen auf eine Weise, dass die Nutzung des Zweckbaus zu einem ästhetischen Vergnügen wird. Das ist etwa bei den exponierten Rolltreppen der Fall. Oder der mehrgeschossigen Kassenhalle. Oder dem einsehbaren, vom Hauptgebäude abgerückten Spannschacht, in dem superschwere Gewichte die Stahlseile stramm ziehen. Gestalterisches Highlight des Ganzen ist aber zweifellos die Einstiegsplattform mit der verspiegelten Unterseite und dem perforierten Aluminiumschirm.
Ganz ohne Spots und Strahler
Die Löcher im Metallband formieren sich zu einem Panorama der Ötztaler Alpen, das je nach Tageszeit und Lichtstimmung unterschiedlich wirkt. Tagsüber tritt das Bild manchmal nur als abstrakte Grafik in Erscheinung; nachts, wenn die Hülle von blauem LED-Licht hinterleuchtet wird, entfaltet das Gebirgsmotiv eine plastische Wirkung.
Bei der Gestaltung und Ausführung der Installation arbeiteten die Architekten eng mit den Lichtplanern der Firma Bartenbach aus Aldrans zusammen. Dabei einigten sich die Beteiligten ziemlich schnell auf das zugrundeliegende Fotomotiv. Die Herausforderungen der Lichtplanung beschreibt Christoph Gapp, Projektleiter bei Bartenbach, folgendermaßen: »Zuerst galt es, das richtige Material zu finden. Dann ging es um die exakte Abstimmung von Materialdicke, Lochgröße und Anordnung der Bohrungen.
Schließlich mussten wir uns um die Lichtfarbe und die Positionierung der Leuchten kümmern.« Der Designprozess umfasste eine ganze Reihe von Versuchen, die sowohl im Lichtlabor bei Bartenbach als auch vor Ort in Sölden durchgeführt wurden. In Aldrans arbeiteten die Lichtplaner v.a. mit Simulationen, doch um Wirkung aus größeren Distanzen zu testen, kamen auch 1:1-Modelle zum Einsatz, die etwa an der Gaislachkoglbahnstation montiert wurden.
Zur Illumination bedarf es keiner besonderen Spots oder Strahler. »Zum Einsatz kommen lediglich die LED-Deckenleuchten, die für die Grundbeleuchtung des Einstiegsbereichs sorgen«, sagt Christoph Gapp. Normalerweise spenden die Leuchten tagsüber weißes und nachts blaues Licht, doch für besondere Anlässe stehen auch andere Farbstimmungen zur Auswahl. Im Übrigen sind es die reflektierenden Oberflächen der Plattform wie etwa die helle Betoninnenwand und der teilweise mit weißen Fahrbahnmarkierungen bedeckte Fußboden, die wesentlich zur stimmungsvollen Beleuchtung beitragen. Die Gesamtwirkung schließlich resultiert aus dem harmonischen Zusammenspiel von illuminiertem Metallband und dezent angestrahltem Turm.
Mit einer vergleichbaren Lichtinszenierung kann die Bergstation nicht aufwarten. Doch in rund 2 280 m Höhe geht es ja auch nicht darum, ein mittelprächtiges Umfeld durch ein starkes architektonisches Zeichen aufzuwerten. Im Gegenteil sollte sich die Architektur hier der starken Landschaft unterordnen – was die Station auch tut: Über einem Betonsockel, der die notwendigen Funktionen aufnimmt, schwebt als Wetterschutz eine folienbespannte Stahlkonstruktion, die das Volumen luftig und leicht erscheinen lässt. Da die Gondel-Garage innerhalb der Konstruktion untergebracht wurde, erübrigten sich zusätzliche Kubaturen in den Bergen. Auch der Tunnel, der die Station mit dem 200 Meter entfernten Restaurant verbindet, trägt zur Minimierung des Landschaftsverbrauchs bei. Alles in allem bereichert die neue Giggijochbahn die Feriengemeinde Sölden um zwei Attraktionen. Die auf dem Berg fördert den Fremdenverkehr, die im Tal stärkt darüber hinaus das Ortsbild.db, Mo., 2018.03.05
05. März 2018 Klaus Meyer
Farbe bewegt Passage
(SUBTITLE) Zwei Bahnunterführungen in Zutphen (NL)
In der niederländischen Kleinstadt Zutphen ermöglichen zwei neue Bahnunterführungen die Anbindung eines neuen Stadtteils an die historische Innenstadt. Die integrierten Licht-Installationen von Herman Kuijer schaffen eine langsam fließende Choreografie aus farbigem Licht mit bewusst freundlicher Ausstrahlung.
Der unweit der deutsch-niederländischen Grenze bei Emmerich gelegene Ort Zutphen wurde bereits während der Römerzeit als fränkische Siedlung errichtet und zählt damit zu den ältesten Städten der Niederlande. Momentan ist man in der knapp 50 000 Einwohner zählenden Kleinstadt damit beschäftigt, das nördlich vom Bahnhof gelegene Viertel Noorderhaven zu einem modernen Wohn- und Büroquartier zu entwickeln und gemeinsam mit dem angrenzenden Gewerbegebiet De Mars besser an das historische Zentrum anzubinden. Die 2007 dazu vorgestellte Masterplanung des renommierten Rotterdamer Büros KCAP umfasst auf einer Fläche von 20 ha rund 1000 Wohnungen sowie Büro- und Ladenflächen und sah außerdem den Bau zweier neuer Unterführungen vor, um so die bislang bestehenden beschrankten Bahnübergänge zu ersetzen.
Erhöhtes Sicherheitsgefühl
Mit der architektonischen Planung und technischen Umsetzung der beiden Tunnel hatte das zuständige niederländische Eisenbahninfrastrukturunternehmen ProRail 2008 im Auftrag der Stadt Zutphen das Utrechter Bauunternehmen Railinfra Solutions sowie das Maastrichter Architekturbüro Maurer United Architects beauftragt. Im Sommer 2013 konnte daraufhin mit den Erdarbeiten begonnen werden, im November 2015 erfolgte die Fertigstellung: Der von Architekt Mari Baauw vom Büro Royal HaskoningDHV – einer 100-prozentigen Tochter von Railinfra Solutions – entwickelte Marstunnel schafft westlich vom Bahnhof eine direkte Verbindung zwischen Nord und Süd und integriert dabei zwei unterschiedlich hoch gelegene Fahrbahnen für Autofahrer bzw. Fußgänger und Radfahrer. Der deutlich kleinere, durch den Architekten Marc Maurer geplante »Kostverloren-Tunnel« – benannt nach einem militärisch bedeutsamen Rondell bei der historischen Niederlage der Niederländer gegen die Spanier im Jahr 1583 –, ermöglicht östlich vom Bahnhof eine attraktive Passage für Fußgänger- und Radfahrer.
»Eigentlich sind die beiden Tunnel herkömmliche Bauwerke aus Beton«, erklärt Peter Kelder, Projektleiter der Stadt Zutphen. »Aufgrund der hohen städtebaulichen Bedeutung der Unterführungen als Scharnier zwischen Alt und Neu hatten wir aber schon frühzeitig die Integration zweier Lichtinstallationen beschlossen, um so neben einer hochwertigen Ästhetik und einer verbesserten Orientierung auch ein erhöhtes Sicherheitsgefühl der Bürger beim Durchfahren der Tunnel zu erreichen.«
Überraschende Perspektiven
Den Auftrag zur Umsetzung hatte 2010 nach einer Empfehlung der städtischen Kunstkommission der renommierte Amsterdamer Lichtkünstler Herman Kuijer erhalten. Kuijer hat in den vergangenen drei Jahrzehnten zahlreiche große Lichtinstallationen im öffentlichen Raum realisiert und ermöglicht mit seinen Arbeiten häufig überraschende Perspektiven auf Architektur und Stadt. Für das Projekt in Zutphen entwickelte er ausgehend von den Anforderungen der Stadt zwei physisch erlebbare und gleichzeitig immateriell bewegte Installationen mit subtil sich verändernden Farbverläufen, die jeweils über ein LED-Steuerpult mithilfe der Lichtsteuerungssoftware Madrix betrieben werden.
»Licht ist nur sichtbar, wenn es irgendwo auftrifft, wenn es also eine Struktur gibt, die das Licht organisiert«, erklärt Herman Kuijer. »Um Lichtkunst, Architektur sowie funktionale Anforderungen als Einheit zu planen, habe ich deshalb von Beginn an intensiv mit den beteiligten Architekten Mari Baauw und Marc Maurer sowie den Vertretern der Stadt zusammengearbeitet und außerdem den erfahrenen Lichtingenieur Nico de Kruijter hinzugezogen.« Ausgehend von intensiven Vorplanungen sowie zahlreichen Tests und Messungen entstanden schließlich zwei individuell auf den jeweiligen Kontext zugeschnittene, aus vorgefertigten Betonelementen errichtete Raumstrukturen, die vor Ort durch verdeckt angeordnete, in Position und Ausrichtung exakt berechnete LED-Armaturen mit insgesamt 1000 Leuchten illuminiert werden.
Eindrucksvoll in Szene gesetzt werden die beiden mittlerweile auch als Apple-Werbung zum Zuge gekommenen Installationen durch eine aufwendig programmierte Lichtchoreografie, die mit verbindlich ausgewählten Vorgaben zu Farben, Farbverläufen und zur Wechselgeschwindigkeit beinahe unmerkliche Farbverwandlungen und -überlagerungen auf Abschnitten von jeweils mehreren Betonelementen erzeugt: »Ganz wichtig war mir dabei, dass das Licht niemals gleich ist, sondern dass die Farbzusammensetzung zufällig erfolgt und somit bei jeder Durchwegung eine andere ist«, so Herman Kuijer.
Integrierte Funktionsbeleuchtung
Anders als bei vergleichbaren Projekten war es in Zutphen möglich, das Funktionslicht von vornherein in die Installation zu integrieren, sodass die Ausdruckskraft nicht durch zusätzliche Funktionsleuchten gestört wird. Im Ergebnis wird so eine Klarheit und Reduktion erreicht, die spontan an Arbeiten von James Turrell oder Dan Flavin denken lässt. Da andererseits nur wenig natürliches Licht in die Tunnel dringt, sind beide Lichtprogrammierungen entsprechend auch den Tag über eingeschaltet – »und das sogar deutlich stärker als während der Dämmerung, um so eine für das menschliche Auge durchgehend gleichbleibende Helligkeit zu ermöglichen«, wie Herman Kuijer erklärt. »Bei Dunkelheit beträgt die Lichtstärke dem subjektiven optischen Eindruck zum Trotz sogar lediglich etwa 10 % der am Tag eingesetzten Lichtstärke.«
Der Vergleich beider Unterführungen lässt wie gesehen zahlreiche Gemeinsamkeiten erkennen. Im Marstunnel entsteht die Farbigkeit jedoch allein durch die gewählte Lichtfarbe, im Kostverloren-Tunnel sind zusätzlich auch die Längs- und Kopfseiten der hier vielschichtig ausgeführten Wand- und Deckenelemente in Teilen farbig gestrichen, sodass das Licht hier intensiver erscheint. Zudem kamen hier matte Keimfarben zum Einsatz, die eine verbesserte Farbwiedergabe ermöglichen und die sich bei Graffitis leicht überstreichen lassen. Ein charakteristisches Element im Marstunnel ist stattdessen die mittig integrierte Stützenreihe, die eine Art Lichtarkade zwischen den beiden unterschiedlich hoch gelegenen Fahrbahnen schafft. Zusätzliche Attraktivität bietet hier die von Architekt Mari Baauw aufwendig als Oktopus gestaltete Südzufahrt mit ihrer dynamisch ausholenden Streckenführung und der schwarz verklinkerten Einfassungsmauer, die von der Innenstadt her kommend einen dunklen cinemascope-artigen Rahmen für die dahinter beginnende Lichtinstallation schafft.
Bezug zum Fluss IJssel
Als wichtigen inhaltlichen Bezugspunkt für seine Lichtinstallation erwähnt Herman Kuijer die Wellenbewegung des unmittelbar an die Altstadt angrenzenden Flusses IJssel: »Im Fortschreiten von Licht und Farbe wird so auf meditative Weise die Beziehung von Zeit und Raum erlebbar«, so der Lichtkünstler. Wer sich auf dieses Assoziationsfeld einlässt, dem wird schnell bewusst, dass sich die beiden Tunnel an Orten befinden, die ohne Eingriff des Menschen tief unter Wasser lägen. Für Unruhe sorgt dieser Gedanke jedoch nicht, im Gegenteil: Wenn man die Passanten nach ihrem persönlichen Eindruck befragt, stößt man v.a. auf freudige Überraschung. Für die sonst so oft in Unterführungen spürbare Beklemmung bleibt da gar keine Zeit mehr.db, Mo., 2018.03.05
05. März 2018 Robert Uhde