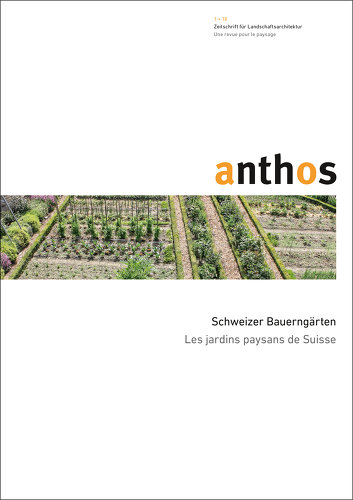Editorial
Mit dem Jahreswechsel hat auch das «Europäische Kulturerbejahr 2018» begonnen. Ausgelobt und lanciert von der Europäischen Kommission unter dem Motto «Sharing Heritage» hat es bereits im Vorfeld erfrischend viele Diskussionen ausgelöst. Gibt es das, ein gemeinsames europäisches – grenzenloses – Kulturerbe? Prägt die gesellschaftliche Selbstwahrnehmung zugleich die Identität oder sind es die Zuschreibungen von aussen? Nimmt der Schweizer Bergbauer seine Landschaft, die ihm einen harten, häufig verlustreichen Alltag aufbürdet als ebenso malerisch und einmalig wahr wie der Tourist, der sie zur Erfüllung seiner klischierten Vorstellung (ge)braucht?
Was bedeutet die Zuschreibung eines Kulturerbes für die Entwicklungspotenziale von Landschaften, Regionen und Orten? Sind sie damit zur Konservation des Ehemaligen verdammt oder ist ihre auch rigorose Transformation legitim? Für Furore gesorgt hat vor wenigen Jahren der «Dresdner Brückenstreit», die ab Mitte der 1990er-Jahre geführte Kontroverse um die Errichtung einer zusätzlichen Elbequerung in Dresden: Der Bau der vierspurigen innerstädtischen Waldschlösschenbrücke führte 2009 zur europaweit bislang einmaligen Aberkennung des Welterbetitels für die Kulturlandschaft Dresdner Elbtal. Quo vadis Kulturerbe?
Insgesamt 19 Länder, darunter die Schweiz, nehmen mit nationalen Programmen am Kulturerbejahr 2018 teil – der BSLA zählt zu den offiziellen Schweizer Trägerorganisationen – und machen sich multiperspektivisch auf die Suche nach Antworten. Unzählige Projekte verfolgen verschiedenste Spuren; darunter eine Veranstaltung zur «Märklinmoderne» in Frankfurt (Main), in der den Häuschen-Bausätzen für die Modell-Eisenbahn auf den Grund gegangen wird. Der Bausatz «Villa im Tessin» übrigens ist legendär und ein Klassiker.
Der Stellenwert der alpinen Schweizer Landschaften, die einst schon die Söhne des europäischen Adels im Rahmen der Grand Tour zunächst ob der Beschwerlichkeiten und der Schroffheit der Natur bei der Überquerung der Alpen gen Italien in Furcht versetzten, später begeisterten und die Schweiz selbst zum Reiseziel werden liessen, ist seit dem 18. Jahrhundert unbestritten und hat seinen festen Bestandteil im kulturellen Erbe Europas.
Der Schweizer Bauerngarten ist ein ebenso wichtiger, als Nutzgarten häufig vernachlässigter Teil unseres gelebten Kulturerbes, der auch über das gemeinsame Tun Menschen unterschiedlicher Herkünfte miteinander verbindet und in diesem Sinne aktiv an einer grenzenüberwindenden Identität mitwirkt. Dass zumeist Frauen darin aktiv waren und sind geht in der Geschichtsschreibung ebenso regelmässig unter.
Wir widmen dem Kulturerbe Bauerngarten diese Ausgabe.
Sabine Wolf
Inhalt
Roman Häne: Charakteristische Diversität
Yvonne Christ: Vielfalt und Individualität als Konstanten
Benno Furrer: Nicht nur blumige Flächen vor dem Haus
Christoph Schläppi: Jenseits von Gegenstand und Abstraktion
Roman Häne: Traditionen im Schweizer Mittelland
Karin & Frank Stössel: Gartensteckbrief
Niklaus von Fischer: Das Reich der Frau
Anna-Katharina & Heinz Schwab: Gartensteckbrief
Ursula Yelin, Stephan Aeschlimann Yelin: «Wo Milch und Honig fliesst»
Regula Näf-Rudin: Gartensteckbrief
Catherine & Bernard Theubet: Gartensteckbrief
Agathe Caviale: Altes Wissen bewahren
Anne-Lise Thürler: Gartensteckbrief
Daniele Ryser: Ein einziger grosser Gemüsegarten aus Hügeln und Tälern
Roman Häne: Bauerngärten im Appenzellerland
Rita Illien: Graubündens Bauerngärten
Johannes Stoffler: Mehr als nur Bauerngärten
Annemarie Bucher: Pop oder Pastiche? Bauerngärten als Bedeutungsträger
Das Reich der Frau
Wer über Land spaziert und im Vorbeigehen einen Blick über die Zäune wirft, weiss, dass Bauerngärten eine besondere Ausstrahlung haben. Dieser Zauber ist weder abhängig von der Region, der Grösse und Ausgestaltung, noch kann man ihn einfach auf bestimmte Pflanzenarten zurückführen. Das Geheimnis lässt sich eher anhand von Prinzipien lüften, die im Hintergrund wirken – und anhand der Personen, die den Bauerngarten hegen und pflegen: den Bäuerinnen.
Im Vergleich zu anderen Gärten funktioniert ein Bauerngarten in verschiedener Hinsicht ganz anders: Er ist zweigeteilt. Innerhalb des Gartenzauns befindet sich der «Garten im engeren Sinne». Er ist ein ausgezeichnetes Stück Land an möglichst günstiger Stelle mit einem Boden, der bereits seit Generationen bearbeitet und gepflegt wird. In diesem Garten haben nur die Frauen, die Katzen und die Schnecken etwas zu sagen, alle anderen – insbesondere Männer, Hunde und Hühner – sollen sich an anderen Orten aufhalten.
Ausserhalb des Zauns, rund um die Gebäulichkeiten des Hofs, haben die betrieblichen Bedürfnisse Vorrang. Hier hat aber auch der «Garten im weiteren Sinne» Platz, bestehend aus einzelnen Fleckchen nützlicher oder zierlicher Art. Zum Beispiel auf Fenstersimsen und Treppenstufen, als Pflanzblätz mit den grossen und platzraubenden Pflanzen, als Baum auf dem Hofplatz oder als Spalier und Rabatte an sonnigen Wänden von Nebengebäuden. Für all diese Gartenexklaven ist selbstverständlich ebenfalls die Frau zuständig.
Die Bäuerinnen sind heute voll im Betrieb eingespannt, gehen oft noch einer Erwerbsarbeit nach und haben grundsätzlich nur zu Randzeiten die Möglichkeit, sich um den Garten zu kümmern. Das tun sie jedoch während der ganzen Saison jeden Tag, denn sie kennen weder Freizeit noch Ferien. Mit geschickter Hand und grosser gärtnerischer Erfahrung tun sie am frühen Morgen, abends und auch zwischendurch in den wenigen zur Verfügung stehenden Minuten jeweils das Nötigste. Und die meistgebrauchten Werkzeuge sind an strategischer Stelle immer griffbereit.
Der Kontrast zum landwirtschaftlichen Ambiente
Auf einem Bauernhof geht es mit Grossvieh, Traktoren, Maschinen, mit all den Futtermitteln, Geräten, Baumaterialien, Feldfrüchten und mit dem ganzen Kleinvieh ziemlich grosszügig und unzimperlich zu und her. Höhere Ansprüche an Ordnung und Sauberkeit stecken die Bauern zwangsläufig zurück. Die Umgebung der Häuser ist geprägt von diesem charakteristischen, landwirtschaftlichen Ambiente. Die Beläge von Wegen und Plätzen bilden in der Regel ein interessantes und pragmatisches Mosaik aus verschiedenen Materialien und Generationen. Der praktische Nutzen kommt vor stilreiner Einheitlichkeit. Hier trocknen die Bretter eines aufgeschnittenen Baumstamms, da wächst ein Holunder aus einem vor langer Zeit deponierten Haufen von Lesesteinen, drüben erobern die Brennnesseln die schattige Ecke einer kleinen Kälberweide und ganz hinten ist das Dach eines baufälligen Schuppens eingebrochen und behelfsmässig mit glänzendem Wellblech zugedeckt. Zu diesem Umfeld stehen die üppig überquellenden Gemüse- und Blumenbeete des eingezäunten Gärtchens, die uralten Fuchsien am Kellertreppengeländer, die selbst vermehrten Begonien und Geranien vor den Fenstern und die sorgfältig aufgebundenen Tomaten an der Schmalseite des Schweinestalls in einem starken und wirkungsvollen Kontrast.
Das Pflanzensortiment
Wissenschaftlich betrachtet ist in den Bauerngärten eigentlich nur das (meist spärliche) Unkraut charakteristisch. Es besteht – wen wunderts? – vorwiegend aus den höchst anspruchsvollen Zeigerpflanzen der Gartenstufe. Ausserdem widerspiegelt das Unkrautsortiment das lokale Klima viel offensichtlicher als die kultivierten Arten, die mit viel gärtnerischem Können auch unter ungünstigen Bedingungen zum Überleben gebracht werden können. Konkret bedeutet das, dass in den Gärten aller Regionen ungefähr das gleiche, mehrere hundert Arten umfassende Sortiment an Nutz- und Zierpflanzen zu finden ist.
Und zwar sowohl bei den alten Höfen als auch in den neueren Einfamilienhausgärten am Dorfrand. Worin liegt denn der Unterschied? Bauerngärten werden nicht neu angelegt. Wenn eine junge Bäuerin den Garten von ihrer Vorgängerin übernimmt, ist er schon voll. Sie trifft ein traditionelles, sehr bewährtes Pflanzensortiment samt dem entsprechenden Know-how an und ist aus Rücksicht auf die (Schwieger-)Mutter im Stöckli noch eine Weile lang nicht ganz frei in der Pflanzenwahl. Alles, was sie nach eigenen Vorstellungen neu einführen will, muss sich zwischen dem Vorhandenen zuerst einen Platz erobern. Es gibt zwar keine Einschränkung, jede Neuheit und Mode kommt in Frage, aber die altbekannten, vertrauten und «landläufigen» Arten prägen eben doch im Wesentlichen das Bild!anthos, Fr., 2018.02.23
23. Februar 2018 Niklaus von Fischer