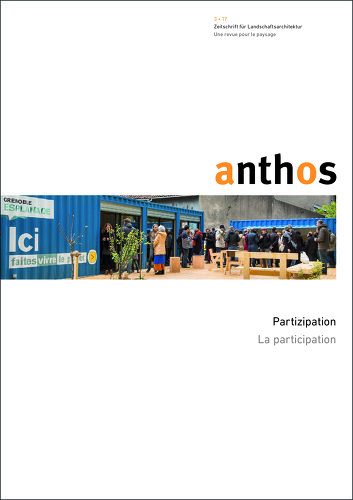Editorial
Es kommt frischer Wind in allerlei Planungsprozesse. Anwohnerinnen und Anwohner, Bürgerinitiativen und Einzelpersonen formulieren ihre Bedürfnisse und Anliegen, Wünsche und Prämissen an die Gestaltung ihrer Lebensumgebung: Die mündige, aufgeklärte Bürger*in fordert ihr Recht zur Mitbestimmung ein. Projekt für Projekt verschmelzen die vermeintlichen Gegensätze von «partizipativer Planung» und einer «Planung von oben» zu einer neuen Planungskultur der Vielfalt.
Das prozesshafte Vorgehen schafft von Anfang an eine gemeinsame Vision und gegenseitige Akzeptanz. Die bedarfsbasierte Projektentwicklung fördert nicht nur an den Ort angepasste, massgeschneiderte und zukunftsfähige Konzepte, sie leistet aufgrund ihrer breiten Abstimmung zugleich auch die Einbettung in einen grösseren gesellschaftlichen und lokalen Kontext. Die Identifikation der lokalen Akteure mit entsprechenden Planungen und ihren Umsetzungen ist höher und damit auch eine gewisse soziale Kontrolle, welche die Langlebigkeit von Projekten steigert und sogar den Unterhalt auf mehrere Schultern verteilen helfen kann.
Je mehr entsprechende Projekte entstehen, desto mehr relativierten sich auch die Ängste, entsprechend entwickelte Projekte würden teurer und aufwändiger, aber nicht besser und es bräuchte keine Experten mehr, wo beim «Jekami» (Jede/r-kann-mitmachen) jede noch so gute Idee im Kompromiss zugrunde partizipiert wird.
Erfahrungsgemäss ist meist das Gegenteil der Fall: Durch frühe Beteiligung lassen sich langfristig Kosten sparen, und prozesserfahrene ExpertInnen sind gefragter denn je. Verändert indes hat sich das Rollenverständnis des Planers, dem vermehrt auch moderierende und mediatierende Aufgaben zukommen. Die Sozialkompetenz wird wichtiger, ebenso wie ein Verständnis dafür, Bedürfnisse in Gestaltung zu übersetzen und adäquat zu kommunizieren. Diese zumindest intensivierten Aufgabenbereiche müssen auch in der Ausbildung berücksichtigt werden.
Dass partizipative Planung im Alltag angekommen ist, beweisen auch die unterschiedlichen Massstäbe, in denen entsprechende Projekte realisiert werden: Vom wenige Quadratmeter grossen Quartiergarten bis hin zu landesübergreifenden Trassenplanungen finden sich Beispiele, und auch das Feld der Trägerschaften ist breit – ob aus einer lokalen Bürgerinitiative heraus entstanden, von einem Bauträger entwickelt, von einer Kommune vorgesehen oder von einem Landschaftsarchitekturbüro initiiert. Was sie eint, sind die grundsätzlichen Mechanismen wie definierte Rahmenbedingungen und ein hohes Mass an Verbindlichkeit – und ausserdem ein jeweils massgeschneiderter Prozess. Wir haben die Verfasserinnen der Beiträge in dieser Ausgabe gebeten, als eine Art roten Faden eine Skizze des jeweiligen Vorgehens anzufertigen. Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Sabine Wolf
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Margaret Steiner, Christoph Duckart: Kiruna – eine Stadt zieht um
Benjamin Froncek, Stefan Stürmer: Psychologische Perspektiven zur Partizipation
Uwe Herrmann: Korridorentwicklung zum Höchstspannungsnetzausbau
Olivier Neuhaus, Marie-Claire Pétremand, Odile Porte: Breit angelegte Konsultation in der Stadt Neuenburg
bauchplan ).(: Gebündelte Power in Teilhabeprozessen
Dania Genini: Methodik/Medien/Tools der Partizipation
Lola Meyer, Steffan Robel: Eine neue Freiraumtypologie durch Teilhabe
Marie Sagnières, Elise Riedo, Oscar Gential, Igor Andersen: Gemeinsame Gestaltung für das Gemeinwohl
Baptiste Hernandez: Co-Konstruktion eines grossen städtebaulichen Projekts
Pil Beider Kleinschmidt: Studien über das Leben in der Stadt
Moritz Rahmann, Duygu Karsli: Bürgerbeteiligung studieren
Sabine Wolf: «Den Lebensraum mitgestalten zu können, bedeutet Lebensqualität und Identifikation»
Vesna Tomse: Am Rande der Stadt – die Wunderkammer
Breit angelegte Konsultation in der Stadt Neuenburg
Der erste Schritt der partizipativen Massnahme «Zentrum und Bahnhof: Mobilität und öffentliche Räume» in Neuenburg bestand aus einem öffentlichen Abend zur Einführung und Konsultation. Danach standen spezialisierten Akteuren fünf Workshops zur Verfügung, bevor die Ergebnisse im Rahmen eines weiteren öffentlichen Abends wiedergegeben wurden.
Die Idee zur Konsultation der Bevölkerung entstand 2013 nach der Volksbefragung, bei der über 60 Prozent der Befragten ihre Ablehnung eines Kredits zur Neugestaltung des Platzes Numa-Droz im Stadtzentrum von Neuenburg ausgedrückt hatten. Das führte zu vertieften Überlegungen seitens des Gemeinderats (Exekutive). Da nun die Notwendigkeit, die Bevölkerung besser an der Erarbeitung von Projekten zu beteiligen, offensichtlich geworden war, wurde im März 2014 eine erste partizipative Massnahme «Centre et Rives» (Zentrum und Ufer) eingeleitet. Im Herbst 2015 folgte darauf die Massnahme «Centre et Gare» (Zentrum und Bahnhof), in der es um die Zukunft von drei neuen Bereichen ging. Die breit angelegte Anhörung war die Antwort auf die wiederholte Aufforderung zur Entwicklung einer globalen und kohärenten Sicht auf die Mobilität sowie die Gestaltung öffentlicher Räume.
Vor- und Nachteile des Konsenses
Im Laufe des Einführungsabends für die Massnahme «Zentrum und Bahnhof» konnten die rund 150 anwesenden Personen nach einem informativen Teil ihre jeweiligen Erwartungen formulieren. In den fünf folgenden Workshops wurden die ungefähr dreissig Teilnehmer, die als VertreterInnen der unterschiedlichsten Vereinigungen und Organisationen im Zusammenhang mit Mobilität, Handel, den Bewohnern oder auch der Architektur erschienen, zuerst beauftragt, ihre Prinzipien der Mobilität und der Gestaltung öffentlicher Räume zu erstellen und dann einvernehmlich Vorschläge für die verschiedenen betroffenen Bereiche zu erarbeiten. Sie konnten dabei durchaus kreativ vorgehen, sollten zugleich jedoch die Vorschläge aus dem Einführungsabend sowie die Ziele des politischen Programms, der Charta für eine nachhaltige Mobilität in der Stadt und der Machbarkeitsstudien des Agglomerationsprogramms berücksichtigen. Um übernommen zu werden, mussten die Vorschläge die Zustimmung sämtlicher Anwesender erhalten (Konsensregel). Ein Team der Studiengemeinschaft für Raumplanung (Communauté d’étude de l’aménagement du territoire CEAT) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne EPFL moderierte die Veranstaltung und sorgte für methodische Kohärenz und einen Ablauf ohne Voreingenommenheit.
Die Methode der konsensgestützten Arbeit weist Vor- und Nachteile auf: Einerseits ermöglicht sie, eine Auswahl innerhalb der Vorschläge zu treffen, und den übernommenen Vorschlägen somit eine grosse Durchschlagskraft zu verleihen; andererseits beschränkt sie die Möglichkeiten, sich neuen Lösungen hinzuwenden, da es reicht, wenn ein einziger Teilnehmer sich einem Vorschlag entgegenstellt, damit dieser nicht übernommen wird.
Eine notwendige Hürde
Zum Abschluss der Workshops, während derer die Diskussionen lebhaft und zugleich respektvoll und konstruktiv waren, wurde dem Gemeinderat eine Zusammenfassung der Vorschläge übermittelt. Zur Fortsetzung der Untersuchungen verpflichtete er sich danach zu weiteren Schritten unter Berücksichtigung des partizipativen Ansatzes. Die Exekutive wollte die Einstellung der Bevölkerung kennenlernen, um ihre Vision auf deren Erwartungen zu stützen. Im Gegenzug drückten die Teilnehmer der Workshops mehrfach ihren Wunsch aus, die Vision des Gemeinderats in Bezug auf einige Themen kennenzulernen, da sie dazu gerne ihre Unterstützung oder ihre Ablehnung ausgedrückt hätten.
Der partizipative Ansatz «Zentrum und Bahnhof» bot den TeilnehmerInnen die Gelegenheit, die Vielfalt der Meinungen, die Komplexität der Projekte und die zahlreichen Zwänge wahrzunehmen, die bei der Erarbeitung von Entwürfen berücksichtigt werden müssen. Durch diesen Ansatz wurde ebenfalls eine bessere Wahrnehmung der Erwartungen der Bürger möglich – insbesondere in Bezug auf die gewünschte Verstärkung der Sicherheit und des Komforts für den Langsamverkehr sowie die Verbesserung der Qualität der öffentlichen Räume (Zusammenleben, Bepflanzung). Es konnte festgestellt werden, dass die Erwartungen der Bevölkerung mehrheitlich in Einklang standen mit den von der Stadtverwaltung durchgeführten Machbarkeitsstudien im Zusammenhang mit dem Agglomerationsprojekt.
Nun geht es darum, die Untersuchungen zu vertiefen und eine Strategie zur progressiven Durchführung für die angenommenen Massnahmen aufzustellen. Im Hinblick darauf wird dem Stadtrat (Legislative) im Lauf der kommenden Monate ein Bericht zum Antrag eines Projektierungskredits unterbreitet. Letztendlich wird das gesamte Gesicht von Neuenburg in zehn oder zwanzig Jahren neu gestaltet worden sein, und dieser partizipative Ansatz war sicherlich eine notwendige Hürde während dieses langen Prozesses.anthos, Fr., 2017.09.15
15. September 2017 Olivier Neuhaus, Marie-Claire Pétremand, Odile Porte
Gebündelte Power in Teilhabeprozessen
Teilhabe in Planungsprozessen verstehen wir als integrative Chance für die Profession im Sinne eines geweiteten Berufsverständnisses. Im direkten Kontakt mit der Bevölkerung ergibt sich die Möglichkeit, die Planungskultur und das Bewusstsein beteiligter Akteure weit mehr zu prägen, als es oftmals durch das gebaute Resultat selbst möglich scheint.
Längst haben sich Politik, Planung und Verwaltung die Beteiligung lokaler Akteure als Methode angeeignet, um die Emanzipation der Bürgerschaft oder eines Projekts voranzutreiben sowie die Legitimationsebene zu erhöhen.
Nicht selten liegt auch die Hoffnung zugrunde, kraftzehrende, verspätete Abstimmungen und auf Protesten basierende Überarbeitungsdurchgänge von Beginn an in einem zeitlichen und ökonomischen Rahmen zu fassen.
Unser Ansatz geht weiter: Wir sind davon überzeugt, dass partizipative Planung zu lokal verankerteren, akzeptierteren und oftmals besseren Lösungen führt.
Zu Projektbeginn stellen wir uns jeweils die strategische Frage, ab welcher Ebene Beteiligungsprozesse sinnvoll sein können. Den heutigen Planungsaufgaben entsprechend sind partizipative Verfahren nicht seriell; als Experten des Alltags bringen Bürger ihr Know-how ein. Für moderierende Planer erschliessen sich neue Parameter und die Chance auf eine hohe Spezifität im gebauten Resultat. Gezielte Aktivierung und angemessene Beteiligungsformen dienen dazu, jenseits von Wutbürgern dezidiert spätere Nutzer anzusprechen und zielgerichtet in den Prozess einzubinden.
Nicht selten treten in den Gegenüberstellungsprozessen allgemeiner und individueller Interessen partikulare Wortmeldungen gewichtig auf, während andere bereichernde Inputs zaghaft artikuliert und in der Folge nicht entsprechend wahrgenommen werden. Prinzipiell hat sich ein spielerischer Zugang in Beteiligungsverfahren bewährt, um Interessen in der Moderation gleichberechtigt abwägen zu können. Nicht selten jedoch gelingt es nur über zusätzliches, professionell ausgebildetes Personal, einzelne Akteure aus fortlaufenden Prozessen partiell herauszunehmen, ihre Sorgen aufzunehmen und ihre Emotionen abzufedern.
Rechtliche Herausforderungen
Wie die Verfahren zur Beteiligung ist auch deren rechtlicher Status noch nicht definiert. Derzeit versuchen Städte wie Stuttgart oder Wien mittels Selbstverpflichtungen klare Rahmenbedingungen für transparente Prozesse zu formulieren. In die Honorarordnungen der planenden Berufe haben Teilhabe-Verfahren bislang höchstens als besondere Leistungen Einzug gehalten. Doch wie weit werden im Prozess gewonnene Erkenntnisse und getroffene Entscheidungen für Planer und Öffentlichkeit bindend?
Im Zuge der Planung der neuen Böblinger Fussgängerzone wurden durch Bevölkerung, Politik und Verwaltung über Gestaltungskataloge, Gutachten, Exkursionen und 1:1-Bemusterungen Entscheidungen bis in die Materialebene getroffen. Mithilfe petrochemischer Beschreibungen sowie intensiver rechtlicher Beratungen gelang es – für Freianlagen in Deutschland erstmalig – die getroffene Entscheidung hinsichtlich der gewählten Natursteine gemäss europäischem Vergaberecht in einer öffentlichen Ausschreibung zur qualitativen Vergabegrundlage zu machen. Für ein besonderes Projekt kann ein derartig aufwändiger Weg mit entsprechendem Engagement beschritten werden, doch der aussergewöhnliche Zeitaufwand baut sich durch den Informationsgewinn aus Partizipationsprozessen unter Umständen sogar zum beruflichen Risiko aus: Im Beteiligungsprozess im fränkischen Markt Erlbach wurden für den historischen Ortskern gemeinsam mit den Anrainern unter fachlicher Begleitung des Denkmalschutzes Fassadensteckbriefe erstellt. Rechtlich ungeklärt ist jedoch der Status dieses, für den Entwurf wesentlichen Erkenntnisgewinns. Damit bleibt für uns als Planer die Fragestellung offen, ob etwa bei Unklarheiten in der späteren Umsetzung die in der Beteiligung erarbeiteten Informationen als rechtlich belastbare, ergänzende Planungsgrundlagen gewertet werden.
Gebauter Kompromiss
Wie überführt man aktive Beteiligungsprozesse über die Projektrealisierung hinaus in funktionierende Nachbarschaften? Grundsätzlich betrachten wir Planen, Bauen und Nutzen als phasenverschobene Interpretationsvorgänge. Somit ist das bauliche Resultat unmittelbar an seinen Entstehungsprozess gekoppelt. Um das partizipative Engagement der Bürger auch während einer möglicherweise langen Bauphase nicht zum Erliegen zu bringen, hat sich ein fortlaufender Informationsfluss hinsichtlich der Detaillierung gemeinsamer Ideen oder auch durch regelmässig angebotene Baustellenspaziergänge als hilfreiches Werkzeug erwiesen. Öffentlich(keit) bauen bedeutet dann auch einen neuen Fokus für Bauleiter und ausführende Firmen. Als Planer können wir durch eine Erstinterpretation des zurückgegebenen Freiraums möglicherweise weitere Lesarten für spätere Nutzer erschliessen. In kleineren Projekten entstanden aus dem in der Beteiligung entfachten Engagement nicht selten Initiativen, die auch Jahre nach der Fertigstellung weite Teile des Unterhalts über kollektive Pflege-Events eigenständig abdecken.
Im mittlerweile vielfach ausgezeichneten Münchner Wohnbauprojekt WagnisART entstand so aus der anfänglichen Interessens-Genossenschaft «Leistbarer Wohnraum in Innenstadtnähe» über den intensiv kultivierten Austausch während der Planungs- und Bauphase eine echte Nachbarschaft, die heute für BesucherInnen wie ein eingespieltes, kleines urbanes Gefüge interagiert.
Teilhabe als ein Gegenüberstellen von Einzel- und Kollektivinteressen bereichert unseren Planungsalltag und im Optimalfall das gebaute Resultat sowie dessen Akzeptanz. Freiräume lassen sich so prototypisch als gebauter Kompromiss entwickeln. Das klingt in vielen Ohren nach qualitativen Abstrichen und architektonisch keinesfalls erstrebenswert. In einer demokratischen Gesellschaft jedoch muss der Interessensausgleich auch bei uns Planern als höchstes Gut ausverhandelter Qualitäten Fuss fassen. Um mit Luigi Snozzi zu enden, ergibt sich daraus die verantwortungsvolle Aufgabe, nicht nur einen Beitrag zum Bau der Gesellschaft zu leisten, sondern das Bauen mit der Gesellschaft zu kultivieren. Die Kunst wird es in komplexen Aufgabenstellungen daher weiterhin sein, die Gestaltungshoheit mit entsprechender Kompetenzteilung aufrechtzuerhalten.anthos, Fr., 2017.09.15
15. September 2017 bauchplan ).(