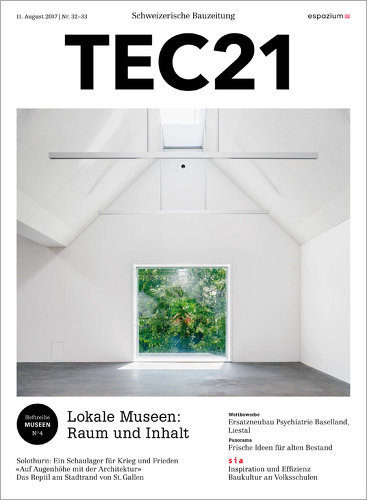Editorial
Ein ausgestopftes Riesenfaultier ist der heimliche Kuschelliebling vieler Zürcher Stadtkinder. Fast drei Meter hoch und mit Fell ausgestattet steht das Exponat im zoologischen Museum der Universität Zürich. Berühren ist ausdrücklich erlaubt, weshalb ein Besuch dieser Ausstellung für Mütter und Väter fast zur wöchentlichen Pflicht gehört. Da erstaunt es nicht, dass das Museum zu den zehn beliebtesten in der Schweiz gehört, die der Internetdienst TripAdvisor zum Besuch empfiehlt. Auf dieser Liste stehen mehrheitlich naturwissenschaftliche, volkskundliche oder handwerkliche Ausstellungsorte. Die Papiermühle in Basel, das Freilichtmuseum Ballenberg oder das Technorama in Winterthur verdrängen viele Kunsttempel auf die hinteren Beliebtheitsplätze.
Offensichtlich geht das Publikum weniger ins Museum, um zu staunen, sondern um etwas Neues zu begreifen.
Die Museumslandschaft Schweiz ist äusserst reichhaltig und umfasst über 1000 meist wenig bekannte Adressen. Trotzdem muss man sich um die Zukunft angesichts hoher Besucherzahlen und kuratorischer Bemühungen geringe Sorgen machen. Stellvertretend dafür sind in dieser Ausgabe die Erneuerung des Museums Altes Zeughaus in Solothurn und der Neubau des Naturmuseums in St. Gallen dokumentiert. Beide Projekte belegen, dass die Realisierung eines Museums zu den spannendsten Entwurfs-, Gestaltungs- und Vermittlungsaufgaben gehört und ohne interdisziplinären Ansatz kaum zu bewältigen ist.
Paul Knüsel
Inhalt
AKTUELL
08 WETTBEWERBE
Verbindend oder identitätsstiftend
12 PANORAMA
Frische Ideen für alten Bestand | Warum umnutzen?
16 VITRINE
Stein, ganz natürlich | Rund ums Bauen
18 SIA
Inspiration und Effizienz | Baukultur an Volksschulen | Neutrale Instanz in ortsbaulichen Fragen
23 VERANSTALTUNGEN
THEMA
24 LOKALE MUSEEN: RAUM UND INHALT
24 EIN SCHAULAGER FÜR KRIEG UND FRIEDEN
Paul Knüsel
Zeughaus und Museum – kein Widerspruch in sich, wie die Erneuerung in Solothurn beweist.
28 «AUF AUGENHÖHE MIT DER ARCHITEKTUR»
Hella Schindel, Paul Knüsel
Wer hat die Hoheit über die Räume – der Architekt oder der Szenograf?
30 DAS REPTIL AM STADTRAND
Marko Sauer
Das neue Naturmuseum in St. Gallen: ein Chamäleon mit vielen Facetten.
AUSKLANG
36 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
Ein Schaulager für Krieg und Frieden
Wie attraktiv und publikumsträchtig ist eine historische Waffensammlung? Der Kanton Solothurn wagt mit der Erneuerung des Zeughauses eine inhaltliche Auffrischung der Ausstellung. Das Resultat ist sehenswert.
Eine Kanone ist eine Kanone ist eine Kanone. Oben das Laufrohr zum Abfeuern der Kugeln und unten die Lafette, ein Holzgestell für die Bodenhaftung. Anfänglich wurden schwere Eisenkugeln abgefeuert; später folgten explosive Projektile. Und seit Erfindung der Rückstossfederung erhöhte sich die Feuerkadenz. Die Kanone ist eine Kriegswaffe, um den Tod in die feindlichen Reihen zu bringen; ein ausgefeiltes Handwerk ermöglicht dies gefahrlos und effizient. Mehr als ein halbes Dutzend Geschütze aus eidgenössischer Vergangenheit sind im Alten Zeughaus von Solothurn aufgestellt. Gleich beim Eintritt ist der Besucher mit diesen historischen Waffen und den eigenen Vorurteilen über deren Zweck konfrontiert.
Eine Halbarte ist eine Halbarte ist eine Halbarte. Die lange Holzstange hält Gegner auf sichere Distanz; die vorn angebrachte Rundklinge mit Hacken, Dorn und Spitze erlaubt wilde, verbissene Attacken. Die «Hellebarde» gehörte zur Standardausrüstung der kriegerischen und tapferen Eidgenossen. Im Zeughaus lagern weit über 400 Stück, weil Solothurn lange Zeit die Söldnerhochburg der alten Orte war. Eine Vielzahl wird hinter den Kanonen an einer Waffenwand zur Schau gestellt. Die Exponate sind archivarisch durchnummeriert; die Fülle demonstriert, wie detailreich die Unterschiede sind. Ob stechen, hauen, schlagen oder reissen: Der Waffenschmied entschied mit seinen Ideen und seinem Geschick viele Auseinandersetzungen in jüngerer Neuzeit mit. Als der Büchsenmacher mit seinen Erzeugnissen die Kriegsschauplätze zu dominieren begann, waren viele Waffengattungen plötzlich nur noch Zier.
Spektakel durch Neubauten oder Inhalte?
Ist ein Zeughaus ein Zeughaus oder ein Museum? Tatsächlich ist der Kanton Solothurn im Besitz von Waffen, die das historische Erbe vieler Konflikte der letzten vier Jahrhunderte sind. Die Sammlung gilt als einzigartig in ganz Europa. Sie wird seit über hundert Jahren im Museum Altes Zeughaus präsentiert, mitten in der Solothurner Altstadt. Doch immer weniger konnten sich für einen Besuch der Ausstellung erwärmen. Das Publikum blieb auf Waffenliebhaber und militäraffine Kreise beschränkt. Letztes Jahr nun hat der Kanton Hülle und Inhalt des lokalen Wehrmuseums entstaubt.
In der Schweiz gibt es über 1000 Museen. Keines ist wie das andere; aber alle warten auf interessierte, neugierige Besucher. Die bekanntesten präsentieren bildende Kunst und locken Publikum aus nah und fern. Zur Positionierung werden jedoch schnell ändernde Inhalte benötigt; möglichst spektakuläre Neubauten machen zusätzlich auf sich aufmerksam (vgl. TEC21 45/2016). Der Aufwand, den die öffentliche Hand und private Mäzene dafür betreiben, ist enorm. Die Investitionen dienen ebenso dem Standortmarketing wie der Förderung von Kunst und Baukultur. Daraus ergeben sich bisweilen leider abgehoben wirkende Objekte, die den Bezug zur lokalen Umgebung und zum Ausstellungsinhalt vermissen lassen.
Den Hauptharst der inländischen Museumsvielfalt bilden jedoch Häuser, die orts- und sachkundig mehr oder weniger konstante Themen aus Volkskunde, Heimatgeschichte oder Naturwissenschaft vermitteln. Viele der nur lokal oder regional bekannten Museen in der Schweiz sind voll von herausragenden Exponaten, doch ihre Inszenierung leidet meist unter bescheidenen Ressourcen. Auch das Alte Zeughaus in Solothurn mit Baujahr 1614 war ein Sorgenkind.
Vermittlung mit Dialog und Reflexion
Vor rund zehn Jahren ordnete die Solothurner Kantonsregierung deshalb einen Neustart an. Die neue Strategie leitete man aus einer überarbeiteten Museumspolitik ab; zudem sollte das Zeughaus bekannter und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Aus der mutigen Idee, nicht nur Waffen zu präsentieren, sondern auch die Kontexte zu Technik, Historie und Politik darzustellen, entstand eine Ausstellung über Wesen und Sinn der Wehrhaftigkeit. Thematisch galt es, Bezüge zur Konfliktbewältigung und zum Söldnerwesen einzufügen und formal eine Vermittlungsebene für den Dialog und die Reflexion zu ergänzen.
Für die Erneuerung von Hülle und Inhalt wurden jeweils eigene Wettbewerbe durchgeführt. 2011 gewann das Basler Gestaltungsbüro element design den Studienauftrag für die Inszenierung der Dauerausstellung. Und wenig später erkor man das Architekturbüro Edelmann Krell aus Zürich als Sieger des selektiven Auswahlverfahrens für «Umbau und Sanierung» des wuchtigen Baus mitten in der Solothurner Altstadt. Bemerkenswert ist, dass beide Entwürfe unabhängig voneinander erarbeitet wurden und sich dennoch gut zusammenfügen.
Der Coup der baulichen Sanierung ist, auf äussere Applikationen am Gebäude zu verzichten und im Gegenzug dem Innenleben einen Neuling zuzumuten: Der Erschliessungsturm, der nun den hinteren Raumbereich über alle Etagen durchstösst, hat jedoch ein vertretbares Format und ist dem bestehenden, ebenso runden Aufgang an der Ostseite nachempfunden. Letzterer steht den Ausstellungsbesucher zur Verfügung; der Einbau besteht aus Treppe und Lift für den Transport der Exponate bis in den vierten Stock. Zusätzlich zur Logistik waren allerdings auch Statik und Technik aufzurüsten und den Anforderungen an ein zeitgemässes Museum anzupassen.
Das Instandsetzen führte zu tief gehenden Eingriffen; teilweise wurde die innere Baustruktur aus Stützen und Decken sogar entkernt. Beim Wiedereinbau respektierte man das Ursprungsbild weitgehend: Um die Belastbarkeit zu erhöhen, wurden die bisherigen Stützen untereinander ausgetauscht. Und die Nivellierung der Böden ergab Zwischenräume, dank denen sich neue Leitungen und Kanäle versteckt in die Horizontale einbauen liessen.
Das Museum Altes Zeughaus wurde vor acht Jahren in das Schweizerische Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung aufgenommen. Den historischen Raumeindruck zu bewahren war ein zentrales denkmalpflegerisches Anliegen. Die Dauerausstellung erstreckt sich über drei Geschosse; darüber befindet sich Raum für Sonderveranstaltungen.
Multimedia in den Köpfen der Besucher
Jedes Geschoss umfasst einen einzigen, weiten und tiefen Raum. Mächtige Holzpfeiler tragen jeweils wuchtige Längsbalken, in einem grosszügigen Raster verteilt. Zusätzliche Querrippen stützen die Zwischendecke oben ab. Unten präsentiert sich der Boden ebenso stattlich; die meisten der mittelgrossen, rotbraunen Tonplatten sind im Originalzustand erhalten. Die beiden oberen Ausstellungsgeschosse werden über zwei bis drei Gebäudeseiten natürlich belichtet. Die quadratisch gerasterten Fenster sind in Mauerbögen eingefasst und öffnen als Nischen Ausblicke auf die Stadt.
Auch die szenografischen Interventionen nehmen die gedämpfte Ausstrahlung der Räume auf. Die Waffenwände und die in Reih und Glied posierenden Harnische passen sich dem ruhigen Innern in Dimension, Materialisierung und Haptik bestens an. Zudem sind die Exponate so locker im Raum verteilt, dass man sich bei Interesse in sie vertiefen oder ungehindert davor passieren kann. An die Wand gehängt, in den Raum gestellt oder zum Berühren: Das Waffenarsenal ist jeweils objektbezogen ausgestellt und punktuell zwischen ausreichend bis ausführlich erklärt.
Das erste Obergeschoss weitet die Vermittlungsinhalte auf die Schweizer Wehr- und Konfliktgeschichte aus. Gestalterisch wird diese Ergänzung aber zum Bruch: Zwischen die Stützen sind drei begehbare Kammern gestellt, deren verspiegelte Aussenwände ein räumliches Vexierbild erzeugen. Die Kabinen schotten innere Themenwelten ab, die nun auch multimedial vermittelte Kommentare und Erklärungen enthalten.Man lernt, wie heftig die helvetischen Glaubenskriege unter katholischen und reformierten Ständen im 16. Jahrhundert geführt wurden. Ebenso erhellend sind die Informationen über das ebenso gewalttätige wie einträgliche Söldnerwesen.
Und auch die übrigen wehrgeschichtlichen Zusammenhänge oder Anekdoten regen zum Weiterdenken an. Medizinische Bulletins über Opfer, Ansichten von historischen Strassenschlachten oder Pläne zum militärisch motivierten Städtebau runden diese spannende, niemals heroisierende Wehrschau ab. Verschwiegen wird glücklicherweise wenig. Auch darf der Besucher interagieren und seinen persönlichen Lieblings-Friedensaktivisten verewigen. Die zurückhaltende Vermittlung drängt nichts auf. Viele Objekte und eine reduzierte Auswahl an Bildern und Kommentaren erzeugen ausreichend Multimedia im eigenen Kopf.
Die grosse Sorgfalt im Umgang mit dem Bestand prägt auch die Neuinszenierung der Tagsatzung von Stans von 1481. Damals schlichtete Niklaus von Flüe einen Streit unter den alten Orten, damit sich die Städte Solothurn und Freiburg dem eidgenössischen Bündnis anschliessen konnten. Das Puppenensemble steht seit 170 Jahren im Zeughaus und ist nun mit handgefärbten Wollstoffen neu eingekleidet worden. Und auch das Gebäudecurriculum findet Platz in der erneuerten Wehrausstellung. So sind die Gravuren im Gebälk, eine Hinterlassenschaft der Handwerker, oder Tierspuren in den Tonplatten ausführlich erklärt.
Das Museum Altes Zeughaus in Solothurn war bislang ein Schaulager mit einzigartiger Waffensammlung; neuerdings ist es ein modernes, anregendes Museum und Ausstellungsexponat zugleich.TEC21, Fr., 2017.08.11
11. August 2017 Paul Knüsel
«Auf Augenhöhe mit der Architektur»
Das Museum Altes Zeughaus Solothurn wurde umgebaut und die Dauerausstellung erneuert. Der Szenograf Roger Aeschbach erklärt, welche Struktur- und Wahrnehmungsebenen die Realisierung einer Ausstellung erschweren können.
TEC21: Herr Aeschbach, Hand aufs Herz – kennen Sie den Unterschied zwischen einer Halbarte und einer Hellebarde?
Roger Aeschbach: Historiker sprechen von der Halbarte. Soweit mir bekannt, ist «Hellebarde» aber kein Fachbegriff. Warum fragen Sie?
TEC21: Sie haben die Waffen- und Wehrausstellung im Alten Zeughaus von Solothurn gestaltet. Was muss ein Szenograf über die Exponate selbst wissen?
Roger Aeschbach: Nicht jedes Detail, aber wichtige Fachkenntnisse fliessen selbstverständlich in das Präsentationskonzept ein. Beispielsweise waffengeschichtlich bedeutende Entwicklungen oder Personen, die dazu Hauptimpulse gegeben haben. Das Besondere an dieser Gestaltungsaufgabe war, dass man daraus ein historisches Designmuseum entwickeln konnte. Die Elemente der Inszenierung sind insofern die Objekte selbst sowie ihre Gestaltung, Funktion und die Materialbearbeitung.
TEC21: Eine Waffe dient kriegerischen Absichten. Hatten Sie keine Bedenken, die Besucher unmittelbar beim Eintritt ins Museum damit zu konfrontieren?
Roger Aeschbach: Der Auftakt muss sich aus den Objekten und dem Handwerk ergeben, das hinter jedem Einzelstück steckt. Denn diese sind direkt mit dem Ausstellungsort und seiner Entstehung verbunden. Wir stehen nicht in einem klassischen Kunstmuseum, sondern im Zeughaus, das seit jeher ein Massenspeicher für Waffen ist. Dazu hatten wir ursprünglich eine noch konfrontativere Situation für die Besuchenden ausgedacht, bei der alle Kanonen auf denselben Punkt gerichtet worden wären. Aber beim Herumschieben haben wir gemerkt, dass es nicht funktioniert.
Die Konfrontationsebene wird im Ausstellungsverlauf jedoch zugunsten einer eher repräsentierenden Perspektive aufgelöst. Denn die Zeughäuser sind traditionell auch zu Repräsentationszwecken benutzt worden, etwa mit dem Vorführen der Waffen von Adligen. Der Ursprung eines Wehrmuseums steckt also bereits im Zeughaus drin. Aus der historischen Architektur des Hauses wird ein weiterer Erzählstrang geknüpft, da die Räumlichkeiten ihrerseits beeindrucken und sich zur Vermittlung in dieser Ausstellung bestens eignen.
TEC21: Wie gingen Sie vor, um die Objekte in diesem selbstbewussten und lokal verankerten Gebäude angemessen zu präsentieren?
Roger Aeschbach: Die Wertschätzung des Zeughauses und die Wahrnehmung der Räume in der Bevölkerung sind besonders. Daher hatte man auch in der Politik Angst vor einer Verunstaltung. Unser Ziel war, den ursprünglichen Charakter des Rohen auch in der Art der Vermittlung und Inszenierung zu bewahren. Das Haus und die Objekte transportieren schon so viel Inhalt, dass wir auditive und visuelle Medien zurückhaltend eingesetzt haben. Doch das Haus soll nicht nur für Solothurn zentral bleiben, sondern auch ausserhalb stärker wahrgenommen werden. Daher war der Inhalt, die Wehrgeschichte der jüngeren Neuzeit, auf zeitgenössischere Art als bisher zu kommunizieren. Das Kuratorium gab zudem vor, das Zeughaus nun mit den Themen Konflikt und Konfliktbewältigung in der Museumslandschaft Schweiz zu positionieren.
TEC21: Die inhaltliche Neuausrichtung wurde für einen Studienauftrag unter Szenografen genutzt. Wie sind Sie mit der räumlichen Ausgangssituation umgegangen?
Roger Aeschbach: Es ist eine heikle Aufgabe, etwas Neues in derart wunderschöne Räume hinein zu planen. Aber bei allem Respekt braucht es manchmal den gestalterischen Bruch. Wir haben beispielsweise die verspiegelten Kabinen vorgeschlagen, damit die Vermittlung in räumlicher und inhaltlicher Distanz zum Zeughaus passieren kann. Die Wettbewerbsaufgabe bestand darin, vier solcher Themenräume zu entwerfen.
TEC21: Hatten Sie freie Hand, den Wettbewerbsentwurf eins zu eins zu realisieren?
Roger Aeschbach: Es ist erstaunlich, wie nah das Resultat am anfänglichen Entwurf bleiben konnte. Aus den vier Themenkammern im zweiten Ausstellungsgeschoss sind jedoch drei geworden. Die Reduktion ist zwar thematisch begründet, hat aber die räumliche Situation mit Sichtachsen und Lichteinfall eindeutig verbessert. Der Dialog mit den Kuratoren hat während des gesamten Umsetzungsprozesses gut geklappt, was für die komplexen räumlichen Interventionen vorteilhaft war. In unserem Berufsfeld ist der kontinuierliche Austausch jedoch üblich. Bereits in der Wettbewerbsphase diskutieren die Teilnehmer ein- bis zweimal mit den Kuratoren, damit die allenfalls länger dauernde Zusammenarbeit erprobt werden kann.
TEC21: Auf welche Periode ist eine solche Dauerausstellung konzipiert?
Roger Aeschbach: Die Gestaltung im Zeughaus kann im Prinzip für die nächsten 20 Jahre funktionieren. Auf eine Zeitlosigkeit in Gestaltung, Materialisierung, Vermittlung und Medieneinsatz wurde darum hoher Wert gelegt. Das heisst aber nicht, dass alles so bleiben muss: Ob etwa die Spiegelkabinen dem künftigen Zeitgeist gefallen, darf hinterfragt werden. Anpassungen der Einbauten sind bereits angedacht und können an den gewählten Bausystemen leicht vorgenommen werden.
TEC21: Wie hat der architektonische Erneuerungsprozess in Ihre Arbeit eingewirkt?
Roger Aeschbach: Im Zeughaus hat auch die Denkmalpflege bei der Raumgestaltung mitgeredet. Weil jede zusätzliche Partei die Komplexität erhöht und das Projekt erschwert, sind die Zuständigkeiten und das Management der Schnittstellen im Umsetzungsprozess wesentlich.
TEC21: Wie gut hat das beim Zeughaus geklappt?
Roger Aeschbach: Die interne Koordination funktionierte sehr gut. Dennoch ist unsere Arbeit meistens strukturell bedingt konfliktreich. Die Abläufe in der Museumsgestaltung und im Hochbau funktionieren anders. Ausstellungs- und Architekturprojekt sind richtigerweise organisatorisch bis hin zum Auftraggeber getrennt. Allerdings entsteht fast immer eine Zeitverschiebung zwischen den Ausführungsprogrammen. Die haustechnischen Anschlüsse erzeugen sehr schnell Druck: Kaum skizzieren wir den Gestaltungsentwurf, sind bereits definitive Anschlüsse festzulegen.
TEC21: Würde eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ausstellungsgestalter die Situation verbessern?
Roger Aeschbach: Ich habe unterschiedliche Konstellationen in der Projektorganisation erlebt. Aber selbst wenn wir zum Planungsteam gehören, das einen Architekturwettbewerb gewinnt, erfolgt die Ausführung in zwei Leistungsgruppen und läuft über verschiedene Budgets. Das Strukturproblem bleibt. Die Realisierung von Museen und Ausstellungsbauten ist jedoch hochspezifisch und fällt daher aus der Norm. Das Bauen von Schul- und Verwaltungsgebäuden lässt sich im Vergleich dazu leichter standardisieren. Zudem ist die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Gestalter auch im Alltag mit Stolpersteinen versehen.
TEC21: Was ist schwierig?
Roger Aeschbach: Eigentlich sollte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe möglich sein. Beide Disziplinen kennen sich mit Raumgestaltung aus; teilweise kann man gegenseitig von den unterschiedlichen Erfahrungen im Museumsbau profitieren. Schwierig wird es, wenn es um die Kontrolle über die Gesamtaufgabe geht.
TEC21: Verstricken sich Gestalter und Architekt im Gärtleindenken?
Roger Aeschbach: Architekten bauen schöne Räume, wenn sie ein Museum planen. Die Szenografen dagegen kommunizieren. Diese beiden Denkhaltungen können sehr verschieden und schwer vereinbar sein. Daher würde eine flexible Haltung im Ausführungsprozess die Zusammenarbeit sicher verbessern. Leider werden aber viele Museen so bestellt, dass die Signatur des Architekten erkennbar ist. Die Kehrseite davon ist, dass niemand zu fragen wagt, ob überhaupt etwas an die Wände aufgehängt werden darf. Wichtig ist daher, dass der Museumsbetreiber ein echtes Mitspracherecht im Bauprozess erhält.
Roger Aeschbach ist Designer FH, konzipiert Museen und Ausstellungen. und führt seit 23 Jahren das Büro element design, Basel. Zu den Referenzen gehört unter anderem die Erweiterung des Deutschen Literaturarchivs in Marbach bei Stuttgart.TEC21, Fr., 2017.08.11
11. August 2017 Paul Knüsel, Hella Schindel
Das Reptil am Stadtrand
Das neue Naturmuseum in St. Gallen von Meier Hug Architekten und Armon Semadeni Architekten bietet Platz und neue Möglichkeiten für die beeindruckende Sammlung des Hauses. Das Museum selbst nimmt Themen und Wesenszüge der Ausstellung auf.
Fast 140 Jahre war das Naturmuseum am Stadtpark von St. Gallen beheimatet. Architekt Johann Christoph Kunkler (1813 – 1898) entwarf das Haus im Stil der Neurenaissance, von Beginn an beherbergte es das Natur- und das Kunstmuseum. Es gilt als eines der ältesten Museen der Schweiz und zudem als eines der herausragendsten klassizistischen Gebäude. In diesen 140 Jahren erlebte das Natur- und Kunstmuseum eine wechselvolle Geschichte: Trotz seiner kunsthistorischen Bedeutung verkam das Haus zu einer Ruine – die älteren Architekten in St. Gallen erzählen gern Anekdoten, wonach man vom Keller aus den Himmel sehen konnte und die Bäume aus dem Dach sprossen –, und 1971 schloss die Stadt das Gebäude wegen Baufälligkeit. Erst nachdem 1978 mit einer Stiftung der institutionelle Rahmen für den weiteren Betrieb geschaffen war, konnte die Sanierung in Angriff genommen werden.
1987 feierte das Natur- und Kunstmuseum seine Wiedereröffnung, und die Ostschweizer überraschten mit einem mutigen, dezidiert postmodernen Projekt von Architekt Marcel Ferrier, das präzise den Nerv der damaligen Zeit traf. Doch er wies den beiden Institutionen ihren Platz im Haus zu: Erd- und Obergeschoss gehörten der Kunstgeschichte, die Naturgeschichte wurde im neu erstellten Untergeschoss untergebracht. Auch wenn die geschwungenen Räume im Untergrund unbestrittene Qualitäten aufweisen, limitierten sie doch die Entwicklung des Naturmuseums, das mit rund 300 000 Exponaten einiges mehr zu zeigen hätte – ebenso fehlte der Kunst Raum für Ausstellungen.
«3 Museen, 3 Häuser»
Ein erster Wettbewerb für die Erweiterung des Kunstmuseums von 2003 sollte die beiden Institutionen besser entflechten und mehr Platz schaffen. Dafür hätte der Stadtpark umgezont werden müssen, was jedoch an der Urne scheiterte. Die Stadt St. Gallen reagierte darauf mit einer umfassenden Vorwärtsstrategie: «3 Museen – 3 Häuser» lautete das einleuchtend klingende, aber politisch schwierig umzusetzende Credo, das neben dem Natur- und Kunstmuseum auch das benachbarte Historische und Völkerkundemuseum (HVM) umfasst.
Grob umrissen beinhaltet die Strategie, dass die drei grossen Museen der Stadt jeweils in einem eigenen Gebäude zu neuer Strahlkraft finden sollen. In einem ersten Schritt ist das HVM zu erneuern, danach folgt ein neues Naturmuseum, und zuletzt wird das Kunstmuseum in eine neue bauliche Zukunft geführt. Die ersten beiden Bausteine sind gelegt: 2014 wurde das HVM umfassend saniert, im November 2016 feierte das neue Naturmuseum seine Eröffnung, und für die Erneuerung des Kunstmuseums erfolgte bereits 2012 ein Wettbewerb. Die Umsetzung des letzten Projektbausteins muss jedoch mit der Finanzierung und der Abstimmung noch politische und gesellschaftliche Hürden nehmen.
Diese Hürden hat das neue Naturmuseum mit Bravour gemeistert: Mit fast 60 % Ja-Stimmen für den Neubau fiel der Entscheid im November 2012 deutlich aus. In diesem Glanzresultat widerspiegelt sich gewiss das Engagement der Walter-und-Verena-Spühl-Stiftung: Das Legat der beiden Ostschweizer Mäzene übernahm 13 der knapp 40 Millionen Franken teuren Baukosten. Die Summe wurde ursprünglich für die Erweiterung des Kunstmuseums gestiftet, nach dem negativen Entscheid an der Urne aber für den Umbau des Naturmuseums umgewidmet. Denn mit dem Auszug des Naturmuseums erhält auch die Kunst wieder mehr Raum. Genau vier Jahre nach der Abstimmung konnten die St. Galler ihr neues Museum erstmals besuchen.
Botanischer Garten als Nachbar
Für das Naturmuseum wurde eine Parzelle am östlichen Rand der Stadt ausgewählt. Der Ort bietet ideale Bedingungen, denn in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Botanische Garten, dessen Infrastruktur das Museum nutzt und dessen Arbeit in die Vermittlung eingebunden wird, auch wenn ihn eine Strasse trennt (Abb. unten). Doch auch ein anderer Nachbar bereichert das Programm: Zwischen der katholischen Kirche St. Maria Neudorf und dem Naturmuseum entsteht ein thematischer Park, der den Dialog zwischen Naturwissenschaften und Theologie wagt: Mit Schöpfung und Evolutionstheorie treffen hier demnächst zwei Weltanschauungen aufeinander, die kaum vereinbar scheinen. Der Titel des Museumsparks klingt vielversprechend und deutet mit einem Zitat von Max Frisch einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma an: «Der Mensch erscheint im Holozän.»
Doch umgekehrt vermag das Naturmuseum auch dem Ort selbst Impulse zu geben. Entlang der Rorschacher Strasse löst sich die Stadt langsam auf – ebenso wie die Häuserzeilen, die in St. Fiden und bis zur Haltestelle Neudorf noch geschlossen sind und danach gegen Osten immer grössere Lücken aufweisen. Eine dieser Leerstellen füllt nun das neue Naturmuseum – es bietet einen attraktiven Anziehungspunkt, bevor das Tal, in dem St. Gallen liegt, sich weitet und zum Bodensee hin abfällt.
Passgenaue Lösung für die Lücke
Um ein Projekt für diese sensible Stelle im städtischen Gefüge zu finden, führte die Stadt 2009 einen offenen Wettbewerb durch. Das Siegerprojekt der Architekten-ARGE bot eine passgenaue Lösung, die zwischen den unterschiedlichen Dimensionen vermittelt: Das Naturmuseum reiht sich ein in die Folge von grossen Gebäuden entlang der Rorschacher Strasse, zugleich reagiert es aber mit seinem aufgelösten Volumen auch auf die Körnung der Einfamilienhäuser in seinem Rücken. Durch das vor- und rückspringende Volumen und die daraus resultierenden Platzsituationen trägt das Haus dazu bei, dass ein Stück Öffentlichkeit entsteht, wo vorher eine Wiese war.
Wollte man das neue Naturmuseum als ein Lebewesen beschreiben, dann gewiss als Chamäleon: Das bewegte Dach gleicht dem gezackten Rücken der exotischen Echse; dank den Kanneluren im Sichtbeton der Fassaden ändert das Haus mit dem Lauf der Sonne seinen Ausdruck, so wie das Reptil die Farbe seiner Haut wechselt; und so mannigfaltig, wie das Chamäleon in Erscheinung tritt, so vielgestaltig sind die Räume, die das Naturmuseum in St. Gallen bietet.
In einem intelligent angelegten Rundlauf, der über Split-Levels durch das Haus führt, bietet das Museum vielfältige Sammlungen: Die erste Ausstellungsebene bietet Raum für Wechselausstellungen, in den oberen Geschossen ist die Dauerausstellung beheimatet. Dabei evoziert das Museum auch in seinem räumlichen Reichtum die Natur: Analog zu einer Landschaft ändern sich die Höhe der Räume und deren Topografie. Wie bei einer Bergwanderung wechseln sich enge und weite Säle ab: Die beiden eindrücklichsten und wichtigsten Räume sind das Foyer mit der Cafeteria und der grosse Saal rund um das Kantonsmodell. Von einer Galerie aus lässt es sich in der Übersicht betrachten, auf den Wänden rundherum bindet eine expressive Wandmalerei die Exponate ein, die rund um das Modell aufgestellt sind.
Split-Levels im Innern
Im Gebäudeinnern überrascht die Ausrichtung der grossen Räume: Während von aussen betrachtet die wie aus einem Extruder gepressten, lang gezogenen Giebeldächer eine Ost-West-Richtung vorgeben, entwickeln sich die Split-Levels orthogonal dazu. In den unteren Geschossen kommt dies noch nicht zum Tragen, da die Geschossdecken nicht gerichtet sind. Doch im stützenlosen Oberlichtsaal, wo der Dachverlauf sichtbar ist, verwirrt diese Drehung der Räume: Die statische Struktur scheint der räumlichen Typologie entgegenzulaufen. Doch dies sind Irritationen für Eingeweihte – die Säle mit den prägenden Oberlichtbändern schaffen Raum für die Ausstellung, und besonders das riesige Dinosaurierskelett kommt wunderbar zur Geltung.
Das Naturmuseum St. Gallen ist berühmt für seine Präparate und die Sammlung: Das fast fünf Meter lange Nilkrokodil (mit dem 1623 die Sammlung begann), der Höhlenbär vom Wildkirchli und das Formicarium, ein lebender Ameisenberg, sind bekannte Highlights und Publikumsmagnete unter den über 300 000 Sammlungsstücken. Neu kommt das 37 m² grosse Kantonsrelief im Massstab 1 : 10 000 hinzu, auf dem die Topografie der Region dargestellt ist und auf dem mit Teleskopen verschiedene Informationen abgerufen werden können. Diese reiche Sammlung konnte im Kunklerbau kaum je gezeigt werden, die Räume waren dafür schlicht zu eng. Zudem sind die Ansprüche des Publikums an die Ausstellungsgestaltung gestiegen und die Aufgaben des Museums in seiner wissenschaftlichen Dokumentation sowie der Vermittlung von Wissen enorm angewachsen.
Zwischen Natur und Künstlichkeit
Das Museum soll die Vielfalt der Natur darstellen und die Zusammenhänge erklären. Dies beginnt bereits beim Gebäude: Es spielt mit den Begriffen Natur und Künstlichkeit und macht dies bereits mit dem Baumaterial zum Thema. Die Fassaden bestehen aus Sichtbeton, in den öffentlichen Räumen im Erd- und ersten Obergeschoss sind die Wände mit Nagelfluh aus Süddeutschland belegt – einem natürlichen Gesteinskonglomerat, in dem wie beim Beton einzelne Kiesel und Geröll in einer feinkörnigen Matrix stecken.
Innerhalb der anregenden Raumfolge des Museums bieten inszenierte Themenwelten kleine Lernräume, in denen die Exponate Teil einer Rauminstallation werden. Die Zeiten, in denen ausgestopfte Tiere in neutralen Vitrinen präsentiert werden, scheinen definitiv vorbei zu sein. Auch ein Museum vermittelt das Wissen an seine Besucherinnen und Besucher mit ausgeklügelten Geschichten und erlebnisorientiert: Die Inhalte sind interaktiv und atmosphärisch verpackt, sei es als Höhle des Bären oder als mit Kristallen versetzte Felsgrotten. Dies ist verständlich, da die Museen in harter Konkurrenz zueinander stehen – formal betrachtet geht die verspielte Ausstellungsarchitektur von 2nd West jedoch kaum auf den räumlichen Reichtum ein, den das Haus ihr bieten würde. Die beiden Elemente kommen sich zwar nah, werden aber selten eins. Der Besucher fragt sich, ob nicht die Ausstellung ein integraler Teil der Architektur sein könnte, so wie es mit der Malerei rund um das Kantonsmodell gelungen ist.
Nicht nur Vermittlung, auch Forschung
Trotz der ausgeklügelten Ausstellungsarchitektur stehen jedoch immer noch die Fundstücke aus der Natur und die ausgestellten Tiere im Mittelpunkt. Solche, die sich noch bewegen, wie in der Vogelpflegestation, oder die Präparate, die kunstvoll von den Taxidermisten und Präparatorinnen im Haus hergerichtet wurden. Das Sammeln ist eine der drei Aufgaben des Museums. In den Werkstätten konservieren Fachleute die kleinen und grossen Tiere, in den Kellerräumen lagern die Präparate in riesigen Archivregalen.
Die Arbeit an den Exponaten erfordert ein gerüttelt Mass an Technik und gut ausgebaute Werkstätten: Im Sockelgeschoss befinden sich die Räume, in denen an den wertvollen Präparaten gearbeitet wird und wo im Mazerationsbad Enzyme die Weichteilgewebe der Kadaver für Knochenpräparate zersetzen. Ein Arbeitsbereich, der mit hohen Anforderungen an die Technik einhergeht und der sich im enormen Raumbedarf im Untergeschoss äussert. Gleich hoch waren die Ansprüche bezüglich Energievorgaben: Der Neubau erfüllt die Vorgaben des Labels Minergie-P-Eco.
Die beiden anderen Aufgaben eines Museums sind die Forschung und die Vermittlung. Im modernen, geräumigen Bürotrakt können die Angestellten ihrem Forschungsauftrag nachgehen, der grösste Teil des Museums ist jedoch der Vermittlung gewidmet: Sie belegt 2400 von total 5600 m². Der beiden Mäzene wird mit einem Vortragssaal im Erdgeschoss gedacht, der ihren Namen trägt.TEC21, Fr., 2017.08.11
11. August 2017 Marko Sauer