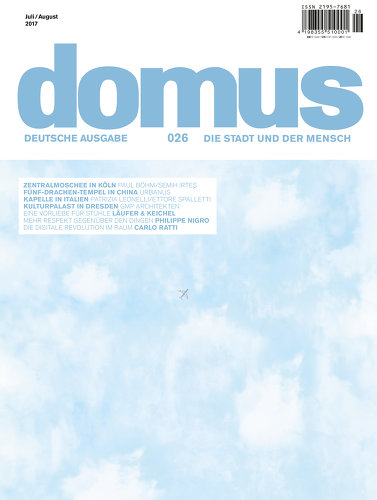Editorial
Nichts ist so persönlich wie der Glaube, nichts wird so sehr missbraucht wie die eigene, ganz persönliche Entscheidung für eine religiöse oder spirituelle Haltung. Auch wenn wir in unseren Breiten immer mehr den Glauben an Gott verlieren, hat noch nichts Vergleichbares diese Lücke füllen können. In dieser Ausgabe der deutschen Domus wollen wir uns der gebauten Manifestation des Glaubens widmen und verschiedene Typen von Sakralbauten vorstellen, aber auch dazu anregen, sich mit dem Thema vertiefend zu beschäftigen. So stellen wir zum Beispiel die Initiative der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland vor, die angesichts der vielen leer stehenden Kirchen dazu aufgerufen hat, Ideen für neue Nutzungsmöglichkeiten einzureichen - der Erhalt als Gotteshaus war dabei nicht gefordert. 500 Ideen sind zusammengekommen und werden nun in Erfurt ausgestellt.
Bis zu fünf Vorschläge sollen bis zum Ende des IBA-Thüringen-Jahres 2023 umgesetzt werden.
Mit dem Bau der Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union in Köln hat nun nach Jahrzehnten ein Prozess sein Ende gefunden, der nicht immer einfach war und in dieser Ausgabe noch einmal chronologisch nachvollzogen wird. Der Architekt Paul Böhm, jüngster Sohn des Pritzker-Preisträgers Gottfried Böhm und Enkel von Dominikus Böhm, des wohl bedeutendsten Kirchenbauers der frühen Moderne in Deutschland, hat mit seinem transparenten Kuppelbau die Moschee architektonisch in die Gegenwart überführt. Einzelne Wandscheiben wechseln sich mit großen Glasflächen ab, und der gesamte Komplex ist mittels Freitreppen öffentlich zugänglich. Tagungssäle und Gemeinschaftsräume wie die Bibliothek sollen eine Brücke schlagen zu den Menschen in der Umgebung und eine offene Haltung transportieren. Dass das Aufeinandertreffen von traditioneller Erwartung und zeitgenössischem Anspruch beim Neuentwurf eines Sakralbaus eine echte Herausforderung sein kann, hat auch Sergei Tchoban erfahren. Er entwarf die Klosterkirche St. Georg in Götschendorf für die Russisch-Orthodoxe Kirche.
Nach inhaltlich tiefgreifender Diskussion von beiden Seiten wurde eine bauliche Lösung gefunden, die sich hervorragend in eine doch eher schlichte Formensprache einfügt und somit auch heutigen ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.
Die Umgestaltung und Sanierung des Fünf-Drachen-Tempels in Ruicheng City in China stieß auf heftigen Widerstand. Der Konflikt bestand darin, dass sich die chinesische Bevölkerung nicht mit der Formensprache der Anlage identifizieren konnte.
Die Gestaltung des Tempels wurde allzu sehr als Anpassung an die westliche Ästhetik empfunden. Ein ausführlicher Kommentar im Anschluss an die Vorstellung des Projekts versucht, den Argumenten von beiden Seiten auf den Grund zu gehen.
Außerdem hat die deutsche Domus den neuen alten Kulturpalast in Dresden besucht. Der Bau gilt als herausragendes Beispiel der DDR-Moderne und erhielt nach hitzigen Debatten zu guter Letzt die Zustimmung für seine Erhaltung.
Nun haben gmp Architekten den Kulturpalast saniert und im Inneren mit einem neuen Konzertsaal ausgestattet. Dank seiner prominenten Lage mitten in der Stadt und seinem öffentlichen Nutzungspotenzial wie etwa der Bibliothek wird er auch weiterhin ein Bau für die Bevölkerung sein.
Viel Freude beim Lesen und Entdecken des Heftes! Die nächste Domus-Ausgabe erscheint am 31. August 2017.
Nancy Jehmlich