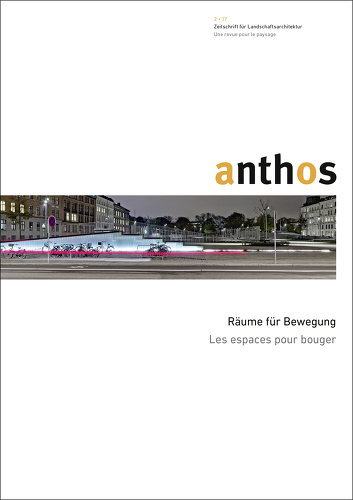Editorial
Wir räumen unsere Kinder auf, wie Geschirr in einen Schrank. Spielen dürfen sie nur in dafür vorgesehenen Bereichen, dort stehen Rutsche, Leiter, Schaukel aus dem Katalog. Drum herum ist es verdichtet, parkieren Autos. Oder sind andere Funktionen vorgesehen.
Wir waren als Kinder am liebsten auf der – verbotenen – alten Mülldeponie oder an den – ebenfalls verbotenen – Uferstreifen am nahen Fluss. Das roch nicht nur nach Abenteuer, es waren welche: Die Angriffe der Schwäne zur Brutzeit, wenn wir ihren Nestern auf der Suche nach Geheimnissen zu nahe kamen. Oder wenn wir auf der Müllhalde beim Herumklettern einbrachen, weil Plastikwannen mürbe geworden waren. Gefährlich und lehrreich. Spielplätze gab es auch, am beliebtesten war der am Bach mit einem Ausgang auf den Uferweg. Er lag abseits, Erwachsene kamen hier kaum vorbei. Es gab nur einen alten Sandkasten und drei Metallstangen, an denen wir Turnübungen machten, bis uns die Kraft in den Armen ausging.
Heute sehen Kinderspielplätze, insbesondere im Umfeld von Neubausiedlungen, häufig aus wie die Anlagen für Geissen in den Tierparks und Streichelzoos. Ein Metallzaun schützt das Innen vor dem Aussen, das Tor ist abgeschlossen, Zu- und Ausgang kontrollierbar. Die Bodenbeläge sind pflegeleicht, wischfest gewissermassen. Sandkästen sind aus der Mode – die Katzen. Klettergeräte haben überschaubare Höhen und stehen auf kaum überschaubaren Fallschutzmatten. Sie sind nach ergonomischen Richtlinien ideal für das Training eines Zwei- bis Dreijährigen ausgelegt, der einzelne Muskelpartien stärker ausbilden oder das Gleichgewicht trainieren soll. Und entsprechen den Europäischen DIN-Normen.
Zum grossen Glück aber gibt es sie dennoch: «die anderen». Konzepte wie jenes des öffentlichen Raums in Reutlingen, der gesamthaft als Bewegungsfläche mit Angeboten für alle entwickelt wird. Parcours-Sportler, die sich die Stadt für ihre Hindurch-Bewegung zunutze machen – und Zwischenräume, die sich funktionslos dazu anbieten, ohne bereits auch im ewigen Verwertungskreislauf funktionell gefangen zu sein. Vordenker wie den dänischen Architekten und Stadtplaner Jan Gehl, der in seinen Vorträgen und Publikationen schon seit den 1980er-Jahren dazu aufruft, die städtebauliche Infrastruktur und damit die Lebensqualität der Menschen, insbesondere der Fussgänger, Radfahrer, Kinder und Senioren zu verbessern.
Räume für Bewegung gibt es überall! Hier die sorgfältig gestaltete Anlage, dort den angeeigneten Ort, hier die Brache, dort den Park. Der Mix ist nicht nur für die Nutzer:innen attraktiv, auch für die kommunalen Haushalte, denn nicht jede Fläche bedeutet aufwändigen und teuren Unterhalt. Nutzen, pflegen, entwickeln und erhalten wir sie. Und tragen gemeinsam Sorge, dass sie zugänglich für alle bleiben.
Sabine Wolf
Inhalt
Dirk Schelhorn: Einfach bewegen in kommunalen Alltagsräumen!
Frode Birk Nielsen, Susanne Renée Grunkin, Pawel Antoni Lange: Der fliegende Teppich und die Hafenschule
Marie-Hélène Giraud: Öffentlicher Raum zum Spielen
Zélie Schaller: Stadtplanung für alle
Gabriela Muri, Sabine Friedrich, Dave Mischler: Bühnen für Bewegung und Begegnung
Andrea Cejka, Stefan Reimann: Plantage Potsdam
Sabine Wolf: Pingpong – Ping-pong
Rosa Diketmüller, Heide Studer: Bewegungspärke für ältere Menschen
Reto Rupf: Umweltauswirkungen von Grossanlässen
Jörg Michel: Umgestaltung des Stade Pierre-de-Coubertin
Ralf Maier: Wenn Normen und Vorlieben aufeinandertreffen
Daniel Jauslin: Quartiergarten an der Nordsee
Thomas Herrgen: Raum – Bewegung – Freiheit
Öffentlicher Raum zum Spielen
Der Bau einer neuen öffentlichen Einrichtung in Genf mit Schule, Kindertagesstätte und Schwimmbad bot die Gelegenheit, ein umfangreiches Grünflächenkonzept fertigzustellen. Seine ursprüngliche Planung geht auf das Jahr 1936 zurück und sah eine Anordnung vor, in der das Spielen seinen ganz natürlichen Platz im öffentlichen Raum findet.
Auf Anregung des Architekten Maurice Braillard erarbeitete der Kanton Genf 1936 das erste Planungsdokument, das einem Grünraumnetzwerk Vorrang gab. Unter diesen «öffentlichen Flächen oder zu klassifizierenden Standorten» sollte das Konzept der Grünachsen (Pénétrante de verdure) zum Sinnbild dieser visionären Politik werden. Ihre bedeutsame Rolle bei der Strukturierung des Geländes am rechten Seeufer wurde niemals in Frage gestellt: Durch die Abfolge kleiner Parkanlagen, die sowohl von Anrainern als auch ausdauernderen Spaziergängern besucht werden, dient die Achse heute noch als Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Hügel des Petit-Saconnex.
Dennoch blieb der Standort Chandieu lange Zeit das fehlende Glied in diesem grünen Netzwerk. Dort hatten sich zuerst Industrieunternehmen angesiedelt, danach erwarb die Stadt Genf das Gelände und nutzte es lange Zeit als Privatparkplatz. Deshalb hatte die Öffentlichkeit nie Zugang zu diesen Flächen.
Erweiterung des Achsenkonzepts
2010 beschloss die Kommune, an diesem Standort eine quartierbezogene soziale Infrastruktur zu errichten mit Kindertagesstätte, Grundschule, Schulmensa und einem Schwimmbad. Das geplante Baukonzept steht nicht im Widerspruch zu jenem der grünen Achsen, da auch die bestehenden Parks bereits Schulen beinhalteten. Da der Standort Chandieu relativ schmal ist, entpuppte sich das harmonische Einbetten der Bauten jedoch als echte Herausforderung. Die Stadt beschloss daher, einen Wettbewerb auszuloben, den 2011 die Genfer Architekten atelier bonnet in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro In Situ aus Lyon gewann.
Das fehlende Glied der grünen Achse zu restaurieren und zugleich die wichtigen baulichen Anlagen zu integrieren, schien das Hauptziel des Projekts zu sein. Für das Siegerteam ging es jedoch auch darum, einen bis dato im kollektiven Unbewussten der meisten Genfer inexistenten Ort sichtbar zu machen. Die öffentlichen Einrichtungen boten sich zudem als Gelegenheit an, dem Standort eine eigene Identität zu geben.
Potenzial genutzt
Das 2016 eingeweihte Gebäude fügt sich in einen Freiraum, der als Fortsetzung zu den bestehenden Parks in die grüne Achse integriert wurde. Entlang der Südseite erstreckt sich ein über 300 Meter langer öffentlicher Raum, der nicht nur das fehlende Bindeglied der Promenade, sondern auch den Erholungsbereich der benachbarten Wohngebäude und den Vorplatz der Schule und der Kindertagesstätte bildet. Die Verschachtelung der verschiedenen Nutzungen macht den Standort auch ausserhalb der Schulzeiten attraktiv und verwandelt ihn in das eigentliche Zentrum des neuen Viertels.
Da der Standort mehrheitlich Kindern gewidmet ist, wurde das spielerische Potenzial der offenen Flächen teilweise zur Leitlinie für deren Gestaltung. Die Promenade erhielt durch ihren Belag und die Anpflanzung von rund einhundert Schnurbäumen und Gleditschien einen städtischen Charakter. Die lockere Anordnung der Bäume ermöglicht ein gemächliches und flüssiges Schlendern. Der Raum dehnt sich aus, während er gleichzeitig durch verschiedene Nutzungsangebote bereichert wird, die teilweise fast nach häuslichen Motiven gestaltet sind: Kleine Sitzgruppen auf runden Betonteppichen laden ein, sich hinzusetzen, sein Fahrrad zu parken, auf der Terrasse eines Cafés etwas zu trinken oder auch zu spielen. Das deutsche Unternehmen Kukuk Kunst Kultur Konzeption wurde mit der Gestaltung des Spielplatzes ganz in der Nähe des Schuleingangsbereichs beauftragt. Die einmaligen Spielgeräte würdigen die Flexibilität des Werkstoffs Holz und erinnern an das Wechselspiel der Stämme entlang der Promenade.
Selbstverständlich entsprechen die Spielgeräte allen Sicherheitsnormen, doch aufgrund ihrer Höhe bringen sie die Kinder manchmal in eine knifflige Situation. Dadurch ist das Spiel nicht nur eine Möglichkeit sich körperlich auszutoben, sondern führt zu einer überlegteren und meist insgesamt koordinierteren Motorik. Die anderen Sitzecken haben ebenfalls das Potenzial, spielerisch genutzt zu werden: Drehstühle, Sitzhocker und Bänke können zweckentfremdet bespielt oder bei spontanen Bewegungsabfolgen zu Freizeitgeräten umfunktioniert werden, wie dies ab dem Jugendlichenalter beim sogenannten «Parkour» praktiziert wird. Kukuk hat auch den Innenhof der Schule gestaltet, der sich aufgrund der komplexen räumlichen Situation auf dem Dach des Schwimmbads und der Turnhalle befindet. Selbst dort stehen weder Schaukeln noch Rutschen, dafür ein kunstvolles Gewirr an gekrümmten Metallrohren, das den Kindern die Möglichkeit immer neuer akrobatischer Experimente an einem Ort bietet, den sie täglich mehrere Jahre lang besuchen werden.
Ganzheitlich und offen
Jenseits des architektonisch gelungenen Meisterstücks, ein beeindruckendes Bauprojekt und die Vollendung der grünen Achse – 80 Jahre nach der Entstehung ihres Konzeptes – in Einklang zu bringen, liegt einer der massgeblichen Erfolge der neuen Anlage darin, die Spielflächen in das physikalische, zeitliche und soziale Kontinuum des öffentlichen Raums einzugliedern. Ganz im Gegensatz zu den abgetrennten, repetitiven, monofunktionalen und oft individualistischen Räumen, die Spielplätze lange darstellten, ermöglicht es dieses Konzept eines Spielraums jedem, den Ort für sich und nach seiner Façon zu beanspruchen und die dort geltenden Regeln neu zu erfinden.anthos, Fr., 2017.05.26
26. Mai 2017 Marie-Hélène Giraud