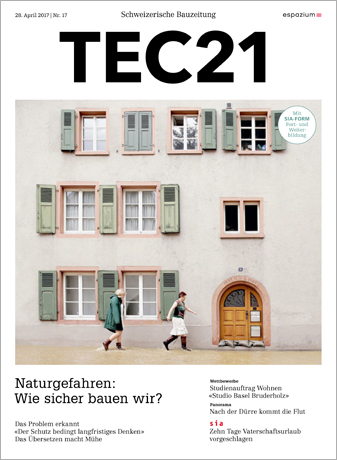Editorial
Lawinenverbauungen an Bergflanken, Geschiebesammler in Wildbächen, Erddämme an Flüssen – um Siedlungen und Verkehrswege vor drohenden Naturgefahren zu schützen, muss die Landschaft verändert werden. Die sichtbaren Eingriffe sind teilweise beeindruckend und teilweise unschön.
Weil aber diese Massnahmen im Raum nie alle Gefahren bannen können, benötigen Gebäude selbst ergänzenden Schutz. Auch hier kann der gestalterische Wurf am Einzelobjekt gelingen oder eben nicht. Allerdings wird die Ästhetik in den wenigsten Wegleitungen zum Objektschutz thematisiert.
Fachleute reden inzwischen vom «Gebäudeschutz», wundern sich aber, dass die Reduktion von elementaren Risiken beim Bauen immer noch nicht selbstverständlich ist. Der Schutz eines Gebäudes vor Naturgefahren wirkt zwar banal, trotzdem wird erst wenig umgesetzt. In einem Architekturentwurf fällt die lästige Pflicht, so scheint es, schnell zwischen Stuhl und Bank.
Fortschritte stellen sich jedoch ein, wenn die Akteure zusammenspannen. Das Ziel der Eigentümer, Baufachleute, Bewilligungsbehörden und den Gebäudeversicherungen muss sein, den Gebäudeschutz als eine gemeinsame Aufgabe zu verstehen. Gesetz und Behörde wollen bekannte Risiken eindämmen. Sie geben aber lediglich vor, wie hoch das Schutzniveau ist. Kann das sichere Bauen daher nicht auch ein Resultat sein, das clevere Konzepte mit einem hohen Gestaltungsanspruch verbindet?
Lukas Denzler, Paul Knüsel
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Tarnung Einfamilienhaus
10 PANORAMA
Nach der Dürre kommt die Flut | Gepflegte Natur auf künstlicher Basis | Buchbesprechung
15 VITRINE
Euroluce Milano 2017 | Weiterbildung
18 SIA
Forstexpertin mit vielseitigen Engagements | SIA-Form Fort- und Weiterbildung |
Zehn Tage Vaterschaftsurlaub vorgeschlagen | a&k – Reisen und Exkursionen
23 VERANSTALTUNGEN
THEMA
24 NATURGEFAHREN:
Wie sicher bauen wir?
24 DAS PROBLEM ERKANNT
Lukas Denzler
Elementarschäden lassen sich verhindern, wenn Risiken und Sicherheitsstandards beachtet werden.
26 «DER SCHUTZ BEDINGT LANGFRISTIGES DENKEN»
Lukas Denzler, Paul Knüsel
Im Kanton Nidwalden hat sich ein innovativer Umgang mit Naturgefahren etabliert. Ein Gespräch mit Experten.
31 DAS ÜBERSETZEN MACHT MÜHE
Paul Knüsel
Was Naturgefahren anrichten können, ist in der Schweiz fast flächendeckend simuliert. Versäumnisse entstehen trotzdem beim Bauen vor Ort.
AUSKLANG
35 STELLENINSERATE
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
«Der Schutz bedingt langfristiges Denken»
Nicht alle Regionen sind hohen Naturgefahren ausgesetzt; beim Bauen dürfen die Risiken trotzdem nicht vernachlässigt werden. Im Gespräch betonen Bau- und Präventionsfachleute zudem, wie wichtig ein lokal gut akzeptiertes Vollzugsystem ist.
TEC21: Herr Reinhard, wenn ein Bauherr ein Projekt mit Ihnen realisieren möchte, welche Rolle spielen die Naturgefahren? Wie gehen Sie vor?
Niklaus Reinhard: Als Erstes notiere ich alle Auflagen, die für das Bebauen einer Parzelle relevant sind, wie Grenzabstände, Ausnützungsziffern usw. Sind Naturgefahren im Zonenplan verzeichnet, suche ich das Gespräch mit den Fachleuten beim Kanton und in der Bauabteilung der Gemeinde, bevor ich überhaupt zu entwerfen beginne.
TEC21: Das klingt jetzt so, als wären die Naturgefahren bei Architekten und Planern angekommen. Oft hört man, die Sensibilisierung dafür sei eher gering.
Dörte Aller: Man kann nicht pauschalisieren. In Nidwalden ist viel in Bewegung; die Unwetterereignisse haben in den letzten Jahren dazu beigetragen. In anderen Kantonen ist das nicht so selbstverständlich. Naturgefahren sind zudem eher ein Bergthema. Dort treten «Gewalten» auf, die vielen zuerst in den Sinn kommen: Lawinen, Steinschlag und Murgänge. Im Mittelland sind es hingegen vielleicht nur 20 cm Hochwasser. Trotzdem sind die Schäden hoch. Ereignisse und Modellberechnungen zeigen, dass das Schadenrisiko in weniger gefährdeten Gebieten gleich hoch oder sogar höher sein kann. Zudem gibt es weitere Gefahren, die nicht in den Gefahrenkarten abgebildet sind: Sturm, Erdbeben oder Hagel.
TEC21: Was sind die wesentlichen Elemente beim Umgang mit Naturgefahren in Nidwalden?
Beat Meier: Im Kanton Nidwalden sind die Schutzziele bei Naturgefahren seit über zehn Jahren im Bau- und Zonenreglement festgehalten und für Planende ausformuliert. Wesentliche Anforderungen sind seit 2014 zudem im Baugesetz aufgeführt. Das kennen andere Kantone nicht. In Nidwalden wäre es eigentlich Aufgabe der Gemeinden, bei Baugesuchen zu kontrollieren, ob die Schutzziele eingehalten sind. In der Realität läuft das anders: Die eingehenden Baugesuche werden an die Baukoordination des Kantons weitergereicht. Diese wiederum leitet sie an die Nidwaldner Sachversicherung weiter, die für die Prüfung des Brandschutzes zuständig ist. So gelangt das Baugesuch auch auf meinen Schreibtisch, und wir prüfen die Nachweise bezüglich Naturgefahren im Auftrag der Fachkommission Naturgefahren.
In einfachen Fällen ist das schnell erledigt. Spielen aber Lawinen oder Wildbäche eine Rolle, geht das Gesuch zur Stellungnahme an das Oberforstamt, das Amt für Gefahrenmanagement oder das Amt für Raumplanung. Komplexe Fälle bespricht die Fachkommission Naturgefahren, in der die genannten Ämter und die Gebäudeversicherung vertreten sind, alle zwei Wochen. Den Entscheid über die Baugesuche fällen aber die Gemeindebehörden.
Niklaus Reinhard: Dabei ist festzuhalten, dass die Stellungnahme dieser Kommission nahezu sakrosankt ist. Nach den Vorbesprechungen gibt es in aller Regel keine Überraschungen mehr. Hier ist die Kleinheit des Gebildes Nidwalden vorteilhaft .
TEC21: Ist so ein Vorgehen für andere Kantone denkbar?
Dörte Aller: Das grundsätzlich angestrebte Sicherheitsniveau wurde in Nidwalden in einem längeren Prozess mit allen Beteiligten, dem Forst, dem Wasserbau, der Raumplanung und der Versicherung als Risikoträger ausgehandelt. Das ist überall möglich. In Nidwalden wird ziemlich genau umgesetzt, was die Plattform Naturgefahren (Planat) unter Integralem Risikomanagement versteht. Weil die Akteure die wesentlichen Elemente gemeinsam entwickelt haben, tragen das System auch alle mit. Im konkreten Fall ist jeweils ein Abwägen zwischen raumplanerischen Massnahmen und Gebäudeschutz (damit keine neuen Risiken entstehen), Schutzvorkehrungen an den Gewässern sowie der Notfallplanung erforderlich. Daher sehen die Lösungen in Nidwalden vielleicht anders aus als in anderen Kantonen.
TEC21: Welche Rolle spielt die Nidwaldner Sachversicherung als kantonale Gebäudeversicherung?
Beat Meier: Wir haben klare Kriterien und wenden sie überall gleich an. Wir erbringen auch Dienstleistungen in Form von Beratungen und haben den Vorteil, dass wir nah bei den Leuten sind. Im Gespräch kann man gemeinsam nach konstruktiven Lösungen suchen.
Dörte Aller: Oft reagieren wir erst nach schadenreichen Ereignissen, handeln also nicht vorausschauend. Nidwalden hat hingegen ein System geschaffen, das risikobasiert funktioniert.
TEC21: Was meint «risikobasiert» für Naturgefahren?
Dörte Aller: Die Gefahrenkarte zeigt beispielsweise, wie häufig und intensiv ein Gebiet überschwemmt wird oder wie häufig und stark eine Lawine auftritt. Das Risiko lässt sich aber erst ermitteln, wenn gefährdete Gebäude, Verkehrswege oder Personen betrachtet werden oder abgeschätzt wird, wie
verletzlich die Sachwerte sind. Das vermittelte Gefahrenbild ändert sich oft, sobald der Fokus auf das Risiko gerichtet ist. In Nidwalden analysierte man, welches Risiko akzeptabel ist und mit welchen Massnahmen es allenfalls reduziert werden kann.
Niklaus Reinhard: Das ist richtig. Aber ich möchte auch auf Sonderfälle hinweisen, die viele nicht verstehen. Am nordwestlichen Siedlungsrand von Stans ist der Bau eines Wohnquartiers seit vier Jahren blockiert, weil der Buoholzbach eine reale Gefahrenquelle ist (vgl. Kasten S. 30). Dieser mündet mehrere Kilometer davon entfernt bei Dallenwil in die Engelberger Aa. Tatsächlich hat die Engelberger Aa 1910 die Ebene von Stans überschwemmt. Nur kennt kein Mensch noch jemanden, der dies miterlebt hat.
Dörte Aller: Das ist genau das Problem: Es geschehen Dinge, die nicht immer im Bewusstsein sind. Ein Hochwasser mit Wiederkehrdauer von 300 Jahren entspricht beispielsweise einer Wahrscheinlichkeit von 17 % in 50 Jahren.
TEC21: Schweizweit wird abgeschätzt, dass ein Fünftel bis ein Viertel der Bauzonen von Naturgefahren betroffen sind. Was heisst das für die planerische Praxis?
Niklaus Reinhard: Am einschneidendsten wäre, dort nicht mehr zu bauen, wo die Gefahren sind. Das hätten wir aber bereits in den 1960er- oder 1940er-Jahren tun sollen. Nun bescheren uns die Naturgefahren Mehrkosten. Bezogen auf ein Objekt kostet der Erdbebenschutz aber deutlich mehr als der Hochwasserschutz.
Dörte Aller: Wirklich gravierend sind die Einschränkungen nur für wenige Flächen. Einschneidend wird es aber, wenn man erst kurz vor Baubewilligung realisiert, was zu berücksichtigen ist. Oft sind diese Massnahmen nicht wirklich wirksam. Sie kosten und sind vielfach nicht schön.
Beat Meier: Gebäudeschutz muss verhältnismässig sein. Bei bestehenden Bauten klären wir in der Regel im Schadensfall zusammen mit dem Gebäudebesitzer, was sich verbessern lässt. Bei Neu- und Umbauten bieten sich mehr und bessere Möglichkeiten. Das Problem ist, dass auch bei Neubauten immer wieder gravierende Fehler passieren.
TEC21: Was kann man gegen vermeidbare Fehler tun?
Niklaus Reinhard: Die Bauherrschaft will oft einfach Geld sparen. Der Preis einer Wohnung ist durch
den Markt gegeben. Jeder Franken, der mehr zu investieren ist, schlägt zu Buche. Und wenn später etwas passiert, hat die Bauherrschaft die Wohnungen vielleicht längst weiterverkauft. Kaum jemand investiert, damit er vielleicht in 20 Jahren kein Problem hat. Das ist ethisch durchaus diskutabel, ist aber halt so. Baut ein Bauherr hingegen für sich selber, steckt eine andere Haltung dahinter.
TEC21: Aber wie wird es selbstverständlich, die Naturgefahren beim Bauen angemessen zu berücksichtigen?
Niklaus Reinhard: Das ist primär Aufgabe von Baugesetz und Bauzonenordnung. Das Problem ist aber, wie viele Anforderungen und Auflagen mittlerweile existieren und was sie kosten. Viele Architekten und Bauherren investieren lieber in Schönes. Und nicht in Massnahmen, die mögliche Schäden in vielleicht zehn Jahren verhindern. Sich vor künftigen Gefahren zu schützen bedingt ein langfristiges Denken.
TEC21: Sind die Planenden also mit einem grundsätzlichen Problem konfrontiert?
Niklaus Reinhard: Ich versuche nur die Schwierigkeiten aufzuzeigen, Bauherren dazu zu bewegen, diesen Aspekten das nötige Gewicht zu geben. Es ist für uns Architekten schwierig, diese Aufgabe zu übernehmen. Naturgemäss interessieren uns die architektonischen Fragen zudem mehr als Naturgefahren.
Dörte Aller: Gleichzeitig erhöht sich das Risiko durch das Bauen laufend. Neue Materialien, eine dichtere Bebauung oder Tiefgaragen sind die Stichworte dazu. Viele Baufachleute sind sich gar nicht bewusst, welche Risiken entstehen, wenn Leute zum Beispiel mit dem Lift in eine Tiefgarage fahren, während diese überflutet wird. Die Architekten stellen am Anfang eines Projekts die Weichen und entscheiden, wie die Tiefgarageneinfahrt zu liegen kommt, oder positionieren das Gebäude und die einzelnen Öffnungen. Das ist nicht immer eine Kostenfrage, sondern eine planerische Aufgabe. Auch bei der Wahl von hagelsicheren Fassadenmaterialien ist ein Dialog zwischen Bauherr und Architekt nötig.
TEC21: Massnahmen zum Gebäudeschutz müssen nicht nur wirksam sein, sondern auch gestalterisch überzeugen und ins Ortsbild passen …
Dörte Aller: ... vorzugeben sind lediglich die Ziele. Etwa, bis zu welcher Wasserhöhe oder Hagelkorngrösse keine Schäden entstehen dürfen. Wie das gestalterisch erreicht wird, bleibt möglichst offen.
Niklaus Reinhard: Der Bauherr kann das beeinflussen, indem er einen gestaltungsbewussten, verantwortungsvollen Architekten beauftragt und diesen für seine Arbeit auch bezahlt. Es ist einfach so: Wenn man nicht bezahlt wird, reicht es irgendwann nicht mehr zum Denken.
Beat Meier: Und es hilft, wenn wichtige Punkte in Vorschriften festgehalten sind. Dann gibt es gar keine Diskussionen.
TEC21: Vielleicht ist gerade eine Hochwassergefährdung Ansporn, um die oft hässlichen Tiefgarageneinfahrten sorgfältig zu gestalten, beispielsweise mit dem sogenannten Nidwaldner Tor. Was für eine Geschichte steckt hinter diesem Tor?
Beat Meier: Ich ärgerte mich, dass die Kantone Aargau und Zürich stets Klappschotte verlangten. Diese klappen bei steigendem Wasserpegel automatisch auf, kosten aber 60 000 Franken. Deshalb wünschten wir uns günstigere Alternativen. Vor zwei Jahren fand eine Tagung statt, an der technische Lösungen vorgestellt wurden. Zusammen mit einem Metallbauplaner und Wasserbauingenieur aus der Region begannen wir das Nidwaldner Tor zu entwickeln. Inzwischen sind etwa 15 Tore eingebaut, und andere Kantone interessieren sich dafür. Die Kosten sind nur ein Fünftel so hoch wie die für ein Klappschott; die Pläne können übers Internet heruntergeladen werden und stehen Interessierten kostenlos zur Verfügung.
TEC21: Und funktioniert das Nidwaldner Tor?
Beat Meier: Wir haben noch keinen Ernstfall erlebt. Klar, jemand, der gerade vor Ort ist, muss das Tor aktiv schliessen. Weil es fest installiert ist, braucht es aber weder Werkzeuge noch Schlüssel. Die Chancen, dass dies funktioniert, stehen besser, als wenn in einer hektischen Situation irgendwo aufbewahrte Balken zu montieren sind. Wenn die Vorwarnzeit weniger als zwei Stunden beträgt, akzeptieren wir nur noch dieses Tor.
TEC21: Permanente Schutzvorkehrungen fügen sich nicht immer harmonisch ein. Ist ein Trend hin zu mobilen und flexiblen Schutzmassnahmen feststellbar?
Dörte Aller: Von einem Trend zu sprechen, ist übertrieben. Mobile Schutzmassnahmen stellen bei bestehenden Gebäuden manchmal die einzig verhältnismässige Lösung dar. Die Erfahrung aber zeigt. Sie sind nicht unbedingt wirksam, wenn sie nicht über eine automatische Steuerung verfügen. Das Konzept des Nidwaldner Tors ist ein guter Kompromiss. Der Grundsatz, wenn immer möglich bauliche Lösungen zu bevorzugen, gilt jedoch nach wie vor. Denkbar sind auch Kombinationen. Mit dem Anheben des Umgebungsgeländes um wenige Zentimeter gewinnt man Zeit. Im Ereignisfall hilft dies, die ergänzenden mobilen Massnahmen zu aktivieren.
TEC21: Setzen wir das Geld in der Prävention am richtigen Ort ein? Mehr als ein Drittel der durch Naturereignisse entstandenen Gebäudeschäden sind beispielsweise auf Hagel zurückzuführen.
Beat Meier: Bei Hagelschäden ist das Bewusstsein von Planern und Bauherrn leider noch sehr gering. So ist in der Regel nicht bekannt, dass bei der Nidwaldner Sachversicherung lediglich funktionale Schäden versichert sind. Für ästhetische Beeinträchtigungen besteht kein Versicherungsschutz. Im Schadensfall gibt es dann jeweils lange Gesichter.
Niklaus Reinhard: Ehrlich gesagt war mir das bisher auch nicht so richtig bewusst. Wir Architekten können das Risiko von Hagelschäden aber beeinflussen und die Bauherren darauf hinweisen.
Dörte Aller: Hagelkörner hinterlassen Spuren an Fassaden und Storen, nicht aber in den Medien, mit Ausnahme der Folgen für landwirtschaftliche Kulturen. Die wertmässig grössten Schäden entstehen aber an Autos und Gebäuden. Bauweise und Materialien haben sich über Jahrzehnte verändert. Hagelkörner mit mehr als 2 cm Durchmesser beschädigen die Fassade oder das Garagentor. Ein automatisches Hagelwarnsystem für Storen oder robustere Materialien können die Schadensempfindlichkeit jedoch reduzieren. Das Hagelregister gibt Auskunft über die Hagelwiderstände von Baumaterialien.
TEC21: Wo stehen wir beim «naturgefahrengerechten» Bauen in 20 Jahren? Was ist Ihre Vision?
Niklaus Reinhard: Das Hauptziel müsste sein, dass sich das Siedlungsgebiet nicht mehr so wie in den letzten Jahrzehnten dorthin ausdehnt, wo die Gefahren sind. Bei den Architekten hat das «naturgefahrengerechte» Bauen nicht oberste Priorität; es ist lediglich ein Thema unter vielen. Doch die Behörden werden es durchsetzen.
Beat Meier: Ich wünsche mir, dass Bauherrschaften stärker in Planungsprozesse eingebunden werden. Heute unterschreiben in der Regel Fachingenieure oder Architekten die geforderten Nachweise zu den Naturgefahren. Manchmal wissen Bauherren nichts davon, und teilweise wird es nicht verlangt. In Nidwalden müssen seit einem halben Jahr auch die Bauherren unterschreiben. Passen wir nicht auf, passiert das Gleiche wie beim Wärmenachweis: viel Bürokratie und eine oft mangelhafte Umsetzung.
Dörte Aller: Mein Wunsch ist, dass, wenn auch die Naturgefahren heute nicht oberste Priorität besitzen, weil andere Fragen dringender sind, dies auch in 20 Jahren so sein wird. Weil wir es geschafft haben, die Naturgefahren derart in die Abläufe zu integrieren, dass der Gebäudeschutz selbstverständlich ist und verhältnismässige Massnahmen eingesetzt werden. Auch hoffe ich, dass nicht noch weitere Schutzverbauungen die Landschaft verschandeln, sondern sich Gestaltungspläne und Massnahmen an den Gebäuden optimal ins Ortsbild einfügen. Zudem dürfen die Vorgaben nicht so detailliert werden wie beim Brandschutz. Gute Lösungen zum Schutz vor Naturgefahren basieren auf individuellen und auf den Kontext bezogenen Abklärungen.TEC21, Fr., 2017.04.28
28. April 2017 Lukas Denzler, Paul Knüsel