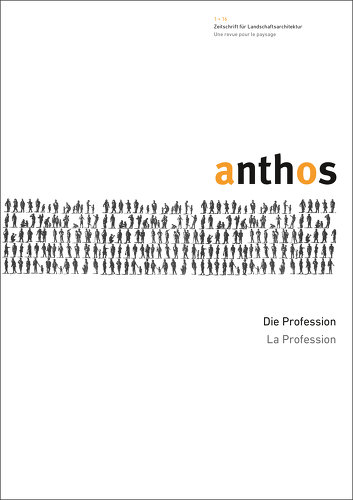Editorial
«Wer plant die Planung», fragte der Basler Lucius Burckhardt einst und erzeugte einen grossen Widerhall bei Experten wie Laien. Das Thema legte ungeahnte Emotionen frei und erregte die Gemüter. Wunderbar! Weil die Profession mit einer scheinbar naiven Frage aufgerufen war, eine Haltung zu entwickeln. Sich zu positionieren, zu diskutieren und zu verbünden.
Heute ist die Stimmung vielerorts larmoyanter denn je: Es gibt ein gravierendes strukturelles Problem, denn Innen- und Aussensicht der Landschaftsarchitekten klaffen auseinander. Während sie sich selber als Generalisten verstehen, die für die Gestaltung und Entwicklung der Landschaft in all ihren Facetten und Massstäben verantwortlich sind, werden sie von aussen als Spezialdisziplin im Bereich Freiraum-Design wahrgenommen, welcher die «Kernkompetenz Landschaft» kaum zugestanden wird. Vertreter aus Hochschulen, Büros und Behörden beklagen ein Nachwuchsproblem; bestehende Ausbildungsangebote könnten die Nachfrage weder quantitativ noch qualitativ abdecken. Umgekehrt zeigen sich junge Studienabsolventen unglücklich über die Diskrepanz zwischen Studienwissen und Praxisanforderungen.
1980 erschien die anthos-Ausgabe «Die Ausbildung des Landschaftsarchitekten». Bernd Schubert schrieb im Leitartikel, die Schweizer Garten- und Landschaftsarchitekten hätten «auf dem Gebiete der Gestaltung von Gärten und öffentlichen Anlagen ein traditionell hohes Niveau», dagegen sei die Zahl derer, die sich intensiv mit Problemen der Landschaftsplanung und -gestaltung befassten, klein und damit auch die öffentliche Anerkennung des Berufsstands auf diesem Gebiet noch immer gering. Wichtig sei die adäquate Ausbildung.
Ist seitdem nichts passiert? Doch, jede Menge! Landschaft und Freiraum sind aktueller denn je und haben die gesamtgesellschaftliche Agenda erreicht. Die Zahlen der Landschaftsarchitektur-Absolventinnen an Schweizer Hochschulen steigen – wenngleich die Versuche, einen universitären Studiengang mit entsprechenden Forschungsmöglichkeiten zu etablieren, bis heute scheiterten.
Die Qualität Schweizer Landschaftsarchitektur ist weiterhin hoch und international anerkannt.
Jetzt braucht es eine überzeugende, gemeinsame Strategie, um nicht nur die Relevanz des Themas Landschaft auf die allgemeine Tagesordnung zu bringen, sondern die Landschaftsarchitektur mit ihren Kompetenzen in der kollektiven Wahrnehmung zu verankern.
Auch mit dieser Ausgabe liefern wir keine pfannenfertigen Lösungen. Aber einen Statusbericht, auf den sich aufbauen lässt.
Für die grafische Gestaltung danken wir den Lehrenden und Studierenden von hepia, HSR und ETH, die uns aktuelles Material zur Verfügung gestellt haben.
Sabine Wolf
Inhalt
Stefan Rotzler: Der Garten hat den Menschen gemacht!
Annemarie Bucher: Zwischen Future City und Ökosystemdienstleistungen
Urs Steiger: Nachwuchsprobleme
Vincent Desprez: Landschaftsarchitekturausbildung Schweiz
Glenn Fischer: Atelier oder Durchlauferhitzer?
Emmanuelle Bonnemaison: Beruf als Leidenschaft
Sibylle Aubort Raderschall: Landschaftsarchitektur im Wettbewerb – Wettbewerb in der Landschaftsarchitektur
Nicole Wiedersheim: Landschaftsarchitekten und Architekten
Nicole Bolomey: «ZanZibar Open Spaces»
Sabine Wolf: Quo vadis, Landschaftsarchitektur?
Raphael Aeberhard: Landschaftsarchitektur zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung
Peter Wullschleger: Es geht ums Ganze
Landschaftsarchitektur im Wettbewerb
(SUBTITLE) Wettbewerb in der Landschaftsarchitektur
Während noch vor 20 Jahren Landschaftsarchitektur-Wettbewerbe Seltenheitswert hatten und das Thema Interdisziplinarität in Architekturwettbewerben kaum vorhanden war, ist unsere Profession heute mehr denn je um ihre Position gefragt. Diese Chance zur Mitsprache und Mitgestaltung unserer Baukultur gilt es zu nutzen und unsere Verantwortung darin wahrzunehmen!
Dass auch der Aussenraum, unsere gebaute und belebte Umgebung, Anspruch auf eine hohe Gestaltungsqualität hat und sich demnach Konkurrenzverfahren auch in diesem Bereich anbieten, hat sich in den letzten Jahren dank unermüdlicher Aufklärungsarbeit mehr und mehr durchgesetzt. Nichts desto trotz gibt es immer wieder wichtige öffentliche Räume, deren Gestaltung mittels Honorarofferten oder sogar in einem Direktauftrag vergeben werden. So wird nicht die beste Lösung, sondern die günstigste Leistung ermittelt und damit wichtiges Potenzial für die Qualität unserer Umwelt und den zu gestaltenden Ort verschenkt. Der Wettbewerb in der Landschaftsarchitektur muss daher immer wieder von Neuem und von jedem Einzelnen propagiert und eingefordert werden.
Bei allen Wettbewerbsverfahren liegt eine grosse Verantwortung und Einflussmöglichkeit bei den Juroren. Schon bei der Programmdiskussion ist daher ein engagiertes Mitgestalten unerlässlich, wird aber nur zu oft nicht wahrgenommen. Die im Folgenden aufgeführten Themen und noch viele weitere können so aktiv beeinflusst werden.
Einfluss von Anfang an
Bei Architekturwettbewerben stellt sich häufig die Frage, ob ausser der Architektur noch weitere Disziplinen schon im Wettbewerb zur Bearbeitung der Aufgabe beizuziehen sind und in welcher Verbindlichkeit die Teambildung verlangt werden soll. Die Antwort kann nur die Aufgabe selber geben. Ist die städtebauliche Setzung, die Qualität der Freiräume in ihrer Anlage, aber auch Ausgestaltung ein wichtiger Faktor oder liegt das zu planende Projekt in einer anspruchsvollen topografischen Lage, so muss die Landschaftsarchitektur Teil der gesuchten Lösung sein und damit sowohl zwingend im Team wie auch stimmberechtigt in der Jury vertreten sein. Dies bedeutet aber auch, dass eine Mehrfachteilnahme, wie sie so gerne von allen Seiten gefordert wird, nicht möglich ist. Wenn wir uns und unsere Disziplin ernst nehmen, können wir für die gleiche Aufgabe nicht in unterschiedlichen Teams unterschiedliche Lösungen propagieren und zur jeweils besten erklären. Nicht zuletzt kann man das als Varianten zu einer Aufgabe interpretieren, und die Abgabe von Varianten wird im Wettbewerb in der Regel ausgeschlossen.
Immer wieder wird bei diesem Thema angeführt, es gebe zu wenige Landschaftsarchitekten. Ein offener Architekturwettbewerb, bei dem die Landschaftsarchitektur wichtig und daher erforderlich ist, müsse daher entweder die Disziplin der Landschaftsarchitektur nur empfehlend erwähnen (damit der Architekt, wenn er keinen Partner mehr findet, trotzdem mitmachen kann) oder die Mehrfachteilnahme zulassen. Es ist ein Leichtes, dieses Argument zu entschärfen. Allein in der Schweiz sind beim BSLA über 200 Landschaftsarchitekturbüros registriert. Die Liste ist einsehbar, das Handbuch kann verteilt werden, und auch wenn nicht alle darin aufgeführten Kolleginnen und Kollegen Wettbewerbe bearbeiten: Es gibt genug, die es gerne tun!
Das Argument, dass auch junge Architekturbüros die Chance auf einen Auftrag bekommen sollen und deshalb der offene Wettbewerb immer wieder gefördert werden soll, gilt gerade auch in dem Zusammenhang ebenso für unsere Disziplin. Wenn leistungsfähige und wettbewerbserfahrene Büros für sich das Recht beanspruchen, in mehreren Teams mitmachen zu wollen, zum Beispiel weil sie das Wettrennen zu Beginn einer Ausschreibung satt haben und es einfacher ist, niemandem abzusagen, nehmen sie damit jedes Mal jungen, engagierten Kollegen eine Chance zur Teilnahme an einem Verfahren.
Nicht immer lässt sich eine zwingende Zusammenarbeit rechtfertigen, trotzdem kann die Mitarbeit eines Landschaftsarchitekten gewünscht sein. Damit freiwillig beigezogene Fachplaner, und dies gilt für alle Disziplinen, trotzdem nach einem Wettbewerbsgewinn zu dem ihnen zustehenden Auftrag kommen können, muss die Jury in ihrem Bericht zum Siegerprojekt explizit die Qualitäten auch der Beiträge der Fachplaner würdigen. Dies muss schon im Programm festgehalten und so beschrieben sein, sonst hat der Auslober auch bei gutem Willen nicht die Möglichkeit, einen Fachplaner, der nicht zwingend im Team verlangt war und dessen Auftragsvolumen über dem Schwellenwert liegt, aufgrund des Wettbewerbsgewinnes freihändig zu beauftragen. Dies gilt im Prinzip nur für Verfahren im öffentlichen Beschaffungswesen, also Konkurrenzverfahren der öffentlichen Hand. Es empfiehlt sich aber, diese Regeln auch in allen anderen Verfahren so festzuhalten, um den Folgeauftrag für alle im Gewinnerteam massgeblich beteiligten Disziplinen zu sichern.
Der SIA hat sich eingehend mit der Beschaffung von Planerleistungen beschäftigt und vor 135 Jahren erste Regeln für die Durchführung von Wettbewerben herausgegeben. In der Folge wurde daraus ein Regelwerk für die Beschaffung von Architektur- und Ingenieurleistungen, das sich bewährt hat und breit anerkannt ist. Die Grundprinzipien Gleichbehandlung und Transparenz, fachkompetente Beurteilung, Entschädigung, Urheberrecht und Weiterbeauftragung sind darin verankert und geregelt. Es lohnt sich für alle Beteiligten von Konkurrenzverfahren, auf diese bewährten Ordnungen 142 für Wettbewerbe (anonyme Verfahren) und 143 für Studienaufträge (alle nicht anonymen Verfahren) zurückzugreifen. Wegleitungen zu unterschiedlichen Themen erläutern und ergänzen das Regelwerk.
Mit Engagement und der Wahrnehmung unserer Verantwortung haben wir es in der Hand, den hohen Stand, den das Wettbewerbswesen in der Schweiz heute immer noch geniesst, zu bewahren und kontinuierlich auszubauen. Dafür müssen wir aber als Teilnehmer kritisch sein und nicht jedes Verfahren akzeptieren; und als Juroren ist es unsere Pflicht, uns schon in der Diskussion des Programms engagiert für die Fairness und das gute Gelingen der Verfahren einzusetzen.anthos, Mo., 2016.12.05
05. Dezember 2016 Sibylle Aubort Raderschall