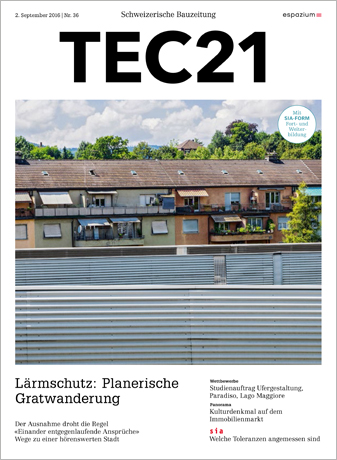Editorial
Viel Lärm um nichts? Dreimal schon haben hohe Gerichte in diesem Jahr über das Ruhebedürfnis der Wohnbevölkerung entschieden. Im ersten Fall darf das Kirchengeläut einer Zürcher Gemeinde nur noch die vollen Stunden zählen, obwohl die geltenden Grenzwerte auch sonst eingehalten worden wären. Und mit den beiden anderen Urteilen pfiff das Bundesgericht diejenigen Kantone zurück, die die Lärmbeurteilung von Neubauten etwas gar freizügig vorgenommen hatten. Das Präjudiz stoppt die «Lüftungsfenster»-Bewilligungspraxis, die sich zur Siedlungsverdichtung eingebürgt hat. Die Richter weisen also jegliche Kompromisse beim Lärmschutz ab. Die Gesundheit gehe auf jeden Fall vor; schlafende Anwohner seien zwingend vor störenden Geräuschen zu schützen. Mit den neuesten medizinischen Befunden, dass Lärm krank macht, stimmt dies auf jeden Fall überein.
Nach diesen teilweise noch nicht rechtskräftigen Richtersprüchen wäre nun eigentlich die Politik um eine ebenso eindeutige Haltung gefragt: Das wirkungsvollste Mittel gegen Lärm ist das Eindämmen der Schallquellen. Wie lang es dauert, bis Strassen ruhiger werden, soll hier aber nicht weiter ausgeführt werden. In der aktuellen Ausgabe interessiert viel mehr, was diese juristisch forcierte Pattsituation für die Planung vor Ort bedeutet. Architektinnen und Städtebauer üben sich längst in einem Spagat, um die teilweise gegensätzlichen Ansprüche und Vorschriften im Sinn der Bewohnerschaft erfüllen zu können.
Paul Knüsel
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Ein neues Ufer für Paradiso
12 PANORAMA
Kulturdenkmal auf dem Immobilienmarkt | Dreimal auf Holz geklopft | Le Corbusiers Werk ist Welterbe – teilweise | Bibliothek mit Durchblick
20 VITRINE
Messe Bauen & Modernisieren | Neues aus der Baubranche
23 SIA
Welche Toleranzen angemessen sind | Beitritte zum SIA im 2. Quartal 2016 | SIA-Form Fort-und Weiterbildung
29 VERANSTALTUNGEN
THEMA
30 LÄRMSCHUTZ: PLANERISCHE GRATWANDERUNG
30 DER AUSNAHME DROHT DIE REGEL
Paul Knüsel
Die «Lüftungsfensterpraxis» ist nicht rechtskonform. Wie geht es weiter mit dem lokalen Vollzug zum Lärmschutz?
34 VEINANDER ENTGEGENLAUFENDE ANSPRÜCHE»
Paul Knüsel
Ein Gespräch mit dem Architekten Urs Primas über typische und knifflige Entwurfsstrategien bei lärmexponierten Bauten.
38 WEGE ZU EINER HÖRENSWERTEN STADT
Ulrike Sturm, Matthias Bürgin
Lärm ist messbar; die Wahrnehmung von Klängen wird dagegen zur Kartierungsaufgabe. Über ein interdisziplinäres Forschungsprojekt des Bundes.
AUSKLANG
42 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
«Einander entgegenlaufende Ansprüche»
Die Schwierigkeiten im Lärmschutz beginnen beim Entwurf: Die Schallausbreitung kann wirkungsvoll über die Siedlungsstruktur, die Gebäudeform und den Wohnungsgrundriss beeinflusst werden. Architekt Urs Primas warnt zwar davor, dass die Bauaufgabe überdeterminiert wird, dennoch erkennt er inspirierende Elemente.
TEC21: Herr Primas, Ihr Büro hat vor Kurzem das Projekt «Zwicky Süd» in Dübendorf realisiert (vgl. TEC21 9–10/2016: Wohnen in verzwickter Lage). Die Genossenschaftssiedlung ist stark mit Lärm belastet: Auf einer Seite fährt die S-Bahn vorbei; an einer anderen passiert der Autobahnzubringer. Wie wird das Gebot des «ruhigen Wohnens» bei dieser Überbauung sichergestellt?
Urs Primas: Effektiv ist das gesamte Grundstück von Lärmquellen umringt. Daraus entsteht ein beispielhafter Konflikt zur guten Erschliessung mit einer vielfältigen Verkehrsinfrastruktur aus Autobahn, S-Bahn oder Glattalbahn. Die Beurteilung der Lärmbelastung war deshalb äusserst komplex: Anhand von dreidimensionalen Lärmmodellen musste etwa die Überlagerung der unterschiedlichen Schallquellen berechnet werden.
Zudem waren die Anforderungen an den Lärmschutz in dieser unbebauten Zone höher als in einem bebauten Gebiet. Es waren die Planungswerte einzuhalten, die niedriger als die Immissionsgrenzwerte sind. Die Modellierungen der Lärmbelastung haben zu einem iterativen Entwurfsablauf geführt, bei dem die Gebäudekörper jeweils unterschiedlich gesetzt und verschoben worden sind.
TEC21: Wie sieht die Lärmschutzstrategie bei der Gebäude- und Wohnungstypologisierung aus?
Urs Primas: Grundsätzlich sind die tiefen, energetisch und ökonomisch sehr effizienten Gebäude ins Innere des Areals gewandert; der Aussenlärm wird von extrem dünnen Bauten abgeschirmt. Letztere sind mit beidseitig belüftbaren Räumen besetzt. Weil die Lärmbelastung omnipräsent ist, mussten unterschiedliche Typen entwickelt werden, um die Grenzwerte überall einzuhalten. Beispielsweise werden Räume über Dachpatios, nach oben offene Zimmer, belüftet. Bei den durchgesteckten Wohnungen wurde in Kauf genommen, dass der Wohnraum relativ knapp bemessen ist. Daran grenzen zweiseitig orientierte Individualzimmer, die dank einer Fläche von 20 m² vielfältig nutzbar sind.
TEC21: War der «Lärmschutz» das bestimmende Thema?
Urs Primas: Tatsächlich war nicht der Lärm das ausschlaggebende Entwurfskriterium. Das verlangte Raumprogramm bestand aus einem breiten Angebotsfächer mit Grosswohnungen, Ateliers, Kleinwohnungen und sogar Hotelzimmern. Der Wunsch war, robuste Bautypen zu entwerfen, die nicht nur konventionellen Wohnungsbau ermöglichen, sondern in Bezug auf Nutzung und Funktion auch neutraler wahrgenommen werden können.
TEC21: Wie detailliert muss ein Wettbewerbsentwurf bereits auf den Lärmschutz ausgerichtet sein?
Urs Primas: Typologisch und strategisch ist vieles bereits im Wettbewerbsprogramm bestimmt. Beim Zwicky-Areal musste die Stellung der Baukörper jedoch im Vorprojekt weiter optimiert werden. Diese Verschiebungsvarianten veränderten den Ausgangsentwurf markant. Wir wollten aber weiterhin verhindern, dass das Areal räumlich abgeschottet wird. Die physischen Durchgänge und die freien Durchblicke galt es aufrechtzuerhalten, obwohl die Ränder aus Lärmschutzüberlegungen tendenziell geschlossen werden sollten. Wir haben uns am Anfang eher dagegen gesträubt, die dünnen Bauten leicht abzuknicken. Aber am Ende hat sich gezeigt, dass Gassen und Plätze im Innern des Areals so besser vor dem Verkehrslärm geschützt sind.
TEC21: Ihr Büro hat vor elf Jahren den Wettbewerb für die Genossenschaftsüberbauung «Am Grünwald» gewonnen, deren Realisierung nun vom Bundesgericht verweigert wird (vgl. Kasten unten: «Lärm-Urteil: ‹Nein, aber …›»). Auch bei diesem Projekt musste der Lärmschutz, aufgrund der benachbarten, vielbefahrenen Pendlerachsen, besonders beachtet werden. Was wäre im Vergleich zu «Zwicky Süd» anders geworden?
Urs Primas: Die Überbauung war so angelegt, dass sie sich um eine grüne Wiese gezogen hätte, die auch der Quartierbevölkerung zur Verfügung gestanden hätte. Für die Siedlung wäre dies der ruhige Raum geworden, auf den alle Wohnungen hätten orientiert werden können: Die ringförmige Gebäudestruktur schirmt den Innenhof sowie die nördlichen und östlichen Siedlungsflügel vor dem Strassenlärm ab. Zudem ist die Tiefe der Gebäudeschenkel abhängig von der Lärmbelastung, was wiederum die Entwicklung der einzelnen Wohnungsgrundrisse beeinflusst hätte.
TEC21: Das Bundesgericht setzt eigentlich eine Zäsur in der Beurteilung von Lärmschutzmassnahmen am Gebäude. Auch bei der Überbauung «Am Grünwald» ist die sogenannte Lüftungsfensterpraxis als unzureichend beurteilt worden, obwohl die lokalen Bewilligungsbehörden daran nichts auszusetzen hatten. Grundsätzlich weist aber vieles darauf hin, dass die Errungenschaften dieser Praxis durchaus Bestand haben könnten und baurechtlich vermehrt Ausnahmebewilligungen dafür erteilt werden dürfen. Wie sehr prägt der Schallschutz jeweils einen architektonischen und städtebaulichen Entwurf?
Urs Primas: Der Lärmschutz ist nie die einzige Rahmenbedingung für einen Siedlungsentwurf. Die Gebäude- und Wohnungstypologien werden aktuell unter anderem ebenso durch Energieeffizienzvorgaben, bauökonomische Aspekte und standortbezogene, topografische Vorgaben und Voraussetzungen beeinflusst. Aus der Notwendigkeit zur Lärmbekämpfung entsteht noch keine städtebauliche Grundidee. Allerdings zeigt sich, dass die Bemühungen, den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, einander entgegenlaufen können.
Vorschriften für mehr Energieeffizienz bevorzugen Gebäude mit einer gewissen Tiefe. Demgegenüber war an lärmexponierten Lagen bisher zu beachten, dass eine Wohnung quergelüftet werden kann. In der Moderne waren entsprechende, schlanke Bautiefen ja die Regel. Erst etwa seit Mitte der 1980er-Jahre entstanden kompaktere, wirtschaftlichere Volumen mit tieferen Grundrissen.
TEC21: Können Sie den Konflikt mit der Gebäudetiefe bei unterschiedlichen Ansprüchen beispielhaft erläutern?
Urs Primas: Bei Wettbewerbsentwürfen an lärmexponierten Lagen ist uns regelmässig aufgefallen, dass die Kombination der genannten Ansprüche zu einer Untergrenze für die Gebäudetiefe führt. Diese liegt, abhängig vom konkreten Projekt, ungefähr bei 10 m. Eine noch geringere Tiefe wird irgendwann in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und auch Energieeffizienz problematisch. Bei wesentlich grösseren Gebäudetiefen werden die Wohnungsflächen bei einem durchgesteckten, von der ruhigen Seite belüftbaren Grundrisstyp dagegen zu gross. Die Fassade wird auf der lärmbelasteten Seite schlecht nutzbar.
TEC21: Die Strassenfassade ist oft Thema, wenn es Städtebau und Lärmschutz einander gegenüberzustellen gilt. Wie weit darf man beim Entwurf gehen, um die Bewohner vor zu viel Aussenlärm zu schützen?
Urs Primas: Die Herausforderung besteht auf jeden Fall darin, eine schöne Strassenfassade zu entwerfen. Es ist wichtig, dass eine Gebäudefassade nicht einfach zur Lärmschutzwand wird, sondern mit dem öffentlichen Raum kommuniziert. Die Stadt hört nicht an der Fassade auf. Wenn Lärmschutzvorschriften fensterlose Fassaden erzwingen, wäre das nicht nur ein architektonisches, sondern auch ein städtebauliches Problem. Zudem geht es darum, eine verkehrsreiche Strasse als öffentlichen Raum zu aktivieren; darum die Idee, den Strassenraum zu bebauen und die Hauseingänge da zu platzieren. So lässt sich vieles mit dem Lärmschutz kombinieren.
TEC21: Aber es können sich auch gewisse gestalterische Kompromisse oder Besonderheiten ergeben?
Urs Primas: Wenn man sich um eine Bandbreite an unterschiedlichen Grundrissen bemüht, gibt es tatsächlich nicht nur ein einziges Rezept. Der Lüftungsfenstergrundriss begünstigt ein klassisches Wohnungsmuster und funktioniert gut, wenn die Lärmquelle nicht im Süden liegt. Als Alternative ist, beispielsweise bei den südseitig lärmexponierten Grünwald-Wohnungen, deshalb die Idee der Patio-Balkone entstanden: nach oben offene Aussenzimmer, die mit 2 m hohen Brüstungen versehen an der Südfassade hängen. Sie schützen vor Lärm und dienen dem Belüften der Wohnungen.
TEC21: Das Fenster in der Strassenfassade scheint ein weiterer Knackpunkt zu sein, der zu divergierenden Ansichten zwischen Lärmschutz und Städtebau führen kann. Das Verwaltungsgericht hat sich im Grünwald-Verfahren ausführlich zu den zwingenden Funktionen eines Fensters geäussert. Dass man ein Fenster öffnen soll, gehört scheinbar nicht dazu …
Urs Primas: Das Verwaltungsgericht hat grundlegende Überlegungen und Herleitungen formuliert, warum die Lüftungsfensterpraxis eine gültige Interpretation der Lärmschutzvorschriften ist. Das Bundesgericht ist nun zwar anderer Meinung, aber wenn aus baurechtlichen Gründen ein bewegliches Fenster verboten werden kann, empfinde ich das als gravierende, nicht nachvollziehbare Einschränkung für die Nutzer. Ein Fenster ist ein reichhaltiges Element und nicht einfach eine Vorrichtung mit spezifischen Funktionen, die nach strenger Auslegung von Vorschriften bestimmbar sind.
Dass Anforderungen an Schalldämmwerte festgelegt werden und eine Situation herzustellen ist, bei der man vor Lärm geschützt wird, ist durchaus verständlich. Gleichzeitig muss aber die Freiheit gewährleistet sein, das Fenster zu öffnen. Dazu gehört die Wahl, bei offenem Fenster den Lärm zu ertragen und dafür frische Luft einströmen lassen zu können. Das Fenster ist ein traditionelles architektonisches Element, das eine Beziehung zwischen innen und aussen, zwischen öffentlichem Raum und Wohnung ermöglicht.
TEC21: Ist der Lärmschutz beispielhaft dafür, dass inzwischen viele Rahmenbedingungen für das Bauen an Verdichtungslagen zu eng gefasst sind?
Urs Primas: Die Absichten einzelner Vorschriften wie Schallschutz oder Energieeffizienz sind absolut wichtig und basieren auf ernsthaften gesellschaftlichen Anliegen. Doch der Spielraum für den Entwurf wird umso geringer, je mehr im Voraus fixiert ist. Die einzelnen Auflagen können sich zum Übermass addieren; das macht das Bauen nicht einfacher und nicht günstiger. Trotzdem muss man einen Weg finden, um mit diesen Widersprüchen umzugehen. Auf übergeordneter Ebene kann es irgendwann zur Blockade kommen, wenn raumplanerisch eine Verdichtung erwünscht ist, aber die konkrete Überbauung einer Parzelle überdeterminiert wird. Einzelne Randbedingungen inspirieren nicht per se. Gleichwohl können daraus neue Typologien entstehen.
TEC21: Welche Grundrisstypologien können als Errungenschaft der Lüftungsfensterpraxis bezeichnet werden?
Urs Primas: Da wäre sicher das Wiederauftauchen von modernistischen, eher schlanken Gebäudetypen zu nennen, obwohl das nicht die einzige Lösung ist. Zudem werden tendenziell offene Grundrisse favorisiert, die man einfach querlüften kann. Die Unterteilung in viele Zimmer schafft dagegen eher Probleme. Aktuell sind Grossraumkonzepte gegenüber einem kompakten Wohnungsgrundriss mit vielen Zimmern allerdings weniger hoch im Kurs. Eine intelligente Strategie ist auch das gemischte Nutzungsprogramm. Zwar will man auch in ruhigen Verhältnissen arbeiten; aber die gesetzlichen Anforderungen sind weniger streng als beim Wohnen. Investoren scheuen sich derzeit aber vor einem hohen Gewerbeanteil, da sich dadurch das Marktrisiko erhöht.
TEC21: Wenn der raumplanerische Wille lärmbelastete Standorte verdichten will: Führt das nicht zu suboptimalen, prekären Wohnlagen?
Urs Primas: Lärm ist ja nicht der einzige Standortfaktor; auch beim stark belasteten «Zwicky Süd» nicht. Gebäude dürfen an grossen Strassen nicht einfach eine anonyme Fassade mit Badezimmerfenstern, Treppenhäusern oder Laubengängen zeigen. Auch an solchen Orten sollte die Architektur offen und lebendig bleiben. Allerdings ist kaum davon auszugehen, dass in dicht urbanisierten Regionen bald viel weniger Lärm verursacht wird.
Die Innovationen an der Quelle scheinen beschränkt. Trotzdem funktioniert die Logik, dem Autoverkehr exklusiv einzelne Bereiche zuzuweisen, nicht mehr. Den Wohnraum etwa mit Lärmschutzwänden komplett abzuschotten ist sehr unglücklich und schadet der Aufenthaltsqualität des urbanen Raums. Man muss akzeptieren, dass es den Autoverkehr gibt. Aber auch, dass an den Strassen gewohnt wird! Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung müssen da besser gegenseitig abgestimmt werden.
TEC21: Was weiss der Architekt über Lärm?
Urs Primas: Während der Erarbeitung eines Wettbewerbsentwurfs ist die Lärmabschätzung durch Experten inzwischen oft ebenso wichtig wie der Austausch mit dem Bauingenieur. Allerdings geht es dabei weniger um theoretische Aspekte der Akustik als um konkrete Modellrechnungen, um Kenntnisse der lokalen Beurteilungspraxis oder um kantonale Ausnahmeregelungen. Da der Vollzug im Lärmschutz laufend in Bewegung ist, ist die Rechts- und Planungssicherheit über verschiedene Projektphasen nicht unbedingt gegeben.
Zwischen den Projekten «Grünwald» und «Zwicky» hat sich ebenfalls viel verändert, etwa die Atriumregelung, mit der die Mindestabmessung von Innenhöfen bestimmt wird. Die vom Bundesgericht abgelehnte, bislang gültige Lüftungsfensterpraxis hat verschiedene typologische Innovationen ausgelöst. Damit sind Vor- und Nachteile verbunden. Aber es haben sich damit eine Logik und eine Sicherheit durchgesetzt. Nun gelten plötzlich andere Regeln. Zu hoffen ist, dass sich daraus eine einheitlichere Praxis in den Kantonen ergeben wird.TEC21, Fr., 2016.09.02
02. September 2016 Paul Knüsel
Wege zu einer hörenswerten Stadt
Lärm durchdringt als unsichtbarer, akustischer Nebel die Städte. Ein interdisziplinäres Team an der Hochschule Luzern untersucht, wie der Klang der Stadt verbessert und Stadträume akustisch gestaltet werden können. Als Baustein für gute Klangqualität sind die Aussenräume zu kartieren.
Bei der Akzeptanz von höherer baulicher Dichte gehört die Stadtakustik zu den wichtigsten Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Dies ergab eine Einwohnerbefragung im Kanton Zürich im Jahr 2014. Es braucht deshalb weitergehende planerische, gestalterische und architektonische Überlegungen, um die Klangqualität von urbanen Gebieten aktiv zu verbessern. Das multidisziplinäre Forschungsprojekt «Stadtklang, Wege zu einer hörenswerten Stadt»[1] will die Perspektiven zur Wahrnehmung und Gestaltung der akustischen Umwelt aufzeigen. Daran arbeiten ein Forscherteam an der Hochschule Luzern gemeinsam mit Experten des Bundesamts für Umwelt (Bafu), der Empa, kantonalen und städtischen Behörden sowie Wirtschaftspartnern.
Zum Auftakt stellt eine gleichnamige Publikation die Ausgangsthese dar: Die Situationsanalyse von Klangräumen bildet die Grundlage für eine Gestaltung von akustischen Stadt- und Siedlungsräumen. Bei solchen Analysen spielen akustische und bauliche Vorgaben ebenso eine Rolle wie subjektive Wahrnehmungen, Nutzungen und Interaktionen. Hierfür braucht es unkonventionelle, disziplinenübergreifende Kartierungsformen, die im Forschungsprojekt entwickelt werden.
Das Raumverständnis in den entwerfenden Disziplinen Architektur und Landschaftsarchitektur ist stark von einer dinglichen Auffassung geprägt: Die erfassten baulich-räumlichen Eigenschaften werden der gesellschaftlichen Wirklichkeit gegenübergestellt, anstatt sie als Teil des sozialen Gefüges zu begreifen. Die Kultur- und Sozialwissenschaften verstehen Räume dagegen als Produkt aus Wahrnehmung, Interaktion und Aneignung der Umgebung durch verschiedene Akteure und ihren gegenseitigen Beziehungen.
Interdisziplinäre Klangraumbetrachtung
Um Klangräume interdisziplinär erweitert zu betrachten, wird ein dynamisches Raummodell benötigt. Dieses bildet die gleichberechtigten Wechselwirkungen ab, die zwischen dem architektonisch gebauten, gestalteten Raum (inklusive messbarer Schallpegel), dem subjektiv erlebten akustischen Raum (inklusive moderierender Einflussfaktoren, vgl. «Stadtklang wahrnehmen») und dem Repräsentationsraum entstehen. Mit dem Repräsentationsraum sind gesellschaftliche, historische Zuschreibungen, konstruierte Bilder oder kollektive Konventionen gemeint.
Die Kartierungsaufgabe besteht nun darin, die baulich-räumlichen Komponenten, die akustischen Eigenschaften und die sinnlichen oder symbolischen Wahrnehmungselemente als Klangraum darzustellen. Ein Innenhof mit bestimmten materiellen und akustischen Eigenschaften kann beispielsweise eine klanglich angenehme Atmosphäre besitzen (erlebter Raum) und von den Nutzenden als geschützter Ruheort in der anonymen Stadt gesehen werden (Repräsentationsraum).
Ein wesentlicher Beitrag der Architektur und Landschaftsarchitektur besteht darin, geeignete Darstellungsformen für den gebauten Raum und die Wahrnehmungssituationen zu finden. Ausgehend von einer solchen Situationsanalyse können neuartige Kartierungsformen entwickelt werden, als Teil eines umfangreicheren Forschungsprojekts zur Klangraumgestaltung.
Empirische Situationsanalyse
Wie lassen sich Klangräume situativ beschreiben? Eine Situationsanalyse muss sich verschiedener Techniken und Methoden der Sozial- und Kulturwissenschaften bedienen. Möglicherweise lassen sich empirisch-ethnografische Erhebungen des erlebten Raums, Vermessungen und Normensetzungen des gebauten Raums sowie statistische Erhebungen und diskursanalytische Verfahren miteinander kombinieren.
Die Disziplinen Architektur und Landschaftsarchitektur können zusätzlich einen genuinen Beitrag leisten, der bislang in der Klangraumforschung nicht systematisch eingesetzt wurde: eine zeichnerische oder kartografische, zwei- oder dreidimensionale Erfassung und Zusammenschau der unterschiedlichen Komponenten. Zahlreiche Forschende haben sich seit den 1960er-Jahren mit der Beschreibung von Aussenräumen als Klangräume befasst. Daraus ist eine vielfältige Erfassung der akustischen Eigenschaften von Aussenräumen sowie der Wahrnehmungsdimensionen entstanden.
Neben der Soundscape-Bewegung sind die Untersuchungen im Nationalfondsprojekt NFP 25 «Stadt und Verkehr» zu einer «urbanité sonore», die aurale Architektur der Amerikaner Barry Blesser und Linda-Ruth Salter sowie die auditive Architektur der Universität der Künste Berlin zu nennen.
Unter soundscape wird, basierend auf der Theorie von Raymond Murray Schafer, das Zusammenspiel aller akustischen Erscheinungen verstanden, die sich in einem Raum und durch diesen produzieren. Die soundscape eines Orts setzt sich aus verschiedenen sound events zusammen. Für deren Aufzeichnung und Kartierung hat Murray Schafer Notationssysteme für ausgewählte Laute zusammengestellt.
Demgegenüber erfassen die Analysen im Rahmen des NFP 25 zwar Klangeigenschaften von Plätzen aus verschiedenen Hörperspektiven. Sie setzen diese jedoch nicht in Bezug zu den baulich-räumlichen Strukturen und materiellen Eigenschaften der Plätze.
In der aural architecture wird die akustische Raumwahrnehmung folgendermassen umschrieben: Jeder Klang wird von den akustischen Eigenschaften des Raums, der Umgebung und der Objekte, auf die er trifft, transformiert. Im Gegenzug bringt der Klang die Architekturen zum Erscheinen. Blesser und Salter beschreiben die menschliche Fähigkeit, Räume hörend zu erfahren und zu gestalten.
Von der Forschungsgruppe auditive Architektur wird eine architektonische Klangumwelt als eine Situation in ihrer Ganzheit definiert, «die sich durch die Wahrnehmung als Klang im Bewusstsein der Hörenden manifestiert. Eine Klangumwelt entsteht daher aus der Interaktion zwischen dem Hörenden und der Schallumgebung. Die als Gesamtheit der an dem Ort des Hörens als Klang wahrnehmbaren Schwingungsvorgänge ist konstitutiver Bestandteil erlebter Architektur.» Für die Beschreibung von Klangumwelten wird eine differenzierte Methodik angewandt, die unter anderem Schallaufnahmen mit Kunstkopftechnik, Hörprotokolle, Interviews und angeleitete Soundwalks umfasst.
In der Schweiz beschäftigen sich Andres Bosshard und Trond Maag seit Jahren intensiv mit Möglichkeiten zur Klangraumgestaltung. Sie verwenden dazu Kartierungsvarianten, bei denen die klangräumliche Situation mithilfe stilisierter Schallwellen dargestellt wird. Schallintensität und räumliche Schallausbreitung werden schematisch erfasst. Diesen Ansatz gilt es weiterzuverfolgen und für die Klangraumforschung fruchtbar zu machen.
Von Zeichen und Zeichnungen
Die Forschungsaufgabe darf vorerst spielerisch verstanden werden: Verschiedene Komponenten einer konkreten Hörsituation werden in Form von Piktogrammen perspektivisch in der baulich-räumlichen Situation dargestellt. Die Vielschichtigkeit der Analyseebenen ist dabei zentral. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit gehören folgende Elemente dazu: Schallquellen und -pegel, Stufen der Klangqualität, baulich-räumliche Konfiguration inklusive materielle Elemente der Klangartikulation. Für Kartierungen sind Messungen, Hörprotokollen und Expertenbegehungen erforderlich; zusätzlich ist zu ermitteln, wie sich baulich-gestalterische Elemente auf die Klangartikulation auswirken.
Die spielerische Herangehensweise zeigt, dass Piktogramme die komplexe Hörsituation an einem konkreten Ort entschlüsseln sowie einfach, anschaulich und rasch nachvollziehbar darstellen können. Die exemplarische Visualisierung stellt Hörsituationen in und um einen Wohnhof in Luzern dar. Sie zeigt positive Effekte wie auch neuralgische Stellen und problematische Quellen auf und gibt erste Anhaltspunkte, wo gegebenenfalls Handlungsbedarf besteht. Weiterentwickelte, verfeinerte Kartierungsformen können dazu beitragen, den Handlungs- und Gestaltungsbedarf für Hörsituationen darzustellen.
In Verbindung mit anderweitig erhobenen Daten wie Messungen und Hörprotokollen fördern sie Erkenntnisse, wo und wie eine aktive Klangraumgestaltung angestrebt werden kann. Die Absicht ist dabei nicht eine durchgehend «angenehme» Klangqualität, sondern ein differenzierter Mix unterschiedlicher Klangqualitäten, wobei die negativen Extremsituationen vermieden werden sollen. Dazu ist es in einem nächsten Schritt erforderlich, die analysierten Hörsituationen systematisch zu bewerten. Nur so entsteht ein nachvollziehbares Bild des wahrgenommenen Klangraums.
Anmerkung:
[01] Publikation «Stadtklang, Wege zu einer hörenswerten Stadt», Hochschule Luzern, Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP), vdf 2016.TEC21, Fr., 2016.09.02
02. September 2016 Ulrike Sturm, Matthias Bürgin