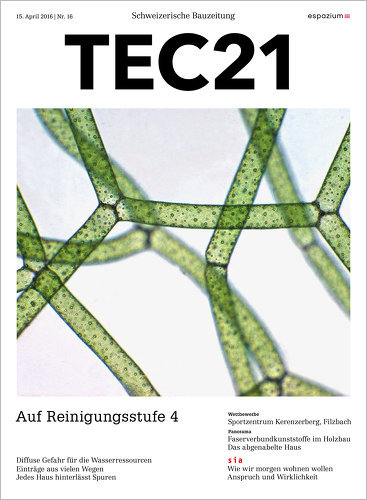Editorial
Am Anfang fischte man im trüben Wasser; dann landeten sogar Fische im Netz, deren Geschlechtsorganismus radikal verändert war. Und darum heisst der neue gesetzliche Auftrag, die Bäche, Flüsse, Seen und das Grundwasser besser zu schützen.
Zuletzt ist die Belastung vieler Gewässer zwar gesunken. Aber anstelle der Phosphate oder Nitrate gefährdet nun ein Chemikaliencocktail die aquatischen Ressourcen akut. Die Herkunft der Substanzen ist jedoch schwer greifbar; die Mikroverunreinigungen stammen nämlich aus vielerlei Quellen und alltäglichen Anwendungsfällen. Neben Medikamenten und Pflanzenschutzmitteln sind Rückstände lokalisierbar, die aus Baustoffen sowie dem Siedlungs- und Strassenraum ausgewaschen werden.
Die aktuelle Gewässerschutzaufgabe lautet daher: einerseits den weiteren Eintrag von schädlichen Spurenstoffen an der Quelle zu vermindern, wozu die Bau- und Planungsbranche als Mitverursacherin wesentlich beitragen kann; andererseits unsichtbare ökologische Schäden nachträglich beheben und die weitere Ausbreitung der chemischen Belastung stoppen. Dafür ist es zwingend, das Abwasserreinigungssystem zu verbessern.
Am effektivsten lassen sich Mikroverunreinigungen mit zusätzlicher Technik in Klärwerken eliminieren. Flankierende Massnahmen an der Quelle und in der regionalen Entwässerungsplanung können allerdings helfen, den Aufwand für neue Reinigungsstufen beträchtlich zu senken.
Paul Knüsel
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Vivace ma non troppo
11 PANORAMA
Faserverbundkunststoffe im Holzbau | Das abgenabelte Haus | TEC21 auf Facebook
14 VITRINE
Neues aus der Baubranche | Weiterbildung
17 WIE WIR MORGEN WOHNEN WOLLEN
Anspruch und Wirklichkeit | Spass am Konstruieren | Frauen in der Architektur | Wenn Ingenieure tanzen | Schadensfälle in der Geotechnik
21 VERANSTALTUNGEN
THEMA
22 AUF REINIGUNGSSTUFE 4
22 DIFFUSE GEFAHR FÜR WASSERRESSOURCEN
Christian Abegglen, Aline Meier, Pascal Wunderlin
Die Klärwerke in der Schweiz rüsten auf, um die Mikroverunreinigungen besser entfernen zu können.
25 EINTRÄGE AUS VIELEN WEGEN
Paul Knüsel
Zur effizienten Elimination der Spurenstoffe ist neben der Abwasserreinigung auch die Entwässerungsplanung zu berücksichtigen.
29 JEDES HAUS HINTERLÄSST SPUREN
Daniel Savi
Gebäude und Baustoffe sind relevante Quellen für den Eintrag von Schadstoffen in die Gewässer.
AUSKLANG
31 STELLENINSERATE
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
Diffuse Gefahr für die Wasserressourcen
Chemikalien im Haushalt, im Baubereich und in der Landwirtschaft landen früher oder später im Wasserkreislauf und beeinträchtigen die Gewässerqualität. Die grosse Aufgabe für die Abwasserreinigung ist nun, diese Spurenstoffe mit geeigneten Verfahren zu eliminieren.
Über 97 % aller Abwässer in der Schweiz werden in einer kommunalen oder überregionalen Abwasserreinigungsanlage (ARA) behandelt. Dadurch werden zwar Feststoffe, Kohlenstoff sowie Stickstoff und Phosphor effizient eliminiert, was für eine gute Wasserqualität sorgt. Aber viele organische Spurenstoffe, die beispielsweise von Arzneimitteln, Körperpflege- und Reinigungsmitteln sowie Stoffen für den Pflanzen- und Materialschutz stammen, werden nicht oder nur ungenügend entfernt. Diese sogenannten «Mikroverunreinigungen» (MV) können sich in niedrigen Konzentrationen nachteilig auf Lebewesen in Gewässern auswirken und Trinkwasserressourcen belasten. Mit dem häuslichen Abwasser gelangt eine grosse MV-Vielfalt kontinuierlich in Kläranlagen und danach in die Gewässer. Weitere MV-Einträge stammen aus Mischwasserentlastungen oder werden diffus, aber direkt in die Gewässer eingetragen, ohne vorher gereinigt werden zu können.
Hauptquelle der diffusen Mikroverunreinigungen ist die Landwirtschaft:[1] Die auf landwirtschaftlich genutzten Böden verwendeten Pflanzenschutzmittel und Biozide (Mecoprop, Diuron) verursachen regengetriebene Einträge; die Schadstoffe werden hauptsächlich durch den Regenabfluss mobilisiert und abgeschwemmt. Eine weitere diffuse Quelle ist der Siedlungsbereich, weil auch Strassen und Gebäude zu Mikroverunreinigungen in den Gewässern führen können (vgl. «Jedes Haus hinterlässt Spuren», S. 29).
Investitionsbedarf bei 1.2 Mrd. Franken
Seit 1. Januar 2016 sind das Gewässerschutzgesetz und die Gewässerschutzverordnung daran angepasst worden. Neue Vorschriften verlangen die Reduktion der Mikroverunreinigungen und sehen zusätzliche Massnahmen für eine noch zu bestimmende Auswahl unter den etwa 750 kleinen, mittelgrossen und grossen ARAs in der Schweiz vor: Eine Reinigungsstufe zur Elimination der Mikroverunreinigungen sollen erstens Grossanlagen erhalten, an die mehr als 80 000 Einwohner angeschlossen sind. Zweitens sind solche mit über 24 000 angeschlossenen Einwohnern auszubauen, wenn die Anlage im Einzugsgebiet eines Sees liegt und daher Trinkwasserressourcen zu schützen sind (vgl. «Einträge aus vielen Wegen», Seite 25). Drittens können auch ARAs in die Auswahl fallen, obwohl noch weniger Einwohner angeschlossen sind, aber sie einen hohen Abwasseranteil in einem Fliessgewässer verursachen, weshalb Pflanzen und Tiere zu schützen sind. Zur Finanzierung der Ausbaumassnahmen erhebt der Bund bei den zentralen Kläranlagen eine zeitlich beschränkte Abwasserabgabe; dadurch werden zumindest 75 % der Erstinvestitionen abgegolten.
Technische Verfahren zur Elimination der Spurenstoffe sind bereits erprobt; zwei mittelgrosse Anlagen laufen im Alltagsbetrieb (vgl. Tabelle unten): Die ARA Neugut in Dübendorf ZH verwendet seit zwei Jahren die «Ozonung» als erste grosstechnische MV-Eliminationsstufe der Schweiz. Auf der ARA Bachwis in Herisau wird seit vergangenem Sommer erstmals in der Schweiz Pulveraktivkohle (PAK) eingesetzt, um damit Mikroverunreinigungen aus dem Wasser zu eliminieren. Beide MV-Eliminationsverfahren erfüllen die gesetzlichen Vorgaben problemlos. Die Gewässerschutzverordnung verlangt einen Reinigungsgrad von 80 %, wozu die MV-Konzentration im Rohabwasser des ARA-Zulaufs mit derjenigen im Ablauf anhand ausgewählter Stoffe periodisch verglichen wird. Mit weitergehenden Reinigungsverfahren werden die ökotoxikologischen Effekte der Spurenstoffe nachweislich verringert. So wird beispielsweise die hormonaktive Wirkung eliminiert, die unter anderem zur Verweiblichung von Wasserlebenwesen führt.
Ozon oder Aktivkohle?
Auf einer ARA durchfliesst das Abwasser mechanische, chemische und biologische Reinigungsstufen. Ergänzend muss nun eine Stufe folgen, um die organischen Spurenstoffe eliminieren zu können. Dies geschieht mit Ozon oder dem Einsatz von Aktivkohle in Pulver- respektive Granulatform. Die Ozonung wird im biologisch gereinigten Abwasser durchgeführt: Gasförmiges Ozon (O3) lässt die Spurenstoffe oxidieren, wodurch sie biologisch inaktiv werden und für Lebewesen unschädlich sind. Mit der Ozonung entstehen neue Verbindungen, die auf einer nachfolgenden Filtrationsstufe biologisch abgebaut werden. Aber nicht alle Abwässer sind für das Ozonverfahren geeignet, da neue, problematische Stoffe entstehen können. Herkunft und Zusammensetzung des Abwassers abzuklären ist daher für die Verfahrensauswahl unerlässlich.
Die Reinigung mit Aktivkohle funktioniert dagegen folgendermassen:[2] Pulveraktivkohle (PAK) wird ins Abwasser eingemischt, damit sich Spurenstoffe an deren Oberfläche anlagern. Mit Sedimentation und Filtration wird die Aktivkohle wieder vom gereinigten Abwasser abgetrennt und danach zusammen mit Klärschlamm behandelt und verbrannt. Die bestehenden ARA-Reinigungsstufen sind mit diesen Eliminationsverfahren unterschiedlich kombinierbar: Die PAK kann entweder direkt in die biologische Reinigungsstufe zugegeben werden, oder die Zugabe erfolgt in einen nachgeschalteten Reaktor respektive direkt auf einen Sandfilter. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Reinigungsleistung erhöht wird, wenn mit Spurenstoffen beladene PAK in die biologische Reinigungsstufe zurückgeführt wird.
Anstelle von pulverförmiger Aktivkohle kann auch ein Granulat (GAK) eingesetzt werden. Der Vorteil: Die Entsorgung der Aktivkohle entfällt, weil das Granulat regeneriert und wiederverwendet werden kann. In diesem Regenerationsprozess werden die sorbierten Spurenstoffe verbrannt. Eignung und Wirtschaftlichkeit des GAK-Verfahrens sind nicht abschliessend geklärt. Insbesondere ist unklar, mit welcher Filtergrösse eine ausreichende Kontaktzeit gewährleistet wird, oder wie häufig die Aktivkohle auszutauschen ist.
Schweiz in einer Vorreiterrolle
Ob Ozon oder PAK: Beide Verfahren können eine breite Palette an Spurenstoffen eliminieren sowie wirtschaftlich und technisch auf bestehenden ARAs integriert und betrieben werden. Dies wurde ebenfalls an Projekten in Deutschland aufgezeigt. So sind in den Bundesländern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen auf zahlreichen kommunalen ARAs Reinigungsstufen zur Elimination von organischen Spurenstoffen installiert und getestet worden.[3] In Baden-Württemberg wird hauptsächlich die PAK-Dosierung mit anschliessender Sedimentation und Filtration realisiert. Hingegen kommt auf ARAs in Nordrhein-Westfalen die gesamte Verfahrenspalette von Ozon über PAK bis GAK zum Einsatz. Pilotanlagen und erste grosstechnische Umsetzungen werden auch in den Niederlanden, Schweden und Frankreich betrieben. Im internationalen Vergleich nimmt die Schweiz beim Ausbau von ARAs um eine zusätzliche Reinigungsstufe für organische Spurenstoffe die Vorreiterrolle ein.
Aus den hierzulande laufenden Pilotprojekten kommen ständig neue Erkenntnisse für den Betriebsalltag dazu; damit lassen sich zum einen bestehende Anlagen weiter optimieren und zum anderen die weiteren Ausbauvorhaben möglichst effizient umsetzen. Grundsätzlich sind Lösungen mit gutem Kosten-Nutzen-Verhältnis für den ARA-Betrieb anzustreben. Die Entscheidung, welches Reinigungsverfahren auf einer ARA zum Einsatz kommen soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie unter anderem von den Platzverhältnissen, der bestehenden Infrastruktur und der Zusammensetzung des Abwassers. Um den Schutz der Gewässer als Lebensraum und Trinkwasserressource wie gesetzlich verlangt zu verbessern und die Spurenstofffrachten aus dem Abwasser in die Gewässer zu reduzieren, steht den ARA-Betreibern und Kantonen genügend Zeit zur Verfügung. Die Frist für den Vollzug der MV-Reinigung läuft erst im Jahr 2040 ab.
Anmerkungen:
[01] «Mikroverunreinigungen in Fliessgewässern aus diffusen Einträgen», Braun et al.; Bafu 2015
[02] «Status quo der Erweiterung von Kläranlagen um eine Stufe zur gezielten Spurenstoffelimination», Metzger et al., Wasserwirtschaft, -technik 2015/16
[03] ARGE Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe. NRW 2015/«Organische Mikroverunreinigungen in Gewässern», Umweltbundesamt 2015TEC21, Fr., 2016.04.15
15. April 2016 Christian Abegglen, Aline Meier, Pascal Wunderlin
Einträge aus vielen Wegen
Gewisse Anteile der Mikroverunreinigungen gelangen über das Hausabwasser und die Siedlungsentwässerung in die Umwelt. Wie die Belastung erfasst und effizient reduziert werden kann, ist am Oberlauf der Dünnern im Solothurner Jura eingehend untersucht worden.
Die Dünnern ist ein 37 km langer Zufluss zur Aare mit Einmündung in Olten. Die Quelle liegt südwestlich hinter dem Solothurner Hausberg Weissenstein. Danach passiert das mittelgrosse Fliessgewässer eine ländlich geprägte Umgebung und mehrere kleine Dörfer. Bereits auf den ersten Fliesskilometern gelangt gereinigtes Auslaufwasser der ARA Welschenrohr in die Dünnern; kurz nach der Ostschlaufe quer durch die Klus bei Balsthal leitet die ARA Falkenstein ihre behandelten Wassermengen ein. Danach nimmt die Dünnern rund um Oensingen weitere Entwässerungssysteme auf, darunter das Meteorwasser der benachbarten Autobahn sowie die belasteten Frachten aus den Trennkanälen angrenzender Gewerbe- und Logistikareale. Vom Ursprung bis hierhin steigt der mittlere, natürliche Abfluss der Dünnern von 1 m³/s auf etwa 5 m³/s. Das hydrologische Einzugsgebiet umfasst insgesamt
rund 200 km2.
Phosphat, Nitrat, Nitrit und Ammoniak haben in der Vergangenheit an vielen Orten zur Überdüngung der Gewässer beigetragen. Die Frachten dieser Nährstoffe sind in den letzten Jahren aber auf ein unproblematisches Niveau gesunken. Trotzdem ist der Zustand der Dünnern im ländlichen Oberlauf als problematisch zu bezeichen. Die kantonale Umweltbehörde misst regelmässig zu hohe Konzentrationen von organischen Substanzen, insbesondere Pestizide, Biozide und weitere Mikroverunreinigungen. Mit dem Sammelbegriff Mikroverunreinigungen (MV) sind in der Schweiz rund 30 000 synthetische, organische Substanzen gemeint, darunter Arzneimittel und -reststoffe, Reinigungsmittel sowie Schutzstoffe an Gebäuden und in Baumaterialien. Öko- und humantoxikologische Analysen belegen, dass Mikroverunreinigungen schädlich für Wasserlebewesen sind. Seit 2016 hat das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer den zuvor pauschalen Vorsorgewert für organische Pestizide von 100 ng/l durch Grenzwerte für zwölf MV-Leitsubstanzen ersetzt. Die neuen Qualitätsnormen sind zudem erfüllt, wenn die ober- und unterirdischen Gewässer von mindestens 50 % der eingetragenen MV-Frachten befreit sind.
Die hohen MV-Gehalte im Dünnernwasser gefährden aber nicht nur das unmittelbare Ökosystem, sondern sie breiten sich auch in andere Umweltmilieus aus:[1] Hydrologisch ist der solothurnische Aarezufluss mit wichtigen Karstquellen im Jura verbunden. Geochemische Untersuchungen zeigen, dass über 30 % des dortigen Grundwassers aus der Dünnern infiltriert. Auch das Trinkwasser in der Region Olten speist sich aus diesem Reservoir.
Geringer Verdünnungseffekt
Das Besondere an der Dünnern ist das Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Umstände, die sich zu einer realen Umweltgefährdung entwickelt haben: Zum einen gelangt verhältnismässig viel Abwasser in die Dünnern, zum anderen führt das Fliessgewässer selbst eher wenig Wasser. Der Verdünnungseffekt auf die eingetragenen Schadstofffrachten ist daher zu gering. Weil die Mikroverunreinigungen stabil genug sind und sich bis ins Grundwasser ausbreiten, sind sie auch dort in relevanten Konzentrationen nachweisbar. Die Wasseranalytik weist inzwischen gelöste, organische Substanzen in Mikro- und Nanokonzentrationen nach. Insofern hat die Umweltbehörde des Kantons Solothurn die Dünnern als sensibles Gewässer für die Trinkwasserversorgung eingestuft; eine Reduktion oder Elimination der MV-Frachten ist zwingend anzustreben. Das Amt für Umwelt (AfU) hat die Eintragswege und -mengen bereits eingehend analysiert.
Grundsätzlich ist bekannt, dass die Belastung der Dünnern auf zwei Arten verursacht wird: Die Nährstoff- und MV-Frachten stammen sowohl aus dem behandelten Abwasser als auch aus Entwässerungskanälen, die Meteorwasser sammeln, es aber keiner Behandlung zuführen. Doch nur MV-Substanzen wie Medikamente oder Kosmetikrückstände, die beispielsweise nach der privaten, gewerblichen oder medizinischen Anwendung jeweils in das Abwassersystem gelangen, fliessen durch eine ARA, wobei sich diese Spurenstoffe mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe fast vollständig eliminieren lassen (vgl. «Diffuse Gefahr für die Wasserressourcen», S. 22). Über das Abwasser wird allerdings nur eine Minderheit der gesamten MV-Frachten in die Dünnern eingetragen. Eine von der Eawag erstellte Studie erbrachte den Lokalbefund, dass sogar 80 % der organischen Spurenstoffe diffus, aus dem Kulturland (Pflanzenschutzmittel, Biozide) und aus Siedlungsflächen (Biozide, Metalle; vgl. «Jedes Haus hinterlässt Spuren», S. 29), eingetragen werden. Eine bedeutende Quelle für die MV-Belastung in Gewässern ist daher die Siedlungsentwässerung. Werden Schadstoffe, Pestizide und Konsorten über die Mischwasserentlastung und Re-genwassereinleitung weiter verfrachtet oder wäscht Regenwasser die Stoffe selbst in kleinen Mengen aus Verkehrs-, Siedlungs- oder Grünflächen aus, lässt sich die MV-Ausbreitung kaum oder gar nicht kontrollieren. Und da sämtliche ARAs eine begrenzte Reservekapazität besitzen, kommt eine Reinigung der Regenwassereinläufe nur bedingt in Betracht. Erschwerend für die Planung von Reduktionsmassnahmen ist zudem, dass sich die diffusen, chronischen MV-Einträge aus der Strassenentwässerung und den landwirtschaftlichen Nutzflächen in einer kleinräumigen, ein einzelnes Fliessgewässer betreffenden Untersuchung kaum erheben oder in Modellen verifizieren lassen.
Befund: integrale Entwässerungsanalyse
Dennoch zeigte die Eawag-Studie auf, wie der Belastungszustand der Dünnern verbessert werden kann: Um die MV-Frachten zu reduzieren und die Infiltration ins Grundwasser zu unterbinden, genügen grundsätzlich Interventionen in das Schmutzwassersystem. Das Amt für Umwelt vertiefte die integrale Analyse der räumlichen Entwässerungssituation (vgl. Kasten S. 28) und modellierte die Eintragsfrachten für den Oberlauf der Dünnern. Zur Debatte stand ein Spektrum an Massnahmen, die sich entweder auf die Abwasserreinigung oder die Siedlungsentwässerung beschränken. Die Modellszenarien beurteilten schliesslich jenes Verbesserungspaket am wirkungsvollsten, das Anpassungen an beiden Systemen vorsieht: Die Abwasserreinigung muss mit einer Eliminationsstufe aufgerüstet werden. Und die Siedlungsentwässerung ist zumindest hydraulisch anzupassen, sodass das Rückhaltevolumen vergrössert wird.
Die ersten Entscheide für die Umsetzung der Massnahmen sind seit letztem Jahr gefällt: Die Anrainergemeinden und die Abwasserreinigungs-Zweckverbände haben in Absprache mit dem AfU beschlossen, die ARA Welschenrohr aufzuheben. Weil die Kleinanlage weitere Mängel bei der Nitrifikation besass, wäre der Ausbau zu kostspielig geworden. Stattdessen werden nun die lokalen Abwassersysteme entlang des Dünnern-Oberlaufs fusioniert. Die bestehende kleine ARA Welschenrohr wird aufgehoben und in ein Ausgleichsbecken umgewandelt, um das Abflussregime im neuen ARA-Verbund zu regulieren. Im Gegenzug wird die ARA Falkenstein/Oensingen für die MV-Elimination ausgebaut. Als Verfahren für die vierte Reinigungsstufe werden Aktivkohle oder Ozonierung geprüft. Eine Simulation für den ARA-Zusammenschluss hat gezeigt, dass der erhoffte Reduktionseffekt erreicht wird: Die MV-Frachten im behandelten ARA-Abfluss werden so weit reduziert, dass die Belastungswerte in der Dünnern teilweise um den Faktor 3 unterschritten werden können.
Noch zu leisten ist eine Analyse für die Siedlungsentwässerung: Im Rahmen der Gesamtentwässerungsplanung (GEP) muss geklärt werden, ob die Mischwasserbehandlung im erweiterten ARA-Gebiet auszubauen ist respektive wie die hydraulischen Verhältnisse in den bestehenden Sammelleitungen anzupassen sind. Weil das Trennsystem bislang über keine eigene Behandlungsanlage verfügt, sind allenfalls die Rückhaltekapazitäten in der regionalen Verbundanlage Falkenstein zu optimieren. Eine Erhöhung des Speichervolumens um rund einen Viertel genügt, damit die MV-Reinigungsstufe selbst bei starkem Regen und steigendem Meteorwasserzufluss nicht überlastet ist.
Die Modellierung des Siedlungsentwässerungssystems und der spezifischen MV-Stofffrachten weisen dennoch auf eine gewisse Wirkungsbegrenzung hin. Aufgefallen ist zum Beispiel, dass nicht alle eingetragenen Substanzen gleich stark reduziert werden können. Vor allem die «regengetriebenen» Biozide aus diffusen Quellen breiten sich weiterhin ungefasst über die Mischwasserentlastungen aus. Und weil das Abflussregime der Dünnern schwach ist, dürften einzelne, schlecht abbaubare MV-Substanzen die vom Gesetz erlaubten Schwellenwerte auch in Zukunft überschreiten.
Allerdings strebt der Kanton Solothurn auch im Unterlauf der Dünnern eine Verbesserung der MV-Situation an. Die integrale Analyse für das Entwässerungsgebiet rund um die ARA Gunzgen, etwa 10 km unterhalb der ARA Falkenstein, läuft bereits.
Anmerkung:
[01] «Mikroverunreinigungsemissionen», P. Staufer und S. Zehnder; Aqua & Gas 1/2016.
«Abwägung für viele kleine Flüsse»
TEC21: Herr Staufer, das Gewässerschutzgesetz verlangt, dass die Abwasserreinigung 80 % der Mikroverunreinigungen respektive die organischen Spurenstoffe eliminiert. Ist diese Vorgabe überhaupt realistisch?
Philipp Staufer: Das allgemeine Ziel lautet, die Belastung der Schweizer Gewässer mit dem Cocktail an Mikroverunreinigungen (MV) um 50 % zu reduzieren. Bezogen auf die Einträge durch die Abwassereinleitungen heisst das, mindestens 80 % dieser Frachten in einer ARA zu eliminieren. Dafür müssen etwa 100 Grossanlagen in der Schweiz mit einer zusätzlichen Verfahrenstufe ausgerüstet werden. Die Vorgaben sind aber erreichbar; bessere Reinigungseffekte wären dagegen mit höherem Energieeinsatz in der ARA verbunden. Die Eliminationsverfahren, entweder mit Ozon oder mit Pulveraktivkohle, sind nicht neu. Wir wissen, dass sie wirken; entsprechende Erfahrungen liegen bereits vor (vgl. «Diffuse Gefahr für die Wasserressourcen», S. 22). Die vierte Reinigungsstufe gilt daher als zentrale Massnahme für die Reduktion der MV-Belastung. Zusätzliches Optimierungspotenzial liegt meiner Meinung nach in der integralen Betrachtung der Entwässerungssysteme.
Wie sind die wirksamen Massnahmen zu planen?
Als kantonale Behörde beabsichtigen wir die Belastung der Gewässer mit effektiven und effizienten Mitteln zu reduzieren. Dazu braucht es nicht eine einzige, sondern viele kleine Massnahmen. Die Eintragspfade und -mengen der Mikroverunreinigungen sind zwar eindeutige Indizien; doch zusätzlich interessieren auch die Verdünnungseffekte im Gewässer. Denn die Verdünnung sowie die räumliche Verteilung der Einträge führen dazu, dass sich die MV-Gehalte im Wasser im Nanogrammbereich pro Liter bewegen. Solche Grössen lassen sich zwar problemlos messen. Mit derart geringen Mengen zu rechnen und verlässliche Simulationen durchzuführen wird jedoch aufwendig und unsicher. Bei Substanzen, die vor allem mit dem Regenwasser eingetragen werden, stossen wir daher schnell an technische Grenzen. Auch wirtschaftlich ist nicht alles möglich, um die Belastung zu reduzieren. Die Entwässerungssysteme mit grösseren Speichern zu versehen wäre wirksam, aber sehr teuer.
Wie lassen sich die Massnahmen auf den Abwasserreinigungsanlagen am besten mit Massnahmen in den Entwässerungssystemen verbinden?
Es braucht beide, weil sie sich räumlich und funktional gut ergänzen. ARAs leiten ihre gereinigten Abwässer mehrheitlich in ein grosses Gewässer ein. Wenn diese nun mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe ausgerüstet werden, bekommen wir einerseits diese schleichenden MV-Einträge in den Griff. Andererseits wird die MV-Belastung in kleineren Gewässern vor allem vom Regenwasserabfluss beeinflusst. Für viele kleine Bäche und Flüsse muss daher abgewogen werden, ob Massnahmen gegen den diffusen MV-Eintrag wirklich lohnenswert sind. Ich würde das etwa mit dem Prozess von Flussrenaturierungen vergleichen, wozu die jeweils angrenzenden Nutzungen dem aufzuwertenden Schutzgut gegenüberzustellen sind.
Was heisst das konkret, etwa für ein relativ kleines Fliessgewässer wie die Dünnern?
Die Dünnern ist ein solcher Fall, bei dem das Rohwasser für die Trinkwasserversorgung bedeutend ist. Obwohl keine MV-Grenzwerte überschritten sind, muss das Vorsorgeprinzip im Gewässerschutz angewendet werden. Jetzt schon aktiv zu werden beruht auch auf früheren Erfahrungen: So hat der Gewässerschutz bei der Sanierung der Nitratbelastung sehr lang zugewartet und dadurch bei der nachträglichen Behebung eine Generation und viel Geld verloren.
Wie lang dauert es, bis der Handlungsbedarf für Entwässerungssysteme abgeklärt respektive die MV-Reduktion flächendeckend umgesetzt ist?
Der Um- und Ausbau der Entwässerungssysteme kann selbstverständlich nicht auf einen Schlag erfolgen. Das Trennsystem wird im Gesetz, vor allem in neuen Gewerbezonen, deutlich bevorzugt. Bei Wohnsiedlungen ist das Mischsystem die häufigere Variante. An den wenigsten Orten ist jedoch eine Mischwasserbehandlung vorgesehen. Massnahmen an der Quelle, eben in der Siedlungsentwässerung, wären am wirksamsten. Aber weder ist eine Sanierungspflicht vorgesehen noch ist wahrscheinlich, die seit den 1970er-Jahren übliche naturnahe Regenwasserbewirtschaftung im Siedlungsbestand anzupassen. Ich hoffe jedoch darauf, dass bei der Sanierung einer ARA vermehrt das Einzugsgebiet und die Entwässerungsnetze mitbetrachtet werden. Das bezweckt das Fallbeispiel Dünnern auch: Mit einfachen Mitteln konnte das grosse Reduktionspotenzial aufgezeigt werden. Die Steuerung der Abflüsse ist beispielsweise eine wirksame Massnahme, um das Entlastungsvolumen ohne zusätzlichen baulichen Massnahmen zu verringern.
[Philipp Staufer ist Abteilungsleiter Wasser im Amt für Umwelt, Kanton Solothurn.]TEC21, Fr., 2016.04.15
15. April 2016 Paul Knüsel
Jedes Haus hinterlässt Spuren
Die Gewässerqualität wird über die Gehalte an Spurenstoffen gemessen und bewertet. Doch wie werden die Quellen erfasst? Der Mitautor einer Ökobilanzstudie über Gebäude zeigt, dass Bauzusatzstoffe stärker zu beachten sind.
Was als Mikroverunreinigungen in den Gewässern anzutreffen ist, stammt oft aus diffuser Herkunft. Vor einigen Jahren liessen allerdings Erkenntnisse der Eawag, des Wasserforschungsinstituts des ETH-Bereichs, aufhorchen, dass Siedlungsgebiete als Quelle von Biozideinträgen ebenso relevant sein können wie die Landwirtschaft.[1] Bei Letzterer ist vor allem der Pflanzenschutzmitteleinsatz schuld daran; demgegenüber tragen Gebäude zur Gewässerbelastung bei, weil das Regenwasser aus Bauteilen wie Fassade und Dach unterschiedliche Stoffspuren auswaschen kann. Aber auch Baustoffzutaten, die als Schadstoffe zuerst in die Luft entweichen oder in den Boden gelangen, können sich weiter in die Gewässer ausbreiten. Auf ein einzelnes Gebäude bezogen, sind die Mengen zwar gering; doch im gesamten Baubestand können sich diese zu bedeutenden Konzentrationen aufsummieren. In einer Auftragsarbeit für die Stadt Zürich und das Bundesamt für Umwelt sind daher erstmals die Stoffemissionen während der Nutzung von Gebäuden ermittelt worden.[2]
Das Vorgehen dafür ist: Anhand der chemischen Eigenschaften von einzelnen Stoffen oder Stoffgruppen lassen sich deren charakteristische Emissionswege bestimmen. Und ausgehend von der Zusammensetzung verschiedener Bauteile werden jeweils die stoffbezogenen Umweltauswirkungen identifiziert, quantifiziert und hinsichtlich gesetzlicher Vorschriften bewertet. Die Bilanzierung aggregiert unterschiedliche Umweltauswirkungen (Gewässerbelastungen, Emissionen von Treibhausgasen, Freisetzung humantoxischer Substanzen) und wird mit «Umweltbelastungspunkten» bemessen.
Den direktesten Weg vom Gebäude in Gewässer und Böden finden Schadstoffe, die löslich sind und daher vom Regenwasser verfrachtet werden können. Einige Baustoffe enthalten auswaschbare Biozide, zum Beispiel als Filmschutzmittel oder Konservierungsmittel in Farben und Lacken. Kunststoffprodukten oder Zellulosedämmstoffen sind vergleichbar umweltgefährdende Flammhemmer beigemischt, die dem Brandschutz dienten. Dabei handelt es sich oft um wasserlösliche Substanzen mit Brom oder Borsäure. Auch Schwermetalle sind relevant; vor allem Zink und Kupfer respektive Bauteile mit Zink- oder Kupferblech sowie verzinktem Stahlblech. Für die Umweltgefährdung der oben erwähnten Stoffe jedoch gilt: Sind sie am Gebäude vor der Witterung geschützt, können allfällige Emissionen in die Gewässer und Böden verhindert werden.
Als Problemstoffe hat die AHB-Ökobilanz ebenfalls vergangene Sünden aufgedeckt: In früher verwendeten Bauprodukten finden sich Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die bis heute in die Luft gelangen und dort mithelfen, die Ozonschicht abzubauen. Aus älteren Polymerbitumenbahnen kann zudem Mecoprop ausgewaschen werden: ein Herbizid, das als Wurzelschutz beigemischt ist. Neuere Produkte können das Pflanzengift weiterhin enthalten, geben davon allerdings deutlich weniger an das Regenwasser ab.
Produktinhalt meist unbekannt
Für Zusatzmittel und Hilfsstoffe gilt generell, dass sie aus allen Bauteilen ausgewaschen werden können, selbst aus Beton. Daher stellt sich für die verwendeten und verbauten Produkte die Frage, wie viel davon in die Umwelt gelangt, wie schnell sie abgebaut werden und wie toxisch sie für Lebewesen im Boden oder in Gewässern sind. Solche Schadstoffemissionen zu bestimmen, die in der Nutzungsphase von Gebäuden auftreten, ist allerdings alles andere als trivial. So ist zum Beispiel die vollständige Zusammensetzung von Baustoffen nie bekannt (vgl. TEC21 25/2015) respektive die Rezeptur oft nicht nachvollziehbar deklariert. Zudem sind die Emissionen während der Nutzung nur für die wenigsten Baustoffe über eine lange Zeit gemessen worden. Daher können die meisten Emissionsmengen nur aus kurzfristigen Messungen oder anhand von theoretischen Überlegungen abgeleitet werden. Entsprechend unsicher ist die Abschätzung, welche Stoffe und wie viel davon aus einem Bauteil während der Gebäudenutzung tatsächlich ausgewaschen werden oder anderweitig entweichen.
Die Ergebnisse der Ökobilanzstudie zeigen nun auf, dass die relevanten Auswirkungen von relativ wenigen Stoffgruppen verursacht werden und die Nutzungsphase für deren Umweltbelastung meistens relevanter ist als die Erstellung und Entsorgung der analysierten Stoffe. Die bedeutendsten Umweltschadstoffe sind Kupfer und Zink, die aus Metalldächern und -fassaden abgeschwemmt werden. Die Herstellung von Metallbauteilen ist bereits sehr energieintensiv; für die Umwelt noch relevanter sind dagegen die Stoffemissionen, die durch Verwitterung während der Nutzung entstehen. Aus Kautschuk-Dachbahnen kann ebenfalls Zink austreten; die Umweltbelastung dieser Baustoffe ist während der Gebäude ebenfalls deutlich höher als in der Herstellung. Und zudem führen Putze und Farben mit biozidhaltigem Filmschutz in den Gewässern zu Mikroverunreinigungen. Biozide werden auch im Holzbau für den Bläueschutz eingesetzt. Beim Vergleich verschiedener Bauteile ist jeweils die verbaute Menge zu berücksichtigen: So ist die Umweltbelastung von Fassadenanstrichen, die nur einige Mikrometer dick sind, geringer als bei einem Wandputz in Millimeterdicke. Eine Fassade aus Titanzinkblech, Kupferblech oder verzinktem Metallblech verursacht wiederum rund 25-mal mehr UBP pro m2 als eine verputzte und gestrichene Fassadenfläche mit biozidhaltigem Filmschutz.
In der Ökobilanz nicht berücksichtigt sind die aktuell diskutierten, mechanisch abgescheuerten Kunststoffbestandteile von Gebäuden. Noch ist zu wenig bekannt, welche Bauprodukte dafür verantwortlich sind. Ihre Auswirkungen auf die Umwelt sind ebenfalls weitgehend unerforscht (vgl. TEC21 24/2012).
Regeln für Verwitterungsschutz
Für die Stoffemissionen von Gebäuden sind zwar keine quantitativen Vorgaben einzuhalten, ausser es wird eine Zertifizierung für ein Nachhaltigkeitslabel angestrebt. Für die Konzeption sowie die Materialwahl existieren allerdings einfache Regeln, wie umweltschädliche Stoffemissionen in die Gewässer zu vermeiden sind:
Von grossflächigen Dacheindeckungen und Fassadenabdeckungen mit Titanzinkblech, verzinktem Stahlblech oder Kupferblech ist abzuraten.
Flachdächer sollten nur mit Bitumen- oder Kautschukbahnen abgedichtet werden, die nachweislich keine Emissionen verursachen.
Bitumendichtungsbahnen ohne Wurzelschutz sind biozidfrei, weshalb es zu keinen Emissionen kommen kann.
Für Bitumendichtungsbahnen mit Wurzelschutz oder Elastomerdichtungsbahnen sind Herstellernachweise zur «Biozidfreiheit» zusätzlich einzufordern.
Die Fassaden sollen konstruktiv derart geplant respektive die Oberflächenmaterialien so ausgewählt werden, dass weder ein Filmschutz im Putz respektive Farbanstrich noch ein (Pilz- und) Bläueschutz für die Holzschalung erforderlich ist.
Gute Beispiele aus der Praxis sind dagegen Hausfassaden mit natürlich vergrauter, umweltfreundlicher Holzschalung. Unbehandelte Fassaden verändern sich jedoch abhängig von Witterungsexposition und Sonneneinstrahlung, weshalb die Bauherrschaft darauf gezielt hinzuweisen ist. Für verputzte Aussenwärmedämmsysteme stehen derweil hydrophile Dickschichtputze ohne Biozidzugabe zur Verfügung. Diese Fassadenvariante wurde beispielsweise bereits vor acht Jahren für ein Einkaufszentrum in St. Gallen eingesetzt: Der Dickschichtputz besitzt eine hohe Flächenmasse, was die Abkühlung in der Nacht und dadurch die Kondensation deutlich reduziert. Zudem saugt sich der Deckputz bei Regen dank offenporiger Struktur mit Wasser voll. Im Endeffekt steht weniger Feuchtigkeit für das allfällige Wachstum von Mikroorganismen zur Verfügung; der chemische Biozidschutz, der zusätzlich die Umwelt gefährden kann, wird folglich obsolet. Allerdings ist die Bezeichnung «Dickschichtputz» nicht eindeutig: Hinweise auf «Filmschutz» oder «herbizide Ausrüstung» bezeichnen ein Putzsystem, das Biozide enthält; frei davon sind daher nicht alle Deckputzsysteme.
Anmerkungen:
[01] «Significance of urban and agricultural land use for biocide and pesticide dynamics in surface waters», Wittmer et al.; Water Research, May 2010.
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2010.01.030.
[02] «Ökobilanzierung der Nutzungsphase von Baustoffen», Büro für Umweltchemie; Auftraggeber: Stadt Zürich, Bundesamt für Umwelt, Kt. Zürich 2015. www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauenTEC21, Fr., 2016.04.15
15. April 2016 Daniel Savi