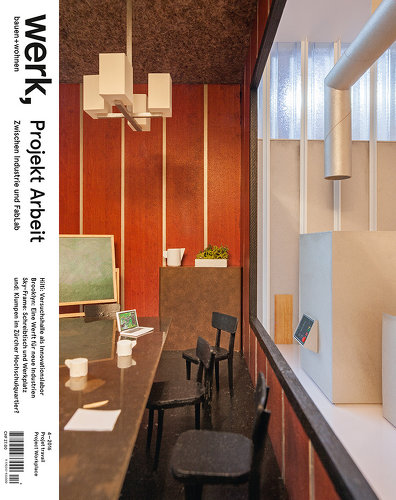Editorial
Meldungen über Entlassungen, Betriebsschliessungen und Produktionsverlagerungen jagen sich gegenwärtig in der Schweiz. Frankenschock und Megafusionen beschleunigen die Verlagerung von Industriearbeitsplätzen ins nahe oder ferne Ausland.
Das Schlagwort Industrie 4.0 verheisst mit der digitalen Integration ganzer Produktions- und Dienstleistungsketten tiefgreifenden Wandel.
Gleichzeitig regt sich ein neuer Trend, die Wiederansiedlung der Produktion unmittelbar in den Städten, direkt vor der Haustür: In kleinen FabLabs und mit Hilfe von 3D-Druckern sollen Alltagsgüter repariert oder sogar ganz hergestellt werden. Bei den Recherchen zu diesem Heft gelangten wir zur These, dass weder das eine noch das andere für sich alleine dem entspricht, was auf uns zukommt.
Wir glauben, dass es kein Zufall ist, wenn wir in kurzer Zeit mehrere Industriebauten besichtigt haben, die Produktion oder angewandte Forschung mit Büroarbeit verbinden. Die durch solche räumliche Nähe beharrlich angemahnte Innovation muss mehr sein als der sprichwörtliche Strohhalm, an den sich Europa klammert: Unser Kontinent ist darin nach den USA noch immer führend, dies hat tiefliegende mentale Gründe. Der Architektur kam bei einigen der in diesem Heft vorgestellten Beispiele eine mehrfache Aufgabe zu: Als Repräsentation einer Geschäftsidee, als Mittlerin von Innovation und als direkte Ermöglicherin von Entwicklungsprozessen durch die clevere räumliche Organisation – man kann auch sagen: durch Typologie.
Das wirtschaftliche Umfeld, in dem die in diesem Heft aufgeführten Beispiele entstanden sind, ist rau – trotzdem regt sich Optimismus. Von der vom Gründergeist geprägten Bude in der stillgelegten Werft bis zum Unternehmen mit 23 000 Mitarbeitern weltweit ist er spürbar. Unterschwellig scheint dabei etwas Wichtiges entscheidend zu sein: In allen hier vorgestellten Beispielen wird eine unmittelbare Auseinandersetzung mit dem zu bearbeitenden Material gesucht, eine direkte Verbindung von Wissen und Fertigung. Auch wenn es letztlich Roboter sind, welche die Produktion mehr und mehr übernehmen, so werden es noch auf lange Sicht hinaus Menschen bleiben, die definieren, wie dies zu tun ist. Selbst das einfachste technische Objekt ist so kompliziert, dass es zu seiner Entwicklung und Herstellung der humanen Innovation bedarf.