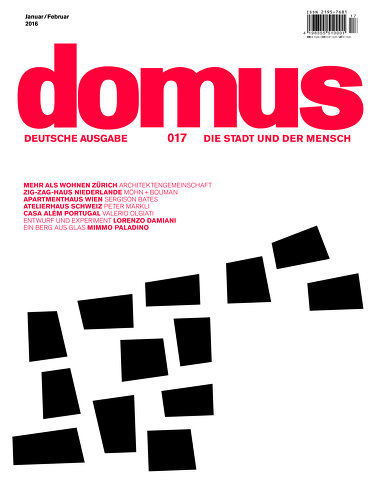Editorial
„Die letzten 20 Jahre war Wohnungsbau kein Thema“, begann Nikolaus Hirsch, einer der Kuratoren der Ausstellung „Wohnungsfrage“, im Oktober seine Eröffnungsrede im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Dafür bekommen wir nun die Quittung. Doch nicht nur, dass es an Wohnungen in den Großstädten mangelt, auch die Art, wie wir wohnen wollen oder müssen, ändert sich. Die räumliche Trennung von Arbeiten und Wohnen zum Beispiel verschwimmt weiter. Außerdem sind wir mobil und arbeiten global, womit die Nachfrage nach Zweitwohnungen steigt. Die Wohnsoziologin Christine Hannemann nennt dieses Phänomen Multilokalität. Überdies löst sich das Grundmuster der klassischen Kleinfamilie zunehmend auf, und die Vielfalt an Lebensstilen nimmt zu. Gemeinschaftswohnen ist auf einmal wieder - und mehr denn je - ein Thema. Auch wenn sich das prozentual noch nicht so niederschlägt, steigt die Sehnsucht nach dem Wohnen in Gemeinschaft als Ersatz für die Idee von Großfamilie. In unserem individualisierten Zeitalter sind vielfältige Wohnmodelle möglich. Es herrscht jedoch eine offenkundige Diskrepanz zwischen Ansprüchen, Bedürfnissen und den realen Möglichkeiten, die der Markt bietet. Oder um mit Wilfried Kuehn, einem weiteren Kurator der oben genannten Ausstellung, fortzufahren: „Die Wohnungsfrage ist kein Spezialproblem, sondern ein über die Disziplinen hinaus greifendes. Sie hat auch keine Antwort, sondern kann nur konfrontiert und thematisiert werden.“
In dieser Ausgabe der deutschen Domus stellen wir Ihnen das Projekt „Mehr als Wohnen“ in Zürich vor, ein innovatives Quartier für gemeinschaftliches Wohnen. Dieser partizipative Großversuch, der im Austausch mit allen Beteiligten entstand, wird wissenschaftlich begleitet, das Benutzerverhalten untersucht und die Ergebnisse publiziert. Das kollektive Wohnmodell der niederländischen Architekten Möhn Bouman wiederum widmet sich einer sozialen Randgruppe. Das Wohngebäude gibt 62 geistig Behinderten ein neues Zuhause ohne den üblichen Heimcharakter. Unter dem Motto `unterkulturelles Wohnen´ schließlich entstand auf einem der größten und bedeutendsten innerstädtischen Entwicklungsgebiete Wiens eine weitere interessante und sehr urbane Form gemeinsamen Wohnens: ein von drei verschiedenen Architekten entworfenes Gebäudeensemble, das sich auf der Erdgeschossebene der Gemeinschaft öffnet. Im Kontrast zu diesen kollektiven Wohnformen stellen wir Ihnen mit den Häusern von Peter Märkli und Valerio Olgiati noch zwei Projekte vor, die für individuelle Wohnbedürfnisse konzipiert wurden, jedoch alles andere sind als konventionelle Einfamilienhäuser. Bei beiden fällt der starke Grundriss auf, der dem Wohnen einen zugleich geschlossenen und sehr offenen Charakter verleiht. Außerdem wird hier die Liebe zur puren Materialität sichtbar demonstriert.
Die Liebe zur Natur und den Bergen wiederum war es, die den Fotografen Kaspar Thalmann dazu trieb, die Lawinenbebauungen im Schweizer Gebirgsort St. Antönien zu dokumentieren. Ein Berg in Italien, mit dem wir den Thementeil schließen, erfuhr ebenfalls einen menschlichen Eingriff: Bei seiner Installation am Monte Pizzuto schloss der Künstler Mimmo Paladino mit unzähligen blauen Glassplittern eine Wunde, die der Bau eines Wasserreservoir in den Hang geschlagenen hatte.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr - und vielleicht sehen wir uns ja auf der nächsten Domus Full House Roadshow, die wieder im Herbst 2016 touren wird. Viel Freude bei der Lektüre. Unsere nächste Ausgabe erscheint am 4. März 2016.
Nancy Jehmlich