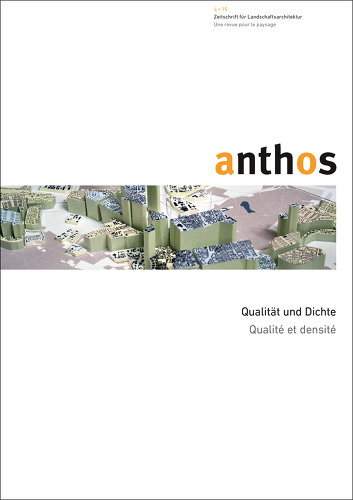Editorial
Wie wollen wir künftig wohnen? Wie leben und arbeiten? Welche Potenziale bietet die Stadt von heute für die Stadt von morgen?
Stadt ist immer eine Momentaufnahme. Städtebauliche Leitbilder, ordnungspolitische Vorgaben, (landschafts)architektonische Moden, demografischer Wandel, wirtschaftliche Entwicklung und klimatische Verhältnisse prägen sie ebenso, wie unzählige Einzelentscheidungen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, deren Lebens-, Wohn- und Arbeitsentwürfe. Alfred Döblin schrieb in seinem epochalen Werk «Berlin Alexanderplatz» 1929, mitten in der Phase der Urbanisierung: «Diese Städte (haben) ihren Zweck erfüllt, und man kann nun wieder neue Städte bauen. Du jammerst doch nicht über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind, du kaufst neue, davon lebt die Welt.»
Und nachdem auch die Phasen der Sub- und Des-Urbanisierung in vielen Ländern inzwischen überwunden sind und es die Menschen in die Städte zurück zieht (Re-Urbanisierung), braucht es gemeinsame Visionen für die Stadt von morgen. Die Ressource Grundfläche ist endlich. Das Postulat der Innenentwicklung ist ein plausibler, wenn auch nicht ganz neuer Ansatz. Dass bei dem Anspruch einer qualitätvollen Verdichtung auch künftig eine gewisse Charakteristik der gewachsenen Strukturen, kultureller Traditionen und lokaler Besonderheiten erhalten bleiben soll, steht ausser Frage. Dennoch werden wir ein paar heilige Kühe schlachten müssen. Darunter womöglich die auf dem privaten Auto basierende Mobilität, das steigende individuelle Wohnflächenwachstum. Gleichzeitig bietet sich für LandschaftsarchitektInnen die Chance, die weitreichenden Transformationsprozesse mitzusteuern. Gemeinsam mit den Vertretern anderer Professionen, gleichberechtigt und als Partner auf Augenhöhe.
Im Zentrum stünde eine differenziert geführte Qualitätsdiskussion zur Stadtstruktur, bei der ein umfassendes Freiraumsystem als grüne Infrastruktur das Rückgrat bildet. Es ginge um systemische Betrachtungen, Potenzialanalysen, Entwicklungsstrategien, (Stoff-)Kreisläufe, ein Denken in Zyklen – und die verbindliche Sicherung von Freiräumen, welche die Bedürfnisse ihrer NutzerInnen umsetzen und für alle offen sind. Neben allen Themen, die planerisch relevant sind, bleibt für die Politik der grösste Brocken übrig: dafür Sorge zu tragen, dass Frei-, Wohn- und Gewerberaum auch in den Zentren künftig bezahlbar bleibt. Schliesslich sind lebendige Urbanität, ein kleinteiliger Nutzungsmix, grosszügige Park- und Grünanlagen und ein generell attraktiver öffentlicher Raum die Markenzeichen der europäischen Stadt. Das sollten sie auch morgen noch sein.
In der Ausgabe werden, abweichend von den anthos-Satz-Regeln, verschiedene Schreibweisen für die männliche und weibliche Form verwendet als Hinweis auf die genderrelevante Thematik.
Sabine Wolf