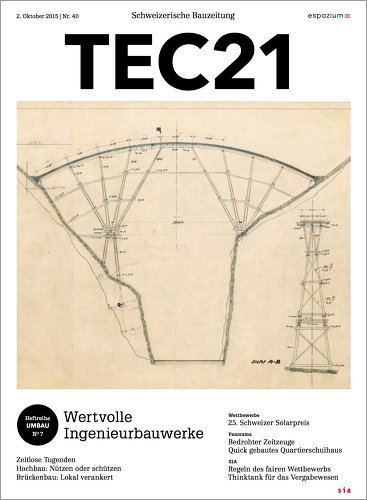Editorial
Noch nie haben sich Ingenieure intensiver mit den Bauwerken ihrer Vorläufer befassen müssen als heute. Überall wird instandgesetzt, umgebaut und verstärkt: Im Brückenbau steht die Infrastruktur mehrheitlich am Beginn ihres zweiten Lebensabschnitts. Im Hochbau wird der Wandel vom Fertigungs- zum Dienstleistungssektor in zahlreichen Umbauten bemerkbar, robuste Industriehallen werden zugunsten von Büroraum mehrfach aufgestockt.
Wer sich auf diesen «Dialog der Generationen» einlässt, begegnet mancher technischer Meisterleistung.
Oft jedoch werden diese Zeugen der Baukunst von der Gesellschaft und der institutionellen Denkmalpflege übersehen, denn ihre Qualitäten sind meist unsichtbar: Erkennen kann sie nur, wer über technisches Wissen verfügt. Wer also soll den bautechnischen Wert eines Tragwerks beurteilen, vermitteln und schlussendlich pflegen, wenn nicht die Bauingenieure selber?
Drei Autoren, die sich dieser Aufgabe mit Herzblut widmen, kommen in diesem Heft zu Wort: Jürg Conzett unterstützt mit seinem Fachwissen und mithilfe der lokalen Bevölkerung den Erhalt historischer Brücken. René Guillod betreut den Umbau zweier Gebäude, an deren Erstellung er beteiligt war. Und Werner Lorenz geht dem Begriff der Ingenieurbaukunst grundsätzlich nach und weist auf die zeitlosen Tugenden hin, die ihren Fortbestand – und ihre Pflege – sichern.
Die Redaktion