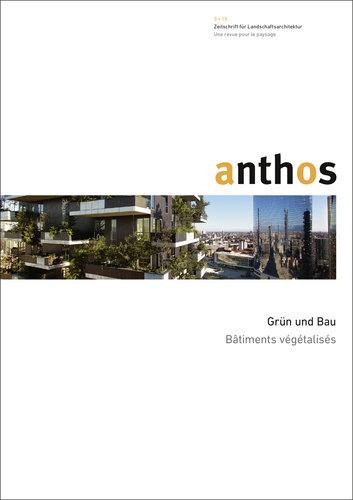Editorial
Es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Dass Jahrhunderte vergehen konnten, in denen sich kaum etwas verändert hat. Zwar gab es architektonische Moden – mal hier ein Atrium, dort ein Erker – und technologische Errungenschaften wie Lift und Stahlbeton, dank denen nicht nur höher, sondern auch dichter gebaut werden konnte. Städtebaulich gab es vor allem eine Maxime: Wachstum. Im Jahr 2008 lebten weltweit erstmals in der Menschheitsgeschichte mehr Menschen in Städten als auf dem Land, sie verbrauchten 75 % der globalen Energie und emittierten 80 % der Treibhausgase. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen rechnet mit 5 Milliarden Städtern im Jahr 2030. Da wird es nicht mehr damit getan sein, einfach Haus an Haus zu stellen und dazwischen eine Strasse zu legen.
Es braucht neue Strategien und eine grundlegende Umkehr im Verständnis unserer Städte. Einen integralen Ansatz, der das Stadtklima ebenso berücksichtigt, wie Fragen der Produktion, der Energiegewinnung, des Wasserhaushalts, der Ver- und Entsorgung sowie der Stoffkreisläufe. Kurz: ein von Grund auf neues, systemisches Denken von Stadt, auch als Reaktion auf den globalen Klimawandel.
Vielleicht ist es noch zu früh, den ganzheitlichen Ansatz heute zu fordern, andererseits ist es fünf vor zwölf. Im Detail, immerhin, tut sich bereits seit einigen Jahren etwas: Die Städte werden grüner. Wo zunächst interkulturelle Stadtteilgärten und Urban-Agriculture-Initiativen entstanden, Guerilla-Gardener und Aquaponik-Aktivisten ihre Felder absteckten, geht es nun vermehrt auch um die Schnittstellen von Architektur, Technologie und Landschaftsarchitektur. Lag der Fokus hierbei in der Vergangenheit meist auf begrünten Dächern, so erobern nun grüne Fassaden die Städte und haben das Potenzial, das Bild der Stadt radikal zu verändern. Auf dem Markt tritt denn auch eine erfreulich grosse Anzahl an Systemen boden- und insbesondere fassadengebundener Anlagen in Konkurrenz, für unterschiedlichste Pflanzengesellschaften. Zukunftsweisend sind vor allem Kombinationen aus Grün und Energie sowie die Entwicklung neuer Materialien. So forscht die EPFL Lausanne schon seit längerem zur Verwendung von Perowskiten, dem neuen Supermaterial der Fotovoltaik. Noch sind einige Hürden vor dem Praxiseinsatz zu nehmen, dereinst könnten energetisch wirksame Fassaden mit beachtlichem Wirkungsgrad als Anstrich aufgebracht werden.
Global gehen derzeit Städte wie Chicago, Paris oder Hamburg erste Schritte in Richtung der Stadt von morgen und machen Gründächer bei Neubauten obligatorisch. Spannend wird es, wenn daraus eine globale Strategie entsteht, die unsere Städte nicht nur grüner, sondern überlebensfähig macht.
Sabine Wolf