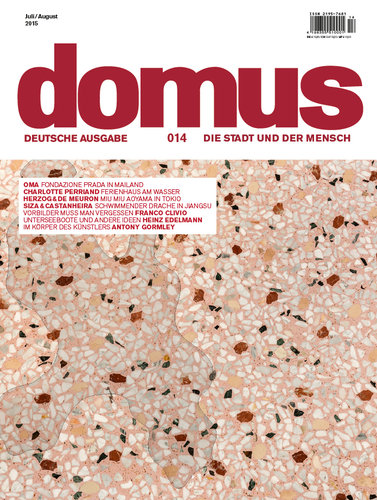Editorial
Alte Meister
Neulich kamen mir durch einen Zufall meine ersten Erfahrungen als Architekturstudentin an der Technischen Universität Berlin in den Sinn. Damals, in den frühen 1990er-Jahren, zeigte sich recht deutlich, welche zeitgenössischen Architekten wir Studenten als Vorbilder akzeptierten und welche nicht. Zwar waren wir kurz nach dem Fall der Mauer mehr damit beschäftigt, den Osten Berlins ausführlich zu erkunden, als in die Uni zu gehen. Trotzdem himmelten wir alle dieselben Idole an, und Rem Koolhaas war eines von ihnen. Für uns war er einfach anders als die etablierten Architekten: Er hatte unkonventionelle und pragmatische Ideen, erklärte das Billige zum Schönen und machte das Improvisieren zum eigentlichen Ziel - all das beeindruckte uns. Als er zu einem Gastvortrag an die TU Berlin kam, um sein aktuelles Bahnhofsprojekt in Lille vorzustellen, war der riesige Hörsaal bis auf den letzten Stehplatz besetzt. In unseren Augen war Rem Koolhaas schon damals ein unangefochtener Star - seine Haltung faszinierte uns. Hätte es eine Rangliste für die wichtigsten Fixsterne meiner ersten Studienjahre gegeben, so hätte sich der Holländer wahrscheinlich gemeinsam mit Jacques Derrida den ersten Platz geteilt.
Inzwischen ist Rem Koolhaas längst kein ungewöhnlicher Außenseiter mehr, sondern ein anerkannter Meister seiner Disziplin. Der heute 70-Jährige aus Rotterdam hat alles erreicht, was man in seiner Branche erreichen kann: Er hat den Pritzkerpreis gewonnen, die Architekturbiennale in Venedig geleitet, einen gewaltigen Turm in Peking gebaut und arbeitet derzeit an Großprojekten in Shanghai, Stockholm und Washington D. C. Koolhaas kommt mit Bauherren aus der ganzen Welt zurecht, und Bauherren aus der ganzen Welt schätzen seine Arbeit sowie die seines Architekturbüros. Aus dem unkonventionellen Querdenker, den wir so bedingungslos verehrten, ist ein etablierter Star- und Jetset-Architekt geworden. Früher hatte er mit feiner Ironie gegen das Establishment gewettert. Heute ist er selbst ein Teil davon. Doch gereicht das seinen Arbeiten zum Nachteil?
Wer diese Frage beantworten möchte, sollte kein Pauschalurteil fällen, sondern lieber einen kritischen Blick auf einzelne Projekte, ihren Kontext, ihre Aussage und ihre Umsetzung werfen. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe der deutschen Domus das jüngste OMA-Projekt vor - die Fondazione Prada in Mailand.
Unser Fotograf Delfino Sisto Legnani hat die umgebaute Destillerie aus mehreren Perspektiven festgehalten.
Die Autorin Eva Steidl war kurz vor der Eröffnung im Mai vor Ort und führt Sie durch das goldene Panoptikum, das Koolhaas für Miucca Prada gebaut hat. Wie ihr Urteil ausfällt, können Sie auf den Seiten 63 bis 74 herausfinden.
Unsere aktuelle Ausgabe widmet sich alten Meistern - darunter gleich drei Pritzker-preisträger. Neben Koolhaas’ Mailänder Intermezzo stellen wir eine Unternehmenszentrale von Álvaro Siza in China vor sowie ein raffiniertes Modearrangement von Herzog & de Meuron in Tokio. Außerdem dokumentieren wir historische Projekte, deren Charme bis heute aussagekräftig und in vielerlei Hinsicht vorbildhaft ist. Charlotte Perriands Maison au bord de l’eau, Nanda Vigos psychedelisches 1970er-Jahre-Interieur für eine Villa in der Brianza und Alberto Ponis’ Casa Scalesciani auf Sardinien von 1979 zeigen uns, dass gute Architektur zeitlos sein kann, solange sie klare Ziele hat und diese konsequent umsetzt.
Im Designteil greifen wir diesmal das Thema Vorbilder auf: Franco Clivio rät in einem Interview, sie einfach zu vergessen. Und zehn international renommierte Designer, unter ihnen Meister wie Alessandro Mendini oder Alberto Meda, erinnern sich an ihre ersten beruflichen Schritte sowie die Vorlieben und Vorbilder ihrer frühen Studienjahre. Erinnerungsfotos, Bücher, Aquarelle - all das haben sie für die Domus zusammengetragen und dokumentiert.
Wer sich mit alten Meistern beschäftigt, der muss sich letztlich auch mit sich selbst beschäftigen. Dieser Grundgedanke ist maßgeblich für Thomas Bernhards Roman `Alte Meister´: Seit über 30 Jahren und täglich außer montags geht sein Protagonist ins Kunsthistorische Museum in Wien, um stets dasselbe Tintoretto-Gemälde auf Fehler zu untersuchen. Was sein Blick jedoch am Ende aufdeckt, verrät mehr über ihn selbst als über Tintoretto. In diesem Sinne bleibt die Frage der Vorbilder und der alten Meister sicherlich auch eine Generationenfrage, in der viel Selbsterkenntnis steckt.