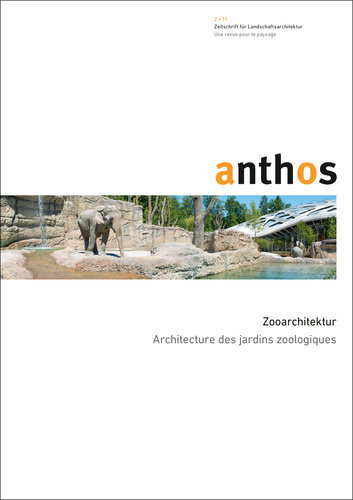Editorial
Schon seit Jahren ist eine grosse, internationale Revolution im Gange, die es kaum in die grossen Feuilletons schafft. Vielleicht in die Lokalteile der Zeitungen. Dabei ist Paris ebenso betroffen wie Zürich, Basel, Köln und Stuttgart, London, Wien, Barcelona und Sankt Petersburg. Und nicht nur das, im Zuge des Umbruchs ist ein hoch spezialisierter Aufgabenbereich für Landschaftsarchitekten und -planer entstanden – ohne, dass dieses Wissen an Hochschulen gelehrt wird. Es mag trivialer klingen als es ist: die Zooarchitektur. Wo Tiere in allerlei Grösse und aus vielerlei Ländern früher im Klein-Klein von Gehege an Gehege zur Schau gestellt wurden, laden heute aufwändig gestaltete und inszenierte Landschaften zum Erlebnis für die ganze Familie ein. Selten jedoch bietet sich die Chance für Neugründungen. Und so gilt es, die Anlagen zoologischer Gärten, einst errichtet in der bildungsbürgerlichen Tradition des 19. Jahrhunderts und in der Zwischenzeit meist bereits mehrfach angepasst, erneut für die gewandelten Anforderungen zu überarbeiten.
Längst verschwindet die notwendige, zunehmend als störend empfundene funktionale Architektur mehr und mehr aus dem Blickfeld der Besucher. Stattdessen schwingen sich Pfade in luftige Höhen, queren Gehege mit exotisch klingenden Namen knotenfrei in der Luft und wirken nebenbei noch didaktisch. Organisch fügen sich die Anlagen in ihre Umgebung ein, arbeiten mit altem Baumbestand und lokaler Topografie, die hier und da inszenatorisch freilich überhöht wird. Ökologie und Verhaltensforschung beeinflussen die Raumkonzeptionen der Planer, hinzu kommen die Auflagen internationaler Artenschutz- und Erhaltungszuchtprogramme. Der Spagat zwischen einer naturillusionistischen Gestaltung im Publikumsbereich und den funktional orientierten Anforderungen der Stallungen ist immens. Steigende Besucherzahlen belegen ein öffentliches Interesse, das die Zoos als Grossunternehmen mit ständig neuen Angeboten erweitern: Erlebnisführungen, Hochzeiten in exotischem Ambiente, Restaurants und Shoppingangebote auf dem Areal, Besucherzentren und Pinguinparaden.
Diese leise globale Revolution könnte sich zu einer Win-win-Situation entwickeln: Artgerechter gehaltene Tiere, erlebnisgesättigte grosse und kleine Besucher und international vernetzter Artenschutz. Schön wäre natürlich, wenn auch die grosse Leistung der transdisziplinären Teams, die die Gestaltungen entwickeln und umsetzen, breiter publik würde.
Wir freuen uns sehr, dass wir für die Ausgabe Christina May als Expertin und Gastredaktorin gewinnen konnten. Die Zooplanung als Berufsfeld weist nicht nur eine hohe Spezialisierung auf, sie hat auch ein eigenes Fachvokabular. Der besseren Verständlichkeit wegen war Christina May so freundlich, ein Glossar der wichtigsten Begriffe zusammenzustellen.
Sabine Wolf
Inhalt
François Gay: Natürliche Architektur
Walter Vetsch: Wohin die Reise führt
Lorenz Eugster, Stefan Schrämmli: Symmetrie und Exotik
Hubert Möhrle: Afrikanische Menschenaffen in der Wilhelma
Jan-Erik Steinkrüger: Über Inszenierungen von Natur
Peter Drecker: Die Landschaft kehrt in die Zoos zurück
Kilian Jost: Zoofelsen aus Zürich
Becca Hanson: I Can’t Hear You
Till Rehwaldt: Kattaanlagen in Dresden und Erfurt
Monika Fiby: Neues Berufsbild: Zooplanung
Jacqueline Osty: Die Verwandlung des Pariser Zoos
Kieran Stanley: Erlebnisarchitektur
Andras Jambor: Der neue Zoo von Sankt Petersburg
Christina Katharina May: Glossar
Die Verwandlung des Pariser Zoos
Die Transformation einer in die Jahre gekommenen Zooanlage in eine zeitgemässe Gestaltung, die genügend Entwicklungspotenzial für künftige Veränderungen offen lässt, ist eine ebenso herausfordernde, wie spannende Aufgabe.
Den 1934 entworfenen Pariser Zoo in einen zoologischen Garten des 20. Jahrhunderts mit allen modernen Eigenschaften umzugestalten, ist mehr als nur eine einfache Sanierungsaufgabe. Die umfassende Metamorphose basiert auf einer grossen Anzahl von historischen, umweltbezogenen und museumskundlichen Informationen. Unter diesem Spezialzweig der Ausstellungskunst verstehen wir die pädagogische Präsentation von 180 Tierarten aus fünf Regionen der Welt und fünf Biozonen (Patagonien, Sahara-Sudan, Europa, Guyana, Madagaskar). Die zeitgenössische Präsentation soll aktuellen gesellschaftlichen Zielen entsprechen: Hier wird für Artenschutz und eine feinfühlige Einführung in die Welt der Tiere und die Natur geworben. Die Tiere werden nicht einfach gezeigt, sondern in fünf ihren Bedürfnissen entsprechenden Landschaften in Szene gesetzt. Die Freiraumarchitektur ist der Leitfaden dieses Projekts, echte Massarbeit, um die Besucher in eine fremde Welt eintauchen zu lassen.
Fünf Biozonen
Der zoologische Garten von Paris liegt im geschützten Waldraum «Bois de Vincennes», er wurde von Jean-Charles Alphand (1817–1891) entworfen. Historische Linien konnten erhalten oder wieder hergestellt werden: Ausblicke auf See und Wald sowie Beziehungen zwischen Volumen und Leerräumen, die im Laufe der Zeit verloren gegangen waren. Die unterschiedlichen Dichten der bestehenden Vegetation trugen zur Wahl der Standorte für die fünf Biozonen bei. Die weiten, offenen Räume Patagoniens und der Sahelzone des Sudans befinden sich in den von nur wenigen Bäumen bestandenen Sektoren. Die sudanesische Sahelsavanne wird durch eine weite Ebene dargestellt, nutzt deren grosszügige Ausdehnung und spielt mit der Perspektive auf den «Grand Rocher»[1]. Die drei anderen Biozonen mit ihren dichten Wäldern – Europa, Gyana und Madagaskar – wurden dort angeordnet, wo der ursprüngliche Gehölzbestand sehr dicht war; sie repräsentieren visuell geschlossenere Landschaften.
Landschaftskulissen und Kunstbauten
Die wichtigste Herausforderung beim Bau eines urbanen Zoos ist heute die Schaffung wirkungsvoller Illusionen: wilde Natur, Exotik, ausgedehnter Raum. Im Zoo von Paris mit seiner Fläche von 14,5 Hektaren wird ein scheinbar grösserer Raum mit Hilfe von gartenkünstlerischen und dem Theater entliehenen Mitteln geschaffen: aufeinanderfolgende Bildebenen, Bühnenbild und Hors-champ[2], Sichtbares und Verstecktes … So entsteht die Landschaftskulisse. Das Design der Gehege entspricht den zur Landschaftsinszenierung kreierten Rundgängen und Aussichtspunkten. Grenzlinien werden verwischt, die Besucher können sich nur am Panorama orientieren, um Geländetiefe oder Vegetationsdichte einzuschätzen.
Landschaft vorbeiziehen lassen
Der zum Flanieren geschaffene Rundgang ähnelt einer langen Kamerafahrt, auf der man nach und nach unterschiedliche Landschaften entdeckt, mal von Nahem, mal aus der Ferne. Auch die nüchterne Sachlichkeit des aus hellem Beton gestalteten Hauptwegs hebt die Diversität der durchquerten Landschaften hervor. Die untergeordneten Wege bieten überraschende Einblicke und erlauben, die Tiere aus der Nähe zu betrachten. Die ausschliesslich für das Zoopersonal bestimmten Unterhaltswege ermöglichen den Angestellten, sich im Zoo zu bewegen, ohne die Besucher auf ihrer Reise zu stören. Diese Wege sind geschickt verborgen: Der Mensch erhält den Eindruck, er sei hier wirklich bei den Tieren zuhause. Dem Besucherrundweg folgend, erblickt man weite Perspektiven und präzise Bilder der Gehege. Die von feinem schwarzen Stahl gerahmten Blickbuchten verschwinden fast in der Landschaft. Hier kann der Besucher den Weg verlassen, um in den Rahmen hineinzutreten, oder von einem der Balkone aus ein ganzes Panorama zu überblicken.
Stein und Pflanze
Farben und Materialien passen sich der künstlich geschaffenen Topografie des Geländes an, sie tragen dazu bei, die fünf Biozonen voneinander zu trennen und unterstützen die Gestaltung des Wegesystems mit seinen Überraschungseffekten. Die Farben erinnern an die natürlichen Lebensräume der Tiere, die sandigen oder rauen Oberflächen sind den Bedürfnissen der verschiedenen Arten entsprechend gestaltet. Als Gegenstück zum historischen Grand Rocher imitieren künstliche Felsen die Geologie der dargestellten Landschaften. Sie dienen als Liegeplätze und bieten Vertiefungen für die Futterablage. Ihre Form hindert die Tiere zudem am Abweiden der Pflanzungen. Die künstlichen Felsen rufen, genau wie die Pflanzungen, Bilder fremder Landschaften hervor, um die Besucher auf ihre mentale Fernreise zu schicken.
Eine reiche Bepflanzung der Anlage ist unabdingbar, um dem Besucher das Eintauchen in die Welt der Tiere zu ermöglichen, eine grosse Anzahl neuer Pflanzen wird deswegen in die bestehende Vegetation «eingewebt». Da im Pariser Klima nicht die Pflanzenarten aller Ursprungsländer gedeihen, wurden die im Freiraum gelegenen Wälder Madagaskars und Guyanas mit Hilfe einer «Transposition» erzeugt: Eine Palette von mimetischen Pflanzen ersetzt dabei die endemischen Arten. Die europäischen Landschaften und der Tropenwald im Gewächshaus werden rekonstruiert.
Als Ort einer pädagogischen und naturschützerischen Ausstellung bietet der Zoo eine poetische Landschaft, von der wir hoffen, dass sie beim Besucher ähnliche Gefühle weckt, wie sie Kinder empfinden, wenn sie eine für sie noch grenzenlose Welt entdecken.
Anmerkungen:
[01] Seit seiner Eröffnung 1934 ist das Wahrzeichen des Pariser Zoos ein 65 Meter hoher künstlicher Felsen, der unter dem Namen «Grand Rocher» bekannt ist.
[02] Der französische Begriff hors-champ ist ein Begriff der Filmwissenschaft (auf Deutsch «ausserhalb des Feldes»), der den Bereich ausserhalb der dargestellten Welt bezeichnet, zum Beispiel eine Off-Stimme.anthos, So., 2015.05.24
24. Mai 2015 Jacqueline Osty