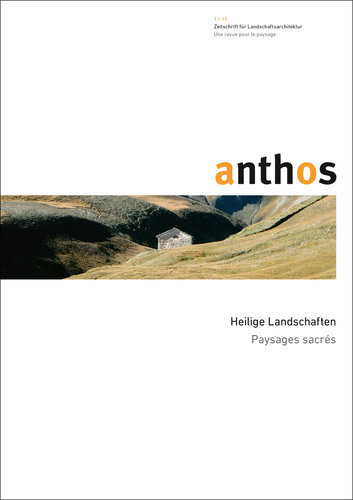Editorial
Neben Bäumen und Quellen sind es häufig Berge, denen das Besondere zugeschrieben wird. So gilt der Kailash in Tibet als der «heiligste Berg der Welt» und ist Symbol für den Weltenberg der Schöpfung.
Der Olymp ist bekannt als Sitz der griechischen Götter, am Donnersberg in der Pfalz wurde Jupiter verehrt, der afrikanische Ol Doinyo Lengai ist für die Massai Sitz des Regen- und Wolkengottes Engai, den australischen Uluru verehren die Pitjantjatjara-Aborigines als Teil ihres Schöpfungsmythos – und im Gebirge (!) Ararat soll nach der Sintflut die Arche Noah gestrandet sein.
In Riten und Bezeugungen wie Wallfahrten und Prozessionen, Platzierungen und Interventionen wie Gedenktafeln und Skulpturen festigt sich das kulturelle Verständnis des Besonderen. Religiöse Architektur gibt der Landschaft seit jeher eine nur im Kontext lesbare Prägung. Zeugnisse hiervon geben Wegkreuze, Kapellen, Klöster, Kirchen und Tempel entlang alter Handelswege und geografisch relevanter Verbindungsachsen.
Manche dieser Orte werden von Generation zu Generation weitervererbt, auch über gesellschaftliche Wandel oder verschobene Staatsgrenzen hinweg, und festigen die Gemeinschaften: Innen ist, wer am Wissen teilhat, aussen die anderen.
Was Orten und Landschaft ihre Kraft und Ausserordentlichkeit verleiht, bleibt häufig ein ergreifendes Mysterium. Wir können das Erhabene und Transzendente ihren verstörenden physikalischen Besonderheiten zuschreiben wie vulkanischen Tätigkeiten, Naturgefahren durch Lawinen oder Murgänge, Wetterscheiden oder Rohstoffvorkommen. Einen Zugang über Animismus, Geomantie, Radiästhesie, Standortastrologie oder Focusing suchen. Oder Jan Assmann, Pierre Nora und anderen folgen, welche die besonderen Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umgebung kulturtheoretisch beleuchtet haben. Alle Antworten werden wir nicht finden.
Als Landschaftsarchitekten bewegen wir uns häufig in diesem Spannungsfeld. Was ist dann unsere Aufgabe? Sind Landschaftsarchitekten die Beschützer heiliger Landschaften? Dürfen sie gestaltend darin wirken? Kann Landschaftsarchitektur einem Ort das Spezifische geben oder ist es vorher schon da und unsere Aufgabe liegt im Aufspüren und Sichtbarmachen des «Heiligen»? Wie können wir das Besondere des Ortes und der Landschaft pflegen und ihren Wert angemessen schätzen?
In der Ausgabe versammeln wir unterschiedliche Projekte, Ideen und Ansätze von Orten und Landschaften, denen das Besondere zugeschrieben wird oder in denen wir etwas Besonderes sehen. Wir sind uns bewusst, dass wir weitere Fragen aufwerfen – und nicht beantworten.
Sabine Wolf
Inhalt
Albert Kirchengast: Gibt es das, heilige Klosterlandschaften?
Klaus Holzhausen: Charlotte Thietart: Eine Meditationslandschaft
Susanne Lengger: Pilger-Wanderweg «Heilige Landschaft Pfaffenwinkel»
Bruno Vanoni: Vom Segen der «heiligen Wasser»
Adrian Kräuchi: Amadé Zenzünen: Auf den Spuren des Sakralen im Binntal
Compagnie de la Torma: La Torma: Ein Friedhof wird zum Park
Robin Winogrond: Wildwood Plaza, Uster
Franziska Kirchner: Traumzeit und Pflanzen
Natacha Guillaumont, Tedros Yosef: Ruinengarten, die Ziege als Gärtner
Glenn Cotter: Neugestaltung des Friedhofs
Daniel Bösch: Der Wald als schützender Mantel
Theodor Henzler: Atriumkirchen mit kontemplativen Innengärten
Christophe Veyrat-Parisien: Place Saint-Jacques, Sallanches
Günter Nitschke: Erneuerung in Natur, Mensch und Bau
Neugestaltung des Friedhofs
In vielen Dörfern markiert das Ensemble aus Kirche, Kirchplatz und ummauertem Friedhof bis heute das Zentrum. Wo dies als nicht mehr zeitgemäss empfunden wird, gilt es, die Verhältnisse neu auszuloten. Die Walliser Gemeinde Savièse geht einen mutigen Weg und öffnet die Räume.
Eine Analyse der politischen und der kirchlichen Gemeinde von Savièse hatte ergeben, dass auf dem Friedhof nur noch vierzig Grabstellen frei waren und dies bei etwa fünfzig Verstorbenen jährlich. Das Besondere an dem Friedhof ist, dass seit seiner Gründung an der Ostseite der Kirche keines der Gräber je aufgelöst wurde. Seine Erweiterung ist jedoch durch die Lage inmitten des Dorfs nicht möglich.
Nachdem verschiedene Vorschläge – wie insbesondere die Gründung eines neuen Friedhofs ausserhalb des historischen Ortsteils – geprüft worden waren, entschied der Bauherr schliesslich, den Friedhof auf seinem ursprünglichen Gelände zu belassen und jene Grabstätten aufzulösen, deren Nutzungsrecht abgelaufen war. Angesichts der stattlichen Anzahl von 790 aufzulösenden Gräbern hatte Savièse den Angehörigen die Möglichkeit eröffnet, ihre Grabsteine für die Gründung eines Familiengrabs behalten zu können. Dies war im Juni 2009 die Ausgangslage für den Wettbewerb zur Neugestaltung des Friedhofs, den die politische und die kirchliche Gemeinde gemeinsam ausschrieben.
Das Konzept
Durch seine Lage im Zentrum von St-Germain, der Hauptsiedlung von Savièse, hat der Friedhof einen wichtigen Platz im Leben der Bürger: als Ort der Begegnung, der Besinnung und des Gebets, aber auch als Durchgangsort.
Unser Vorschlag zur Neugestaltung sollte den Charakter des Friedhofs verstärken. Der gestalterische Hauptansatz bestand darin, den Dorfplatz neu zu definieren, indem wir die Grösse der für die Gräber vorgesehenen Flächen anpassten. Der Platz vor dem Gemeindehaus erhält so mehr Raum zum Atmen und an der Ostseite des Kirchengebäudes ist ein neuer Platz entstanden. Dieser bildet den Haupteingang zum Friedhof und schafft Raum an der östlichen Kirchenseite. Die grosse Wand des Kolumbariums, das Platz für bis zu 450 Urnen bietet, schliesst den Friedhof im Norden des Geländes ab. Regelmässig aufgereiht liegen die Grabplatten, auf denen die Namen der Verstorbenen eingraviert sind. Leere Urnennischen können zur Ablage von Blumenschmuck oder Grablichtern genutzt werden.
An der Südseite wurde ein Eingang vom Hof der Krypta neu gestaltet. Ein neues Gebäude markiert die Grenze zum benachbarten Parkplatz und verdeckt gleichzeitig die Abfallbehälter. Ein Erinnerungsgarten befindet sich ebenfalls an der Südseite. Die Namen aller auf dem Friedhof bestatteten Verstorbenen wurden auf Platten aus eloxiertem Aluminium graviert, die mit den Verschlussplatten der Urnennischen des Kolumbariums korrespondieren. Als Bestattungsort und mit dem aussergewöhnlichen Panorama der Walliser Alpen lädt der Freidhof zur Besinnung ein.
Die Anpassung der Grabsteinabmessungen schafft einen homogenen Gesamteindruck, der dennoch die Möglichkeit bietet, die eigene letzte Ruhestätte individuell zu gestalten. Die Grabstellen wechseln nach einer bestimmten Zeit von einer Grünfläche zu einer mineralischen Fläche. Durchgänge zerteilen die Flächen und ermöglichen einen fliessenden Übergang der Grabstellen zu den neuen Standorten. Der gesamte neue Anlagenbereich – der Erinnerungsgarten, die Bänke, die Wasserstellen, der Brunnen, die Abfallbehälter und die Mauer des Kolumbariums – ist einheitlich aus eingefärbtem und selbstverdichtendem Beton gefertigt. Am Rotahorn Acer rubrum lässt sich der Wechsel der Jahreszeiten ablesen und der Lauf des Lebens gesellt sich zu dem des Todes.anthos, So., 2015.03.01
01. März 2015 Glenn Cotter