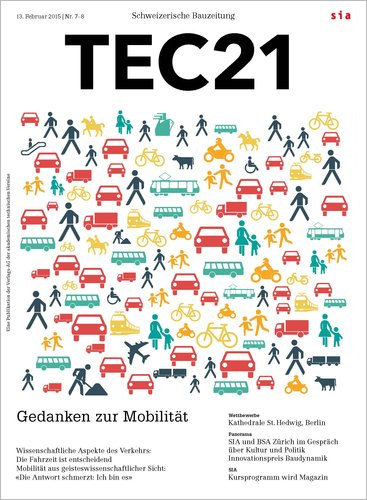Editorial
Pendeln zwischen zwei Grossstädten oder doch eine zweite Wohnung? Leben in der Stadt und am Wochenende raus ins Grüne – oder ländlich wohnen und in der Stadt arbeiten? Stundenlange Zugreisen zu alten Freunden oder durchs Quartier schlendern, um Neues zu entdecken? Die Kinder übers Wochenende zum entfernt lebenden Elternteil bringen und selbst zur neuen Liebe reisen? Einfach mal abschalten:
ein Kurztrip in eine europäische Metropole oder zum Verwandtenbesuch nach Übersee? Eine Bildungsreise mit dem Kreuzfahrtschiff oder zur Podiumsdiskussion in die Innenstadt fahren …?
Gründe fürs Unterwegssein gibt es unzählige. Jeder ist unterwegs. Wer stehen bleibt, wird je nach Gesinnung belächelt oder bewundert.
Jeder hat seine Gründe für seinen aktuellen Wohnort und sein Verkehrsverhalten. Wahrscheinlich denkt auch jeder darüber nach, ob es sinnvoll wäre, etwas daran zu ändern – und sei es nur aus Kostengründen.
«Wie lange dauert es noch?», «Wann sind wir da?» – diese klassischen Kinderfragen halten sich seit Generationen, und die Eltern wissen darauf in der Regel eine Antwort. Doch sie lassen sich auch ganz allgemein auf Verkehr und Mobilität übertragen, und dann gehen uns schnell die Antworten aus. Im Gegenteil – in der Diskussion aus wissenschaftlicher, historischer und philosophischer Sicht tauchen immer neue Fragen auf. Ganz am Anfang stehen diese: Woher kommen wir? Und wohin wollen wir?
Daniela Dietsche
Inhalt
AKTUELL
07 WETTBEWERBE
Das Besondere weicht dem Gewöhnlichen
12 PANORAMA
Erdbebensicherheit rechtlich verankert | «Was über die reine Funktion hinausgeht, bleibt dem Zufall überlassen» | Verkehrsnachrichten in Kürze
18 VITRINE
Nützliches für Fassaden
20 KURSPROGRAMM WIRD MAGAZIN
Wert und Spezifik der Böden erkennen | Zu viel Technik im Bauwerk? | Beitritte zum SIA im 4. Quartal 2014
25 VERANSTALTUNGEN
26 DIE FAHRZEIT IST ENTSCHEIDEND
Dr. Kay W. Axhausen
Die Reisezeiten auf den Schweizer Strassen haben sich in den vergangenen 50 Jahren halbiert. Wie werden Geschwindigkeit und gewünschte Erreichbarkeit künftig den Verkehr beeinflussen?
30 «DIE ANTWORT SCHMERZT: ICH BIN ES»
Katharina Möschinger, Daniela Dietsche
Ein Gespräch mit der Philosophin Eva Schiffer und dem Wissenschaftsjournalisten Marcel Hänggi über Mobilität im weiteren Sinn.
35 STELLENINSERATE
45 IMPRESSUM
46 UNVORHERGESEHENES
«Die Antwort schmerzt: Ich bin es»
Mit der Philosophin Eva Schiffer und dem Wissenschaftsjournalisten Marcel Hänggi sprachen wir über Verkehr und Mobilität im weiteren Sinn. Das Experiment eines interdisziplinären Dialogs hat
Überlegungen hervorgebracht, die weit über technische Lösungsansätze hinausgehen und nachdenklich stimmen.
TEC21: Was bedeutet Fortschritt im Zusammenhang mit Mobilität?
Marcel Hänggi: Fortschritt ist ein grosses Wort. Ich wäre schon froh, wenn es keinen Rückschritt mehr gäbe. Es wird oft behauptet, unsere Gesellschaft werde mobiler. Ich behaupte das Gegenteil.
Wie kommen Sie zu dieser These?
Hänggi: Verkehr und Mobilität – oder sagen wir Mittel und Zweck – werden oft verwechselt. Der Verkehr nimmt natürlich zu, mit allen negativen Folgen. Kinder haben motorische Defizite, die Krankheiten infolge von Bewegungsmangel nehmen zu. Mir geht es um die Möglichkeit, meine Mobilitätsbedürfnisse im umfassenden Sinn befriedigen zu können. Unsere Mobilität, verstanden als Fähigkeit, das Bedürfnis nach Ortsveränderung zu befriedigen, unterscheidet sich nicht wesentlich von jener der Menschen vor 100 Jahren. Das gilt auch für die «Unterwegszeit»: Schnellere Verkehrsinfrastrukturen führen nicht zu Zeitersparnissen, sondern dazu, dass wir längere Wege zurücklegen. Die Mobilität ist konstant geblieben, der Mobilitätsaufwand – Kosten, Umweltverschleiss usw. – hingegen hat sich vervielfacht. Deshalb ist auch die Behauptung falsch, Mobilität sei zu billig. Heute gibt ein durchschnittlicher Schweizer Haushalt 8 % seines Budgets für Mobilität aus, mehr als für Lebensmittel. Vor 50 Jahren war es ein Bruchteil dessen.
Frau Schiffer, Sie haben einmal geschrieben, wir müssen zuerst den Stau im Kopf überwinden, um alles wieder in Fluss zu bringen (vgl. Kasten S. 32).
Eva Schiffer: Aus philosophischer Sicht müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns fragen, wie wir als Gesellschaft in eine bestimmte Situation geraten sind.
Wir alle hetzen ständig hinter etwas her. Kay Axhausen schreibt in seinem Beitrag «Die Fahrzeit ist entscheidend» (vgl. S. 26) von einer «Befriedigung der Ungeduld, die ein Ergebnis des wachsenden Wohlstands ist».
Hänggi: Das ist offensichtlich.
Schiffer: Dieser frenetische Aktivismus ist etwas Entsetzliches. Jeder kennt das: diese Atemlosigkeit, die Unfähigkeit zu verweilen ... In der Geisteswissenschaft kann diese Entwicklung wunderbar nachvollzogen werden. Die christliche Heilsvorstellung verweist von hier nach dort. Und der Fortschrittsgedanke zur Zeit der Aufklärung, dass es «künftig» besser sein wird, knüpft an diese Vorstellung an. Diese Muster sind tief in uns verankert. In der vorchristlichen Zeit war das noch nicht so. Das griechische Wort für Bewegung, «Kinesis», bedeutet nicht die Verschiebung von Körpern im Raum, sondern bezeichnet «das, was uns bewegt». Hier muss niemand «weiterkommen».
Nun steht die Verkehrsplanerin, der Verkehrsplaner im Alltag vor der Aufgabe, ganz konkret die Infrastruktur so zu bauen, wie sie gewollt ist. Aber was wollen denn die Menschen wirklich? Herr Hänggi, Sie haben in Ihrem Referat am Berner Verkehrstag 2013 gesagt: Der Trend zur Verkehrszunahme wird gemacht. Was heisst das?
Hänggi: Wollen ist vielschichtig. Es gibt auch Dinge, die ich nur meine zu wollen. Ich glaube, in der Verkehrsdebatte hat vieles mit Fehlwahrnehmungen zu tun, mit der Verwechslung von Mittel und Zweck. Jede neue Verkehrsinfrastruktur schafft Zwänge. Was meist übersehen wird – und das finde ich psychologisch erklärbar –, ist, dass jede neue Strasse oder Bahnstrecke mir zwar grundsätzlich die Möglichkeit gibt, sie zu benutzen – also mir die Freiheit dazu schafft –, mich aber auch zu einem gewissen Grad dazu zwingt. Es ist ein mittelbarer Zwang, beispielsweise für mich als Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich dieselben Chancen wie meine Mitkonkurrenten haben will. Oder wenn ich mir nicht mehr leisten kann, an einem Ort zu wohnen, weil eine neue S-Bahn-Linie die Mieten steigen lässt. In den USA gibt es die Diskussion um den «urban sprawl». Es wird behauptet, die Zersiedelung sei Ausdruck für den Willen der Menschen, immer weiter ausserhalb zu wohnen. Dabei ist die Suburbanisierung unter anderem eine Folge gezielter Politik nach dem Zweiten Weltkrieg. Zurückkehrende Veteranen bekamen Land in den Vororten. In der Boomzeit nach dem Krieg hat man in den Levittowns sogar bewusst fussgängerfeindlich gebaut, denn mit Fussgängern assoziierte man die Arbeitslosen der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren.
Schiffer: Der Fussgänger ist ein gutes Beispiel. Wenn vor meinen Augen das Bild eines «Herumlungernden» entsteht, möchte ich kein Fussgänger sein. Der japanische Dichter Takiguchi zeichnet ein anderes Bild des Fussgängers: Sein Körper und sein Geist sind leicht, deshalb vermag er unterschiedliche Dinge wahrzunehmen. Da erscheint der Fussgänger als freier Mensch. Es ist wichtig, dass wir über die Bilder, die uns ergreifen, nachdenken und uns nicht nur mit technischen Lösungsvorschlägen befassen. Bis zu einem gewissen Grad sind wir selbst für die Wirkung von Bildern auf uns zuständig.
Hänggi: Vieles von dem, was Sie sagen, ist sicher mehrheitsfähig. Es gibt viele Menschen, die kein Interesse daran haben, ständig herumzurennen oder in der verstopften S-Bahn bzw. im Stau zu sitzen. Aber gleichzeitig sind wir infrastrukturellen Zwängen ausgeliefert. Ein Autofahrverbot würde die Freiheit der Menschen einschränken, die ein Auto benutzen. Sie haben sich ihr Leben so eingerichtet, dass sie es brauchen – auch wenn sie meine Einschätzung der Verkehrssituation teilen. Was aber viel mittelbarer ist: Das Fahrzeug befriedigt Bedürfnisse, die die Menschen nicht hätten, wenn es das Auto nicht gäbe. Würden die Autos von heute auf morgen abgeschafft, wäre der Verlust mittelfristig verhältnismässig klein. Aber der Gedanke ist zunächst erschreckend. Was ich damit sagen will: Bei einer Verkehrsreduktion wird die Einschränkung der Freiheit unmittelbarer erfahren als der Zugewinn von Freiheit, der daraus resultiert. Das erklärt ein Stück weit diese Diskrepanz, dass viele Leute durchaus lieber eine Welt hätten, in der weniger gehetzt wird ...
Schiffer: Es geht doch um die differenzierte Selbstwahrnehmung. Wenn ich als Autofahrerin mit dem Auto von A nach B will und mich auf diesem
Weg etwas begrenzt, dann nervt mich das – aber ich bin ja nicht nur Autofahrerin. Bin ich frei genug, über meine Autofahrerinnenwünsche hinauszudenken? Mich beispielsweise zu fragen, wozu ich da eigentlich herumfahre? Für den Philosophen Peter Bieri ist Freiheit ein Handwerk – eine Kunst, die wir ständig üben müssen. Es ist schwierig, sich von etwas zu befreien; noch schwieriger jedoch ist die Reflexion der Frage, wozu wir denn nun frei sind. Sind wir imstande, Freiheit in Sinn zu verwandeln? Im Übrigen ist das Gegenteil eines Übels nicht schon per se das Gute, so einfach ist es nicht. Wichtig ist der Wille zur Nachdenklichkeit des Einzelnen. Es ist für mündige Bürger keine Lösung, die Verkehrsprobleme den Planern auf den Tisch zu legen.
Was kann ein Auslöser sein, sich solche grundsätzlichen Fragen zu stellen? Braucht es die Erfahrung der staatlich verordneten Begrenzung, die doch wiederum ein Eingriff in die individuelle Freiheit ist?
Hänggi: Ich erlebe häufig in Debatten, dass Personen, die sich als liberal bezeichnen, staatliche Eingriffe befürworten, wenn es um Massnahmen zur Verkehrsreduktion geht und die Leute «gezwungen» werden sollen, weniger zu fahren. Aber die ganze Verkehrspolitik ist doch interventionistisch! Privatverkehr ist nur zur Hälfte privat, die Strassen gehören dem Staat. Es ist auch der Staat, der sie baut. Und es ist der Staat, der mich durch seinen Strassenbau zwingt, meine Kinder in ihrer Freiheit einzuschränken, damit sie nicht überfahren werden. Das Recht des Kinds, sich im öffentlichen Raum wie ein Kind zu bewegen, ist aber ein existenzielleres Recht, als mit 50 durchs Quartier zu rasen. Von daher geht es nicht um staatliche Intervention ja oder nein, sondern wenn schon, um die Form der staatlichen Intervention.
Schiffer: Unser ethisches Empfinden ist zutiefst von der Vorstellung einer Morallehre geprägt, bei der es nur um Verbote und Gebote geht. Was uns fehlt, ist eine zeitgemässe Strebens-, Glücks- und Wertethik – die ernsthafte Reflexion dessen, was uns wirklich wichtig ist. Auch ein kluger Techniker ist nicht nur Techniker, der technische Lösungen austüftelt, sondern zudem ein reflexiver Mensch, der über Sachfragen hinaus über grössere Zusammenhänge nachdenkt.
Hänggi: Ein realpolitischer Faktor, der in der Schweiz zum extremen Verkehrskonsum beiträgt, ist das gegenseitige Hochschaukeln von Schiene und Strasse. Im Bahnland Schweiz legen die Leute viel mehr Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück als im Autoland Deutschland. Aber die Schweizer fahren deswegen nicht weniger Auto – sondern gleich viel wie die Deutschen! Wir tun also beides exzessiv. Unser öV löst das Auto nicht ab, sondern produziert hauptsächlich Mehrverkehr. Beispielsweise kann ich dank der S-Bahn in Winterthur leben und in Baden arbeiten. Trotzdem nehme ich abends das Auto für die Freizeit. Da liegt der Verdacht nah, dass die S-Bahn kontraproduktiv war.
Je besser die Verkehrsinfrastruktur ist, umso selbstverständlicher wird der Anspruch auf Erreichbarkeit.
Schiffer: Wer produziert denn den ganzen Verkehr? Die Antwort schmerzt: Ich bin es. Die
Entscheidung, ob ich abends noch das Auto für die Freizeit nutze, liegt bei mir. Wir sollten über den realpolitischen Diskurs hinaus über uns selbst nachdenken, um zu verstehen, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Wie wollen wir unsere Probleme lösen, wenn wir nicht einmal die Problemstellungen selbst genauer in den Blick nehmen? Die «Lösungen», die wir produzieren, bleiben immer auf der Ebene von «Schiene oder Strasse», «längeren
oder kürzeren Verkehrswegen» usw. Die eigentliche Frage – was wir uns unter einem guten menschlichen Leben vorstellen – berühren wir nicht einmal.
Zum Schluss eine Frage zu einem technischen Lösungsansatz. Um den Verkehr zu steuern, wird Mobility Pricing in verschiedenen Varianten diskutiert. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Hänggi: Ich finde diesen Ansatz gefährlich. Betrachtet man Mobilität als das, was die Ökonomie als Gemeingut ansieht, geht der Wert verloren, wenn Einzelne das Gemeingut übernutzen. Die klassische Antwort der Ökonomie ist, dass man das Gut handelbar macht. Mobility Pricing ist genau das. Die Leute übernutzen die Verkehrsinfrastrukturen, also muss man sie verteuern. Aus ökonomischer Sicht wird es meist positiv bewertet, aber die Schwächsten kommen unter die Räder. Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Mit Mobility Pricing spart derjenige Zeit, der es sich leisten kann. Das ist gesellschaftlich von einer unglaublichen Tragweite. Wenn ein Mensch, der mehr Geld zur Verfügung hat, mich dazu zwingen kann, Zeit zu verlieren, ist das für eine egalitäre Gesellschaft inakzeptabel. Ich bin durchaus der Meinung, dass der Verkehr weit davon entfernt ist, seine Infrastrukturen zu finanzieren, und dass das korrigiert werden muss, aber mit Mobility Pricing führen wir soziale Probleme ein.
Schiffer: Soziale Probleme, von denen wir glauben, sie überwunden zu haben, und die einer liberalen Gesellschaft unwürdig sind. Bei dem amerikanischen Philosophen Michael Sandel bin ich in diesem Zusammenhang noch auf ein anderes Argument gestossen: Klimaabgaben und Mobility Pricing würden zur Annahme verführen, es gebe ein Recht auf Emissionen und beschleunigte Mobilität, und dieses sei käuflich. Zudem entstehe die Illusion, ständig herumzufliegen oder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs zu sein seien Werte an sich, schliesslich habe man dafür bezahlt, und wofür man bezahle, sei wertvoll. Worum es einer zeitgemässen philosophischen Ethik geht, ist die Reflexion und der Dialog über das, was wir wirklich wertvoll finden. Können wir uns überhaupt ein anderes, weniger gnadenlos beschleunigtes menschliches Zusammenleben vorstellen als das gegenwärtige?TEC21, So., 2015.02.22
22. Februar 2015 Daniela Dietsche, Katharina Möschinger