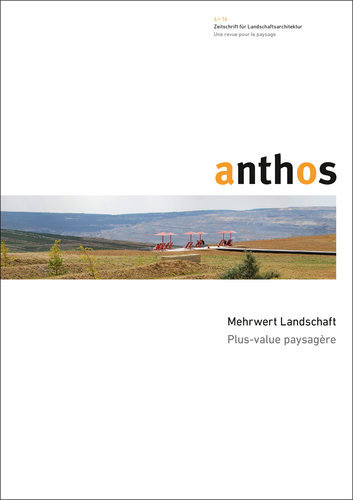Editorial
Naherholungsmöglichkeiten und Landschaftsqualitäten haben steigenden Einfluss auf die Standortwahl von Familien und Unternehmen. Sie gehören damit zu den zentralen Stellgrössen im globalen Wettbewerb um wirtschaftliche Prosperität und Attraktivität. Wo internationale Konzerne Landschaft als Ressource für ihre Profilierung entdecken, wird viel Geld in aufwändig gestaltete Freiräume investiert. Aus fachlicher Perspektive ist diese Entwicklung nicht unproblematisch: Wenn Kommunen das Zepter aus der Hand geben und die Gestaltung des öffentlichen Raums ökonomischen Regulativen überlassen, geht auch dessen Lesbarkeit verloren.
Es stellt eines der elementaren Menschenrechte, die Versammlungsfreiheit, infrage, wenn nicht mehr sichtbar ist, wo die Grenzen zwischen öffentlich und privat verlaufen – und damit auch, wer die Spielregeln bestimmt. Die politische wie fachliche Diskussion zu den Akteuren im öffentlichen Raum und dessen Bedeutung für Individuum und Gesellschaft ist überfällig. Und sie ist dringlicher denn je, weil leere Haushaltskassen nicht zulasten der Freiraumqualität gehen dürfen. Es ist eine mehr als fragwürdige Entwicklung, dass der urbane Freiraum, und mit ihm die Fachdisziplinen, im zunehmend hart ausgefochtenen Verteilkampf um Gelder regelmässig hinten ansteht, während er gleichzeitig in internationalen Rankings als Ressource für Lebensqualität Treppchen für Treppchen nach oben klettert und längst mehr als ein Softfaktor ist.
Wir zehren von der Substanz. Wo stünden wir heute ohne die grossen Stadtparks, Spielplätze und Uferanlagen des 19. Jahrhunderts, die den städtischen Raum bereichern und prägen? Wenn der Mitteleinsatz in den öffentlichen Raum derzeit hauptsächlich in Unterhalt und Pflege, nicht aber in die Entwicklung qualitativ hochwertiger Freiräume investiert wird, liegt das auch daran, dass die Landschaftsarchitektur als Disziplin gerade jetzt, da sie als Anwältin der Landschaft nötiger denn je wäre, scheinbar an gesellschaftlichem Stellenwert eingebüsst hat. Wir dürfen den Stadtraum als Plattform des öffentlichen Lebens nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Es braucht neue Instrumente und Strategien und es ist Zeit, zu handeln.
Ende Oktober fand in Basel der dritte, gemeinsam von BSLA und IBA Basel 2020 organisierte Landschaftskongress zum Thema «Mehrwert Landschaft» statt. anthos ist erneut Medienpartner und präsentiert in dieser Ausgabe die zentralen Ansätze der Referentinnen und Referenten. Ergänzend haben wir weitere Autorinnen und Autoren eingeladen, sich am Diskurs zu beteiligen. Zur besseren Übersicht sind die Kongressbeiträge mit einem gelben Band am unteren Seitenrand gekennzeichnet.
Sabine Wolf
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Landschaftskongress: Programm / Zwischenrufe zur Landschaft 2014
Stefan Klein: Die Ökonomie des Glücks
Nicole Uhrig: Vom Wert des Freiraums für Unternehmen
Lars Ruge: Novartis Campus: Erfolg durch mehr Grün?
Lukas Schweingruber: Mehrwert Landschaft in der Agglomeration?
Lorette Coen: Das rote Herz von Genf
Cécile Léonhardt: Natur als Innovation für den Städtetourismus
Salomé Mall, Andreas Courvoisier: Von der geschlossenen zur offenen Landschaft
Sarah Bösch: Landschaftsqualitätsprojekte: Chancen oder viel Lärm um nichts?
Thomas Kemme: Blau-grüne Infrastruktur
Cyril Kennel: Orte zum Mitnehmen: Swissness verkauft sich gut
Roger Keller, Norman Backhaus: Blicke auf die Landschaft
Wolfram Kägi: Landschaftsqualität als Standortfaktor
Volker Schopp: Landschaft geniessen!
Bernd Hansjürgens, Urs Moesenfechtel: Monetäre Bewertung von Landschaft
Berno Strootman: Ganzheitliche Entwurfsansätze – Beispiele aus den Niederlanden
Susanne Fischer: Der Landschaftspark Wiese als IBA-Projekt
Vom Wert des Freiraums für Unternehmen
Die Gestaltung ihrer Freiräume nutzen Unternehmen immer bewusster als strategisches Instrumentarium. Was zunächst das Spektrum der urbanen Landschaft bereichert, wird schnell problematisch, wenn Kommunen sich zurückziehen und den privaten Bauherren das Feld überlassen.
Während sich das Thema der Corporate Architecture als Kommunikationsinstrument für Unternehmen schon wesentlich früher etablieren konnte, wird indessen auch in Corporate Landscapes investiert. Handelt es sich beim Auftraggeber um ein Unternehmen, ist die Berücksichtigung der Corporate Identity CI meist Teil der landschaftsarchitektonischen Entwurfsarbeit. Die CI besteht aus den drei Komponenten Corporate Design, Corporate Behaviour und Corporate Communication und ist das zentrale strategische Instrument für die gezielt eingesetzte Selbstdarstellung und Verhaltensweise eines Unternehmens.
Strategien grüner Unternehmenskommunikation
Während sich die Corporate Landscapes der 1980er- bis in die 2000er-Jahre noch stärker über das Corporate Design definierten, verschiebt sich der Schwerpunkt der Entwurfsstrategien heute immer mehr in Richtung der Komponenten Corporate Communication und Behaviour. Häufig wurde die Landschaftsarchitektur eines Unternehmensstandortes lediglich als grüne Visitenkarte betrachtet, welche die Architektur aufwerten und mittels repräsentativer, qualitätsvoller Gestaltung Hochwertigkeit im weitesten Sinne vermitteln sollte.
Mit dem Ziel, die CI eines Unternehmens möglichst treffsicher zu kommunizieren, haben sich mit der Zeit differenziertere Strategien entwickelt, die weit über den ästhetischen und funktionalen Mehrwert einer gelungenen Landschaftsarchitektur hinausgehen. Vom schlichten Transfer grafischer Symbole und Logos in den Freiraum über die Aufwertung des Arbeitsumfelds für aktive und rekreative Erholungsmöglichkeiten bis hin zu gezielten Angeboten zur Interaktivität im Freiraum, die auf emotionale Erlebnisse und auf die Identifikation mit dem Unternehmen abzielen.
Unternehmensverantwortung
In den letzten Jahren ist das Thema der Unternehmensverantwortung innerhalb des Corporate-Identity-Konzeptes in seinem Stellenwert weit nach vorne gerückt. Vor dem Hintergrund von Wirtschaftskrisen, Missmanagement und Umweltproblemen gewinnt die Kommunikation über das Verhalten eines Unternehmens und die Unternehmensethik im Sinne von Sozialverträglichkeit und Verpflichtung gegenüber Mensch und Umwelt zunehmend an Bedeutung. Diese unternehmerische Verantwortung für das Gemeinwohl prägte den Begriff Corporate (Social) Responsibility CSR. Konkret geht es um Initiativen zu Themen wie Ökologie, Naturschutz, Nachhaltigkeit, Kunst, Kultur, eine ethisch korrekte Personalpolitik und allgemein soziale Themen. Eine Studie des imug Instituts für Markt–Umwelt–Gesellschaft an der Universität Hannover konnte beweisen, dass CSR-relevante Informationen zum Unternehmen sogar Kaufrelevanz besitzen.[1] Eine Vernachlässigung der CSR ist für das Image eines Unternehmens hingegen längst nicht mehr zeitgemäss.
Privater Raum, öffentliche Nutzung?
In der Entwicklung der Corporate Landscapes lässt sich neben einem sich verstärkenden, leider nicht selten nur vordergründig[2] eingesetzten Umweltengagement vor allem ein Trend zur «open door policy» erkennen. Vermehrt geben Unternehmen den gestalteten Freiraum ihres privaten Grundstücks zur öffentlichen Nutzung frei. Damit verfolgen sie dreierlei Ziele: erstens einer geforderten Corporate Transparency nachzukommen und Aufgeschlossenheit zu zeigen, zweitens im Rahmen der CSR gesellschaftliches Engagement zu zeigen und drittens eine direkte Kontaktstelle zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit als potenziellem Kunden herzustellen.
Angesichts mangelnder Budgets der öffentlichen Hand zur Unterhaltung öffentlicher Freianlagen wird jene Art der öffentlich-privaten Raumproduktion dankbar angenommen. In Kopenhagen gestalten die SEB Bank und das Unternehmen KPMG die Vorplätze ihrer Headquarter als öffentliche Stadträume, der üppige Garten der Helvetia Versicherung in St. Gallen fungiert als öffentliche Wegeverbindung zur benachbarten Universität, und Berlin wurde kürzlich um eine öffentlich nutzbare Dachterrasse auf der Bikini Concept Mall bereichert.
Risikopotenzial
Zwar kommt mit der Investition in öffentlich nutzbare Baukultur Verantwortung für das Gemeinwohl zum Ausdruck, und das Potenzial, das sich damit für die Aufenthaltsqualität unserer Städte in Zukunft ergibt, ist nicht zu unterschätzen. Durchaus könnten Landschaftsarchitekten auch vermehrt als Vermittler zwischen Unternehmen und verschiedenen Interessengruppen agieren, synergetisch wirksame Allianzen und Win-Win-Beziehungen erarbeiten, gemeinsame Ziele identifizieren oder Konflikte moderieren. Doch ist die Problematik solch hybrider Räume, die sich im Spannungsfeld zwischen privat und öffentlich befinden, seit Langem bekannt.[3] Ein Unternehmen ist in erster Linie wirtschaftlich motiviert und kann sich jederzeit von seinem Engagement zurückziehen oder von seinem Hausrecht Gebrauch machen, indem Öffnungszeiten vorgegeben werden, allgemeine Grundrechte wie die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt oder bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden.
Aus diesem Grund können jene vermeintlich öffentlichen Freiräume immer nur als «add-on» zu einem bestehenden Grundgerüst aus funktionsfähigen, öffentlichen Freiräumen in der Stadt verstanden werden. Ein Ersatz für fehlende Investitionen der öffentlichen Hand sind sie nicht.
Anmerkungen:
[01] Vgl. Institut für Markt–Umwelt–Gesellschaft (Hg.): Wirkungen von vergleichenden Untersuchungen zur Corporate Social Responsibility bei Verbrauchern – am Beispiel der Stiftung Warentest. imug Arbeitspapier 16 /2006. Hannover, 2006.
[02] Als «Greenwashing» bezeichnet man den Versuch von Unternehmen, ein «grünes Image» zu erlangen, ohne die entsprechenden Massnahmen im Rahmen des Umweltengagements umzusetzen.
[03] Vgl. Forschungsprojekt STARS «Stadträume in Spannungsfeldern» (2007–2011), RWTH Aachen.TEC21, So., 2014.11.30
30. November 2014 Nicole Uhrig