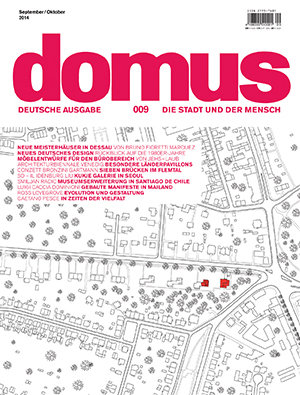Editorial
Manche Generationen fassen die Architektur ihrer Vorfahren als lästigen Ballast auf und bemühen sich, ihn ohne Umschweife loszuwerden. So beschloss die Hamburger Bürgerschaft 1804, den großen gotischen Dom der Hansestadt abzureißen. Heute erinnert nur noch der Rummel - die Hamburger nennen ihn `Dom´- an die alte Marienkirche. Braunschweig wiederum entledigte sich 1961 seines Welfenschlosses. Einige Jahrzehnte später jedoch wollten die Braunschweiger ihr Schloss wieder haben und ließen den spätklassizistischen Bau als Shopping Mall wiederauferstehen. In Berlin vollzieht sich diese Abriss- und Wiederaufbauwut nach bekanntem Schema: Weil es den DDR-Funktionären ein Dorn im Auge war, wurde das Stadtschloss gesprengt und stattdessen der Palast der Republik gebaut. Nach dessen Abriss wird nun das historische Stadtschloss rekonstruiert. Wie rücksichtslos oft mit dem kulturellen Erbe umgegangen wird, zeigt auch die Dresdner Waldschlösschenbrücke. Ein Bürgerentscheid beschloss den Bau der vierspurigen Autobrücke, mit der die Kulturlandschaft des Dresdner Elbtals ihren Welterbetitel der UNESCO verlor.
Das Bauhaus Dessau steht seit 1996 auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO, besondere Vorsicht im Umgang mit dem Gropius-Vermächtnis ist nicht nur deshalb geboten. Trotzdem entschied man sich im Fall der beiden neu errichteten Meisterhäuser - seit dem 2. Weltkrieg war von ihnen gar nichts mehr übrig oder nur noch die Fundamente - gegen eine historische Rekonstruktion.
Stattdessen sind die neuen Häuser Gropius und Moholy-Nagy eine Interpretation der historischen Architektur von Walter Gropius.
Bruno Fioretti Marquez Architekten gaben dem heutigen Mythos Bauhaus mit ihrem Entwurf ein Gesicht, das zugleich Nähe zu den ursprünglichen Planungen vermittelt und Unterschiede nicht verheimlicht, sondern deutlich zu erkennen gibt. Abstrahierte Flächen und reduzierte Volumen, deren Kubatur sich an die Entwürfe von Gropius hält, lassen die Gebäude wie Modelle erscheinen. In ihrer `präzisen Unschärfe´, wie die Architekten ihr Konzept nennen, offenbaren die Häuser einerseits ihren historischen Abstand und beziehen sich andererseits dennoch auf die architektonischen Grundprinzipien des Bauhauses. Insgesamt zeigen die beiden Neubauten einen alternativen Weg auf im Umgang mit dem historischen Kulturerbe und der Erinnerung daran. Statt der Rekonstruktion einer Kopie übertragen sie den Gehalt dieses Erbes auf die Gegenwart und machen das Bauhaus im Hier und Jetzt lebendig. Wir zeigen Ihnen die neuen Meisterhäuser in den exklusiven und beeindruckenden Aufnahmen von Armin Linke, die Ihnen einen Vorgeschmack auf seinen Fotoessay zum Thema geben, der bei Spector Books erscheinen wird. Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe noch verschiedene weitere Projekte, die sich ähnlich wie die neuen Meisterhäuser auf einen bedachten Umgang mit dem kulturellen Erbe einlassen - sei es in den Bergen Graubündens, in Santiago de Chile, wo Smiljan Radic das Chilenische Museum für präkolumbische Kunst erweitert hat, oder in Castelo Branco in Portugal. Dort gelang es dem spanischen Architekten Josep Lluís Mateo, die Ortsmitte durch einen neuen Kulturbau wiederzubeleben.
Im Design-Teil dieser Ausgabe stellen wir aktuelle Entwürfe der Stuttgarter Designer Jehs Laub samt ihrer Expertise für Möbel im Bürobereich vor. Wir halten außerdem die Arbeitsweise von Alan Kitching fest. Der britische Typograf arbeitet in seinem Londoner Atelier mit alten Bleisätzen. Schließlich blicken wir zurück auf das Neue Deutsche Design der 1980er-Jahre: Es ist längst an der Zeit, auch dieses kulturelle Erbe neu zu entdecken.
Bevor Sie mit der Lektüre beginnen, noch eine Notiz in eigener Sache: Einige unserer Beiträge sind von den entsprechenden Architekten, Designern oder Künstlern selbst verfasst. Wir übernehmen hier die Linie, die Nicola Di Battista, Chefredakteur der italienischen Domus, seit September letzten Jahres für die Zeitschrift vorgegeben hat. Über Architektur und Design wird viel - manchmal vielleicht zu viel - gesprochen. Jeder fühlt sich heute zum Kritiker berufen, so die Grundüberlegung dieses redaktionellen Konzepts. Nicola Di Battista hat sich daher auf ein früheres Markenzeichen der Domus besonnen. Schon seinerzeit hatten namhafte Protagonisten wie Gio Ponti, Le Corbusier oder Achille Castiglioni ihre Projekte selbst vorgestellt. Wir ergänzen diese Ausrichtung in der deutschen Ausgabe durch eigene lokale Schwerpunkte und eine journalistische Note, mit der unsere Autoren ihre Beobachtungen festhalten, kommentieren und kritisieren.
Die Redaktion