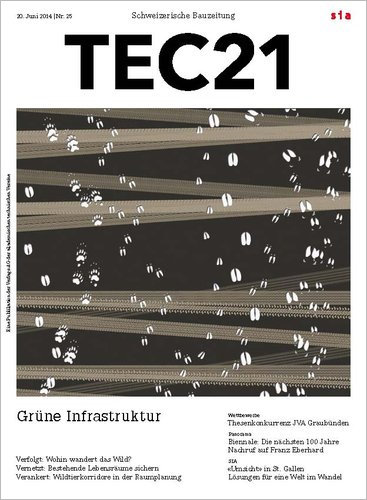Editorial
Im kürzlich erschienen Kinderbuch «Der Hase und der Maulwurf» von Hans de Beer läuft der Hase jeden Tag mehrmals zur Autobahn und schaut sehnsüchtig auf die andere Strassenseite. Bis vor Kurzem wohnte er dort, doch weil er wissen wollte, wie es auf der anderen Seite aussieht, beschloss er eines Tages, die Autobahn zu überqueren. Aber durch den starken Windstoss eines Lastwagens wurde der Hase an die Leitplanke geworfen und verletzt … Am Ende schaffen es die Waldtiere gemeinsam, einen Tunnel unter der Autobahn zu graben, um künftig sicher die Seiten wechseln zu können.
Das Problem der Zerschneidung der Lebensräume von Wildtieren und die scheinbar einfache Lösung sind inzwischen in den Kinderzimmern angekommen. Was zerschnitten ist, lässt sich auch wieder zusammenfügen.
Doch wie sieht es in der Realität aus, wenn wir Menschen solche Lösungen für Tiere entwickeln? Wir studieren das Verhalten der Wildtiere, um herauszufinden, wo sie wandern und was sie zum Leben brauchen; wir verankern diese Wildtierkorridore in den kantonalen Richtplänen und bauen spezifische Über- oder Unterführungen. Im Anschluss kontrollieren wir, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Es wird bereits viel Geld investiert, um die ökologische Vernetzung wiederherzustellen. Gleichzeitig entstehen weitere Verkehrswege, und die Siedlungsflächen dehnen sich aus, was diesen Bemühungen wiederum zuwiderläuft.
Daniela Dietsche