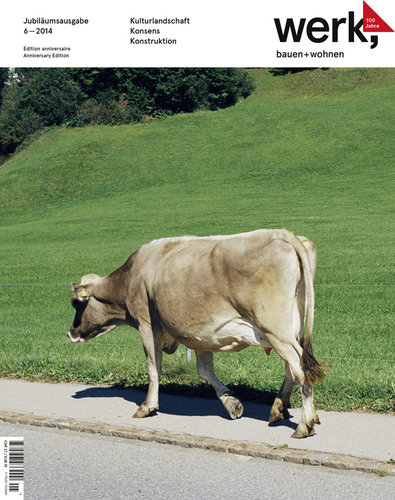Editorial
Zum hundertsten Geburtstag unserer Zeitschrift fragen wir nach dem Stand der Dinge in der Schweizer Architektur. Dabei leiten uns drei Themen, die uns für die Baukultur dieses Landes konstitutiv scheinen: Die urbane und ländliche Kulturlandschaft als allgegenwärtige Voraussetzung des architektonischen Schaffens, Konstruktion als Form des Ausdrucks und schliesslich gesellschaftlicher Konsens als städtebauliche Praxis und als Voraussetzung öffentlicher Repräsentation.
Seit fünfzehn Jahren herrscht in der Schweizer Bauwirtschaft Hochkonjunktur, scheinbar unbeeinflusst von der Krise in Europa. Stille Landschaften sind selten geworden, Mobilität ist überall. In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts hat sich die Schweiz sichtbarer verändert als in Jahrzehnten davor. In diesem Aufschwung spielen Architekten eine zentrale Rolle: Architektur ist zu einem öffentlichen Thema geworden. Nicht nur die öffentliche Hand, auch private Entwickler und Investoren setzen heute auf den Reputationswert guter Architektur, gerade auch mit Wettbewerben. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern haben daher in der Schweiz auch junge Büros oder unkonventionelle Entwürfe eine Chance, sich durchzusetzen. Eingeschränkt wird diese Freiheit durch den Druck von Kosten und Rendite und durch einen laufend perfektionierten Wust von Vorschriften und Normen.
Wachstum bringt jedoch nicht nur Gewinner hervor, sondern auch relative Verlierer; die Veränderung des Lebensraums wirft Identitäts- und Orientierungsfragen auf. Abstimmungsresultate zur Personenfreizügigkeit oder zu Raumplanung und Zweitwohnungen bringen ein gesellschaftliches Malaise zum Ausdruck – ein Gefühl der Entfremdung angesichts einer Entwicklung, die allein von anonymen Marktkräften gesteuert zu sein scheint. Architektur alleine kann dieses Malaise nicht heilen. Damit Orte entstehen, die Kraft und Charakter besitzen, braucht es zwar starke Setzungen, aber ebenso auch die Präsenz und Partizipation der Nutzer, die sich ein funktionierendes Umfeld zu eigen machen. Landschaften, die man immer wieder besuchen möchte, entstehen oder überleben nicht aufgrund eines Entwurfs, sondern dank ausdauernder Pflege, an der viele Akteure, ganze Gemeinden und Regionen beteiligt sind. Und eine nachhaltige Entwicklung, die jenseits von perfekten Detaillösungen Räume zum Leben und Orte der Gemeinschaft entstehen lässt, setzt gesellschaftliche Beteiligung voraus.