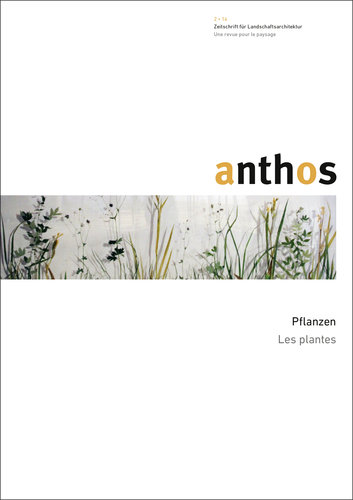Editorial
Sie sind die Quintessenz des Gartens. Ihre überwältigende Schönheit ist wohl eine der wichtigsten Motivationen für die Leidenschaft des Gärtnerns. Ihre unermessliche Vielfalt bietet Grund zum Staunen und erweckt Neugier. Sie machen Lust, immer wieder neu hinzuschauen: hinab zum Mooswinzling und hinauf zum Mammutbaum. Ihre Blüten, Blätter, Wurzeln legen vom unglaublichen Erfindungsgeist der Evolution Zeugnis ab. Sie belegen die evolutionäre Gestaltungskraft für Hochtechnologie im Kleinen und im Grossen und haben teil an der bisher unnachahmbaren Komplexität und Resistenz von Ökosystemen. Pflanzengesellschaften – Teil der Landschaftsgemälde der Natur – inspirieren die Arbeit von Landschaftsarchitekten.
In der Renaissance wurden Natur und Kunst als schöpferische Kräfte gesehen, die sich dialektisch gegenüberstehen und deren Beziehung durch ein gegenseitiges Geben und Nehmen gekennzeichnet ist.
Auch heute – und vielleicht seit seinen Anfängen in der Jungsteinzeit – bleibt der Garten der Ort, an dem wir Natur und Kultur zu einem Kunstwerk verflechten.
Aus dieser Verbindung entwickelte sich ein reicher landschaftsarchitektonischer Wortschatz der Pflanzenverwendung: Allee, Baum-, Strauch- und Staudenhecke, Staudenrabatte, Pflanzung nach Lebensbereichen, Misch- und Flächenpflanzung, Rasenfläche, -weg und Rasenbeet, Blumenbeet, Blumenstreuung, Blumenwiese, Pflanzenfigur, Fassaden- und Dachbegrünung, Säulengang, Pergola, Palisade, Knotengarten und Broderieparterre … Begriffe, die nur einen Bruchteil der Werkzeuge gestalterischer Gartenkunst benennen.
Das vorliegende anthos präsentiert aktuelle, fein entworfene Gärten, weist auf durch langjährige Forschung gestützte Pflanzsysteme hin, gibt Gedanken zu Geschichte und Lehre der Pflanzenverwendung Platz. Es zeigt, wie ideenreich und gekonnt das «alte» Material Pflanze für heutige Bedürfnisse verwendet werden kann.
Zwei wichtige Akteure der Freiraumgestaltung in der Schweiz erhalten in dieser Ausgabe Raum: Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA startet seine Interviewserie «Ansichtssache», die von nun an ihren festen Platz in anthos hat. Persönlichkeiten, welche die Schweizer Landschaftsarchitektur in besonderer Weise geprägt haben, kommen darin zu Wort.
Ausserdem erscheint anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter VSSG eine zwölfseitige Festschrift. Die VSSG wirft darin einen Blick in Vergangenheit sowie Gegenwart und formuliert Visionen für ihre Zukunft. anthos gratuliert!
Stéphanie Perrochet
Inhalt
Lars Ruge: Ein Spaziergang mit Linné
Mark Krieger: Drei aktuelle Tendenzen der Pflanzenverwendung
Natacha Guillaumont: Landschaft lernen
Ursula Yelin, Stephan Aeschlimann Yelin: Natürliche Pflanzkonzepte für den Garten
Axel Heinrich: Stauden_Misch_Pflanzungen
Elisabeth Jacob: Wenn die Gärtnerin und der Landschaftsarchitekt …
Françoise Martinez Monney: Lebendige Gemälde
Nicole Badin: Historische Rosensorten
Hikari Kikuchi, Blaise Bourgeois: Spiel mit den einheimischen Arten
Maja Tobler, Olivier Zuber: Der verlorene Garten im Herzen Brasiliens
Claudia Moll: Pflanzenvielfalt als Repräsentation
Jacqueline Osty: Natürlich städtisch
Bertil O. Krüsi: Hochlagenbegrünung
Margrith Göldi Hofbauer: Beeinflussen neue Schadorganismen künftig das Bild unserer Städte?
Alexandre Aebi, Nicolas Derungs, Joël Amossé, Gaëtan Morard, Julien Vuilleumier: Die Universität Neuenburg im Dienst der städtischen Biodiversität
Spiel mit den einheimischen Arten
Wie können wir in der allgemeinen Abschottungsstimmung unsere Lust auf die weite Welt und den botanischen Austausch leben? Vom Grundsatz ausgehend, dass es keine schlechten Pflanzen gibt, ist der Landschaftsarchitekt eingeladen, auf feinfühlige Weise mit ihnen zu spielen.
Die Profession kann mit unterschiedlichen Prioritäten, Arbeitsfeldern und Blickwinkeln ausgeübt werden. Für das Büro OXALIS architectes paysagistes associés Sàrl sind der direkte Bezug zur Materie und die Pluridisziplinarität grundlegend. In unserer Epoche der Querbeziehungen der Arbeitsbereiche scheint es entscheidend, die Schichten und Kreisläufe eines landschaftlichen Ensembles zu identifizieren, um anschliessend eine schöne Palette von pflanzlichen – und anderen – Komponenten auf passende und dauerhafte Art in den spezifischen Ort zu integrieren. Wegen ihrer Vielfalt, ihrer Unbeständigkeit und ihrer Bedürfnisse sind Pflanzen das faszinierendste Kompositionsmaterial.
Unser Team stillt seine Neugier und seine Lust auf Exotik im Ausland, vergisst dabei aber nicht, auch die vielfältige lokale Landschaft grossräumig zu erkunden. Einheimische Pflanzen sind «Inspirationsquelle» oder sind «perfekt angepasst» für ihre Einbindung in die Gestaltung der Umgebung und /oder der Architektur, aber sie sind nicht das Auswahlkriterium sine qua non. Ausserdem ist der Begriff «einheimisch» natürlich relativ. Es genügt, seinen Aufenthaltsort zu ändern, und der Fremde wird zum Einheimischen.
Ausser Landes spielt das Büro mit den Silhouetten des Torre Agbar und der Sagrada Familia, die aus der Skyline Barcelonas aufragen.
Die Fassaden des Singapore Freeport werden von einer ganzen Reihe aus endemischen, aber nicht im Land kultivierten Aronstabgewächsen besiedelt, sie sind wegen ihres Rufs als Unkraut nicht sehr beliebt. Um diese Pflanzensammlung zusammenzustellen, mussten Mutterpflanzen aus dem Botanischen Garten in Genf durch Stecklinge vermehrt werden. Der Gipfel!
Im Innenhof des UEFA-Gebäudes entsteht durch grosse Trauer-Mammutbäume ein eindrucksvoll-pittoreskes Bild, welches im Kontrast zu den ausserhalb gepflanzten einheimischen Sträuchern steht. In Schönried wurden einheimische Gehölze gewählt, in Sorten, die an Zwergkiefern erinnern oder andere Höhenvegetation nachahmen. Der Steingarten in den Fugen der Bodenplatten ist eine Re-Interpretation mit Thymian, Fetthenne und Ziersteinbrech. An der Brücke Wilsdorf erinnern typische Arten des Auenwalds an die naheliegende Arve und zeigen einen Ort mit Erlen an: «Les Vernets». Auch hier wurden gezüchtete Erlen- und Weidensorten gewählt, wegen ihrer besonderen Wuchsform, ihrer Leichtigkeit, des jahreszeitlichen und poetischen Ausdrucks.anthos, Mo., 2014.05.26
26. Mai 2014 Hikari Kikuchi, Blaise Bourgeois