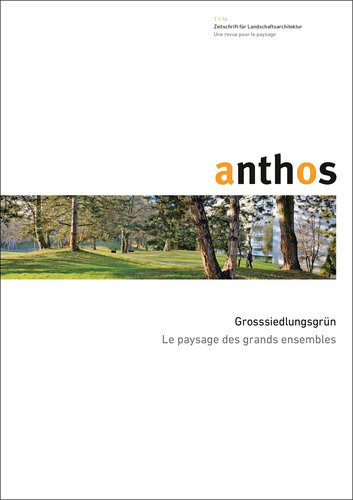Editorial
Man muss nicht immer neue Begriffe erfinden. Doch manchmal schadet das nicht. Etwa wenn ein vernachlässigtes Thema so zu Geltung gelangt: «Grosssiedlungsgrün». Nach der Stigmatisierung grosser Wohnsiedlungen mitsamt ihren Aussenräumen als «Ghettos» und «Sozialbunker» und dem gegenläufigen Faible für Plattenbauten im Mäntelchen neuen Revoluzzertums machen sich heute verschiedene Ansätze bemerkbar, die «Planwelten der Moderne» zu normalisieren.
Vielleicht ist es unser derzeitiger Abstand zu städtebaulichen Schablonen, der unsere zwischen «Planstadt» und «Informalität» changierende Gegenwart charakterisiert. Doch wenn formlose Agglomerationen Randständiges verschlucken, können neue Ordnungsmuster deutlich werden, die eine alternative Geschichte des Städtebaus erzählen. Diese würde Grosssiedlungen nicht als reaktive Projekte verstehen, sie nicht aus dem alten Stadtkörper herauslösen, als isolierte Rümpfe brandmarken, die wir in den spielerischen Collagen eines Hans Hollein gerade noch akzeptieren.
Eine solche Narration dürfte diesen Typus nicht per definitionem nach 1945 ansiedeln, als homogen, schnell gebaut, dicht, gross und fremd werten, sondern würde ihn in der «europäischen Stadt» verankern. Schliesslich gehorchten auch die gigantischen Umbauprojekte des 19. Jahrhunderts einer ähnlichen Logik, böten somit Ausgangspunkte einer Neueinschätzung. Das freilich sollte uns dabei helfen, Grosssiedlungen weiterhin auch kritisch zu sehen. Und gerade dabei hilft «Grosssiedlungsgrün».
Grosssiedlungen sind von der Landschaftsarchitektur aus betrachtet keine Figur-Grund-Wahrnehmungen mehr. Sie sind nicht aus grossräumlichen Aspekten lösbar, sind mehr oder weniger gut in der (Stadt-)Landschaft verortet und prägen diese. Es ginge um eine Typologie, die in Ebenezer Howards «Magneten», Georg Metzendorfs «Hügelstadt», Ernst Mays Trabanten über den Niddaauen Frankfurts oder den Grosssiedlungen in Berlin und Aarau diverse Entwicklungsschritte macht. Wenn einzelnen Grosssiedlungen heute bereits Würdigung zukommt, bezieht sich diese noch immer fast ausnahmslos auf Gebäude. Indes übernehmen gerade hier die Aussenräume zentrale Funktionen, auch im Sozialleben der Bewohner. Was aber ist das überhaupt: Grosssiedlungsgrün? Wer misst ihm jene Bedeutung bei, die ihm beim Funktionieren, Weiterbestehen und Reaktivieren von Siedlungen, mehr noch als der Neuanstrich über Dämmplatten, zukommt?
Dass nichts neu erfunden werden kann, ist eine alte Pointe. Neue Lesarten, die Kontinuitäten erkennen, verhelfen aber zu produktiven Blicken – etwa auf die Grosssiedlung und ihr «Grün». Diese Ausgabe möchte helfen, sie freizulegen.
Sabine Wolf, Albert Kirchengast