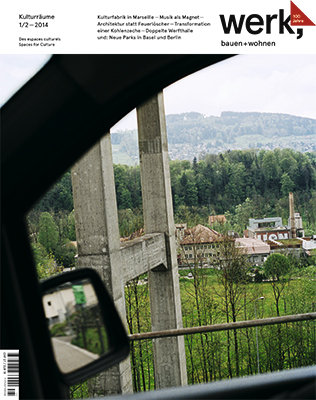Editorial
Die Kulturproduktion lebt in einem markanten Gegensatz: Hier die «Paläste», mit grosszügigen Subventionen geförderte Institutionen des Bildungsbürgertums, installiert in prächtigen Gebäuden an zentralen innerstädtischen Lagen; dort die «Hütten», deren Protagonisten im wirtschaftlichen Prekariat verharren – labile, sich ständig neu formierende Gruppen mit kurzer Halbwertszeit, die sich dort einnisten, wo man sie lässt. Das erste Heft des neuen Jahrgangs zeigt Räume, in denen Kultur nicht nur dargeboten, sondern produziert, erdacht und erarbeitet wird. In allen Fällen sind es brachliegende Industriebauten – von der Mühle über die Kohlenmine bis zur Werfthalle –, die einen sperrigen Rahmen und Räume von ungewöhnlichem Format bieten. Und alle haben das Potenzial, «Paläste» zu werden. Die Strategien der Anpassung sind so verschieden wie die zur Verfügung stehenden Bauten und die vorhandenen Mittel: Schnelle Besetzung und Programmierung in Genf; minimalistischer Pragmatismus in Winterthur und Marseille; überwältigende räumliche Opulenz in Genk und in Dünkirchen.
Mit dem Jahrgang 2014 feiern wir die ersten 100 Jahre der Zeitschrift «Werk». Am Vorabend des Ersten Weltkriegs wurde unser Heft vom Bund Schweizer Architekten BSA und dem 1913 gegründeten Schweizerischen Werkbund aus der Taufe gehoben.
Die Gründung des «Werk» fiel in eine Zeit, die die Grundlagen von Kunst und Architektur neu zu denken versuchte. Eine junge Generation von Architekten, Kunstschaffenden und Gestaltern entzog sich dem Schematismus der Tradition und war erfüllt von der Suche nach einer neuen sozialen Verantwortung, einem nationalen Standpunkt und der Einheit von Architektur und Kunst. Das «Werk» bildet seitdem die repräsentativste Stimme der Schweizer Architektur und ein Forum für grundlegende Debatten. Im Jubiläumsjahr greifen wir die wichtigsten Eckpunkte wieder auf: Bernadette Fülscher wählte zehn wichtige Beiträge aus 100 Jahren aus – zehn heutige Protagonistinnen und Protagonisten schreiben zum gleichen Thema aus heutiger Sicht.