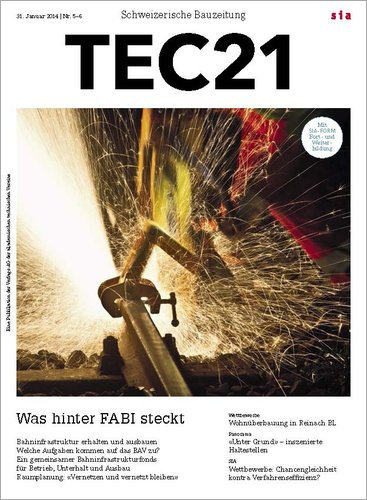Editorial
Um Zeit und Platz zu sparen, werden bekannte Begriffe gern abgekürzt. SBB, öV, GA usw. sind aus der Alltagssprache nicht mehr wegzudenken. Bei fremdsprachigen Begriffen wie asap, pps oder TQM kennt man möglicherweise nicht die korrekte Bedeutung, weiss aber wohl, was damit gemeint ist. Spricht in der Baubranche jemand von GBT, LSVA oder BAV, ist das in der Regel für die Beteiligten ebenfalls verständlich. Wenn aber weitgehend fachfremde Personen mit fachlichen Abkürzungen konfrontiert werden, wird es schwierig.
Am 9. Februar wird über FABI abgestimmt, die Botschaft zur Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur. In direktem Zusammenhang dazu stehen STEP und BIF, im weiteren Sinn
auch NEAT, HGV, ZEB u. Ä. Was sich hinter FABI, STEP und BIF verbirgt und wie sich die Projekte in die bereits laufenden Grossprojekte einordnen lassen, ist nicht leicht zu durchschauen.
Darüber abzustimmen noch schwieriger.
Damit auch Nichtfachleute kompetent abstimmen können, haben wir mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) die derzeitigen Arbeiten und Planungen im Bereich Bahninfrastruktur erörtert. Dort arbeitet man bereits an der Vorlage für 2018, da im Gegensatz zu früheren Bahnprogrammen künftig etappiert vorgegangen werden soll. Neu gilt bei Ausbauprojekten der Grundsatz: Kapazitätssteigerung vor Geschwindigkeitserhöhung. Zudem sollen die Projekte aus einem einzigen, unbefristeten Fonds finanziert werden.
Daniela Dietsche
Inhalt
08 WETTBEWERBE
Haus und Park werden eins
9 PANORAMA
Inszenierte Haltestellen
11 WETTBEWERBE
Chancengleichheit kontra Verfahrenseffizienz? | Form Fort- und Weiterbildung
15 VERANSTALTUNGEN
16 WAS HINTER FABI STECKT
16 SCHRITT FÜR SCHRITT
Daniela Dietsche
Welche Projekte beinhaltet FABI, und welche Bahnprogramme gab es bisher?
21 «DIE PROJEKTE NACH 2025 SIND NICHT IN STEIN GEMEISSELT»
Daniela Dietsche
Das Bundesamt für Verkehr analysiert periodisch Bedarf und Angebot – und reagiert.
23 EIN FONDS FÜR ALLES
Daniela Dietsche
Ausbau, Erhalt und Betrieb sollen künftig aus einem Topf bezahlt werden.
25 «VERNETZEN UND VERNETZT BLEIBEN»
Daniela Dietsche
FABI steht den Zielen der Raumplanung nicht im Weg, sagt Bernd Scholl, Professor für Raumentwicklung.
AUSKLANG
27 STELLENINSERATE
37 IMPRESSUM
38 UNVORHERGESEHENES
Schritt für Schritt
Die Nachfrage im Pendler-, Reise- und Güterverkehr steigt seit Jahren. Mit FABI möchte die Bahn Angebot und Infrastruktur anpassen. Am 9. Februar wird über die Botschaft abgestimmt. Das Bahnprogramm folgt auf Bahn 2000, NEAT, HGV und ZEB. Ein Überblick.
Das Eisenbahnnetz in der Schweiz hat viele Aufgaben zu erfüllen: Personenpendelverkehr in die Städte, Pendelverkehr zwischen den Städten, Personen-F ernverkehr und Güterverkehr. Ein Schwerpunkt der Schweizer Verkehrspolitik ist zudem die Verlagerung der Güter im alpenquerenden Transit von der Strasse auf die Schiene. 2012 haben rund 1.2 Millionen Lkw die S chweizer Alpen überquert.[1] Eine Reduktion dieser Lastwagenfahrten auf das gesetzlich vorgesehene Verlagerungsziel – 650 000 Fahrten im Jahr 2018 – ist gemäss Verlagerungsbericht weiterhin nicht zu erreichen.[2]
Wohnbevölkerung, Arbeitsplatzangebot und individuelle Mobilitätsbedürfnisse nehmen in der Schweiz stetig zu; die Nachfrage im Pendlerverkehr steigt. Die Bahn versucht mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Das Netz, das zu weiten Teilen aus dem 19. Jahrhundert stammt, ist ausgelastet. Für jeden Angebotsausbau muss es punktuell erweitert werden. Die L ösungsansätze der letzten Jahre waren verschiedene Bahnausbauprogramme (vgl. Abb. S. 18). Das jüngste heisst «Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur» (FA BI) und regelt eben nicht nur den Ausbau, sondern auch die künftige Finanzierung. Am 9. Februar stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Vorlage FA BI ab. So weit, so gut, doch was verbirgt sich dahinter? Im Groben geht es darum, Engpässe im Schienennetz zu beseitigen und zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Schon heute ist das Eisenbahnnetz der Schweiz eines der am dichtesten befahrenen der Welt. Heutige Prognosen besagen, dass der Personen- und Güterverkehr bis 2030 gesamtschweizerisch um weitere 60 % ansteigen wird. Ausbauten der Infrastruktur seien deshalb unabdingbar, sagte Philippe Gauderon, Leiter Infrastruktur SBB, beim Trinationalen Bahnkongress in Basel im Mai 2013.
Einzelne Elemente der beiden Grossprojekte Bahn 2000 und Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurden aus finanziellen Gründen verschoben und die Mittel dem nachfolgenden Grossprojekt ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur) zugesprochen.
Die Finanzierung der Projekte ab 2016 kann jedoch nicht mehr aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte (FinöV-F onds) erfolgen, da er befristet ist und die daraus finanzierten Projekte nicht beliebig erweitert werden können (vgl. S. 23). Der FinöVFonds soll in den neu geschaffenen Bahninfrastrukturfonds (BIF ) überführt werden. Mit ihm sollen Betrieb, Unterhalt und Ausbau finanziert werden. Gemeinsam mit STE P, also dem Ausbauteil, ergibt sich die Botschaft FABI.
FABI = STEP + BIF
Als Grundlage für den Ausbauteil von FA BI hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) eine langfristige Perspektive erarbeitet, basierend auf den Fragen: Was erwarten die Kunden und Kundinnen in Zukunft vom öV-N etz? Welche Verbindungen sind notwendig, um diese Erwartungen zu erfüllen? Und welche Angebote müssen den Verbindungen hinterlegt werden? Zudem flossen die prognostizierte Verkehrsnachfrage und die Forderungen der Raumplanung nach der Siedlungsentwicklung nach innen in die Überlegungen ein. Die L angfristperspektive zeigt, wohin sich das Angebot im Schweizer Bahnverkehr entwickeln soll: Zunächst steht dabei die Kapazitätserhöhung im Vordergrund; kürzere Reisezeiten rangieren nicht an erster Stelle, sollen aber auch nicht verhindert werden. Der Betrachtungshorizont reicht bis mindestens 2050. Angebotsseitig legte das BAV fest, wo eine Taktverdichtung gebraucht wird, wo der S- Bahn-Verkehr gestärkt werden muss und wie die A nschlüsse ins Ausland aussehen sollen.
Erster Ausbauschritt: STEP 202
5Um die Ideen aus der Langfristperspektive zu realisieren, werden Projekte in STE P in zwei Dringlichkeitsstufen eingeteilt. Alle vier bis acht Jahre wird das bestehende Angebot mit den Prognosen für die Zukunft abgeglichen. Ausbauvorschläge werden von der Verwaltung ausgearbeitet und an den Bundesrat weitergereicht. Dieser legt sie dem Parlament zur Prüfung und Freigabe vor. Der erste Schritt enthält Projekte, die bis 2025 umgesetzt werden sollen: Bahnhofsumbauten, da zum Beispiel längere Perrons benötigt werden, um längeren Zugkompositionen Platz zu bieten und die Pendlerströme zu entflechten; neue Überholgleise, Doppelspurausbauten, Entflechtungsbauwerke oder Kreuzungsstellen, die sowohl dem Personen- als auch dem Güterverkehr zugutekommen (Karte S. 19).
Die technische Umsetzung dürfte unproblematisch sein; die erforderlichen Arbeiten unter Betrieb auszuführen ist jedoch anspruchsvoll. Auch Massnahmen zu den Taktverdichtungen gehören zu den Projekten, die dem Bahnprogramm STE P zugeordnet werden. In städtischen Gebieten – etwa zwischen Basel und Liestal – ist der Viertelstundentakt geplant, auf anderen Strecken wie Zürich–Chur, Bern–Luzern oder Biel–Neuenburg der Halbstundentakt. Das Versprechen an die Passagiere: mehr Züge, mehr Platz, höhere Pünktlichkeit und mehr Sicherheit.
Bahn 2000 machte den Anfang
Die Botschaft «Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur » fügt sich in eine lange Reihe von Bundesbeschlüssen zum Bahnbau ein. Einige Programme werden parallel ausgeführt, was es nicht einfacher macht, den Überblick zu behalten. Am 6. 12. 1987 haben die Stimmbürger die Vorlage zu «Bahn 2000» angenommen. Die heute weitgehend abgeschlossenen Vorhaben hatten das Ziel, schnellere und direktere Zugverbindungen in der ganzen Schweiz anbieten zu können. Idee des Projekts war es, einen vorteilhaften Fahrplan zu bestimmen und dann die dazu nötigen Infrastrukturausbauten anzugehen. Der Integrale Taktfahrplan zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Züge aus allen Richtungen zur vollen und/oder halben Stunde an den wichtigsten Bahnhöfen treffen, wodurch ein Umsteigen fast ohne Wartezeiten möglich wird. Möglich ist das aber nur, wenn die Fahrt zwischen den Knoten knapp unter 30 oder 60 Minuten dauert. Wo das nicht der Fall war, wurden neue Strecken erstellt oder alte ausgebaut. Das bekannteste Projekt der ersten Etappe war die Neubaustrecke Mattstetten–Rothrist, die 2004 eröffnet wurde. Die Idee zur zweiten Etappe «Bahn 2000» scheiterte jedoch.
Lötschberg, Gotthard und Ceneri
Am 27. 9. 1992 stimmte das Schweizer Stimmvolk dem Bundesbeschluss über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-A lpentransversale (NEAT ) zu. Das Grossprojekt soll den Eisenbahntransitverkehr in Nord-S üd- Richtung verbessern, hauptsächlich um den alpenquerenden Schwerverkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. Diese Arbeiten laufen bekanntermassen noch. Die Fertigstellung des Gotthard-Basistunnels ist auf 2016 terminiert, die des Ceneri-Basistunnels – klammert man eine mögliche Zeitverzögerung durch den derzeitigen Rekurs aus – auf 2019.
Der Lötschberg-Basistunnel ist seit 2007 in Betrieb, wobei die Fertigstellung der zweiten Röhre aus finanziellen Gründen zurückgestellt wurde. Die fehlende Finanzierung war auch der Grund, warum der Hirzeltunnel zur Anbindung der Ostschweiz fallen gelassen und der Zimmerbergtunnel zwischen Thalwil und Zug zurückgestellt wurden.
Den Lärm in den Griff bekommen
Weit fortgeschritten ist das Grossprojekt Lärmsanierung der Eisenbahnen. Es richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 24. März 2000 (BGLE ). Ziel ist es, bis Ende 2015 netzweit mindestens zwei Drittel der Bevölkerung, die schädlichem oder lästigem Eisenbahnlärm ausgesetzt ist, zu schützen. Dies in erster Priorität durch die S anierung des Rollmaterials und in zweiter Priorität durch bauliche Massnahmen wie den Bau von Lärmschutzwänden oder die Sanierung einzelner Stahlbrücken. Ende September 2013 hat das Parlament den nächsten Schritt beschlossen: Mit weiteren Massnahmen soll der Bahnlärm weiter reduziert werden.
Kernelement ist dabei, dass ab 2020 Lärmgrenzwerte für alle Güterwaggons gelten.
Anschluss ans europäische Netz
Das Bundesgesetz über den Anschluss der Ost- und Westschweiz an das europäische Eisenbahn-H ochleistungsnetz (HGV) vom 18. März 2005 soll dazu beitragen, einen möglichst grossen Anteil des internationalen Strassen- und Luftverkehrs auf die Schiene zu verlagern. Rund 30 Projekte in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich werden derzeit realisiert oder sind bereits abgeschlossen.
Den Bestand maximal ausnutzen
Das BAV überführte die in der zweiten Etappe «Bahn 2000» vorgesehenen Projekte in das Programm «Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur» (ZEB). Bund und SBB unterzeichneten die erste Umsetzungsvereinbarung für ZEB am 29. 6. 2011. Mit dem ZEB-Gesetzentwurf bezweckt man, die Kapazitäten für den Personenfern- und den Güterverkehr auszubauen und die Zahl der Vollknoten zu erhöhen. Dazu zählen auch Projekte im Zusammenhang mit dem Ausbau der NEAT- Zufahrten und der Durchmesserlinie Zürich.
Die SBB werden zum Beispiel die Zugfolgezeiten auf verschiedenen Abschnitten der Achse Basel–Chiasso verkürzen, um dadurch die Kapazität im Hinblick auf die Eröffnung des Gotthard- und Ceneri-Basistunnels zu erhöhen. Die Teilprojekte des Grossprojekts ZEB sind in Umsetzung oder in Planung.
Mehr Platz für den Güterverkehr
Beim «4-Meter-K orridor» handelt es sich um eine Güterverkehrsvorlage. Ein Ja zu FA BI ist Voraussetzung für dessen Realisierung. Die SBB sollen im Auftrag des Bundes die Gotthard-A chse ausbauen, damit ab 2020 auch Sattelauflieger, Wechselbehälter und Container mit einer Eckhöhe von vier Metern transportiert werden können. Für den durchgängigen 4-Meter-K orridor von Basel ins Tessin müssen rund 20 Tunnels ausgebaut und diverse Anpassungen an Fahrstrom- und Signalanlagen, Überführungen und Perrons vorgenommen werden. Das grösste Projekt ist der Bözbergtunnel im Kanton Aargau. Als beste Variante erwies sich hier der Neubau eines Doppelspurtunnels. Von dem höheren Lichtraumprofil kann – durch die Nutzung von Doppelstockwagen – auch der Personenverkehr profitieren. Die Vorlage wurde vom Parlament bereits in beiden Räten diskutiert, und die Differenzbereinigung steht kurz vor Abschluss. Die Nachfrage wächst weiter Mit einem Anteil von 17 % der Personenverkehrsleistung und 39 % der Güterverkehrsleistung am gesamten Verkehr belegen die Schweizer Bahnen einen internationalen Spitzenwert bezüglich Modal Split. Das erwartete Bevölkerungswachstum hat eine höhere Nachfrage nach Infrastrukturdienstleistungen zur Folge. Gemäss dem mittleren Referenzszenario des Bundesamtes für Statistik wächst die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis 2060 auf 8 992 000 Personen. Geht man davon aus, dass die Schweiz ein attraktives Einwanderungsland bleibt, ist nicht auszuschliessen, dass die tatsächliche demografische Entwicklung dem oberen Szenario entspricht – gemäss Bundesamt für Statistik 11.3 Mio. Einwohner. Das Bevölkerungswachstum wird sich vermutlich auf die Ballungsräume konzentrieren.
Daher wird die Nachfrage nach Infrastrukturdienstleistungen vor allem zwischen den Agglomerationen steigen. Zu bedenken ist zudem, dass neue Infrastrukturen wirtschaftliches Wachstum begünstigen; dies führt zu höherer Nachfrage, die ihrerseits zusätzliche Infrastrukturkapazitäten erforderlich macht. Es drängen sich Fragen auf: Wie beeinflussen sich Bahninfrastrukturausbau und Strassenausbau künftig?
Geht der Ausbau immer weiter? Müsste der Verkehr irgendwann gesamthaft plafoniert werden, um das Mobilitätsverhalten zu steuern? Fragen, die an dieser Stelle offen bleiben.
Anmerkungen:
[01] Mit den bisherigen Massnahmen werden pro Jahr 650 000 bis 700 000 Fahrten vermieden: namentlich der NEAT , der Erhebung der LS VA, der Beibehaltung des Nachtfahrverbots für Lkw und einer gezielten Unterstützung des Schienengüterverkehrs bis zur Eröffnung der NEAT.
[02] Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Verlagerungsbericht Juli 2011–Juni 2013 vom November 2013.TEC21, Fr., 2014.01.31
31. Januar 2014 Daniela Dietsche