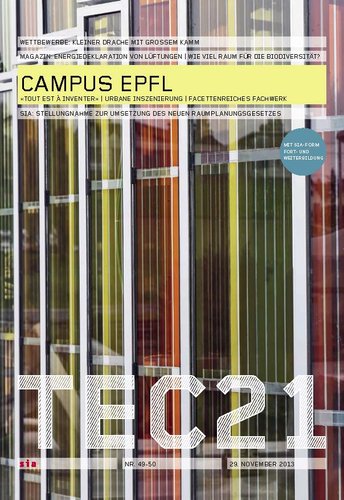Editorial
Die berühmte grüne Wiese ist Fluch und Segen zugleich. Ihr Potenzial ist ein Neubeginn ohne Einschränkung, ihr Defizit die fehlende Umgebung, an der man sich orientieren könnte. Diese Situation trafen die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) und die Universität von Lausanne in den 1970er-Jahren an, als sie auf das grosse Gelände nach Dorigny zogen. Sie verliessen die Stadt, weil die Gebäude im Zentrum eng geworden waren und das Wachstum hemmten. Zudem waren die Studentenunruhen von 1968 noch in frischer Erinnerung – als willkommener Nebeneffekt konnten die aufmüpfigen Studierenden aus dem Zentrum verbannt werden.
Vor den Toren von Lausanne fanden die beiden Institutionen genügend Platz, um sich weiterzuentwickeln. Die Uni Lausanne bettete sich in die Landschaft ein, die EPFL schuf mit ihrem Campus eine kleine Stadt – allerdings ohne städtisches Programm. Als Resultat einer modernistischen Planung blieb der Campus der EPFL lange Zeit monofunktional. Auf dem Gelände wurde ausschliesslich studiert, nach dem Ende der Vorlesungen blieb das Areal verwaist: Wohnen und Einkaufen war in dieser Stadt der Studierenden nicht vorgesehen. Die planerische Basis bildet ein strenger Raster, an dem sich die Hochschule immer wieder rieb. Denn im Zug seiner Entwicklung nahm der Campus den Zeitgeist auf: Das Gelände der EPFL erscheint heute als Flickenteppich aus Artefakten verschiedener Architekturepochen («Raster und Punkt»). Nachdem sich über 45 Jahre lang jede Etappe von der vorigen distanzierte, scheint nun der Moment gekommen, eine Synthese zu wagen. Drei Projekte von Dominique Perrault vermitteln zwischen den verschiedenen Epochen («Tout est à inventer»).
Die strenge funktionale Trennung wurde bereits aufgeweicht. Den Anfang machte 2010 das Rolex Learning Center von Sanaa. In seinem einzigartigen Innenraum tummeln sich nicht nur Studierende – die Bewohnerinnen und Bewohner aus den umliegenden Wohnquartieren haben ihn für sich entdeckt. Und auch das Swiss Tech Convention Center («Urbane Inszenierung» und «Facettenreiches Tragwerk»), das im April 2014 eingeweiht wird, bietet etwas für seine Nachbarn: Zum Projekt gehört ein Wohnheim, das die Umgebung belebt; die Geschäfte am angrenzenden Platz sind bereits eröffnet und werden von den Quartierbewohnern und den Studierenden rege besucht. Der Campus der EPFL beginnt sich allmählich als Stadt zu gebärden.
Marko Sauer
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Kleiner Drache mit grossem Kamm
08 MAGAZIN
Energiedeklaration von Lüftungen | Wie viel Raum für die Biodiversität?
14 PUNKT UND RASTER
Marko Sauer
Der Campus der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne wurde in drei Etappen erstellt. Architektonisch hat jede ihre Spuren hinterlassen.
17 TOUT EST À INVENTER
Marko Sauer
Eine Hochschule prägt mit ihren Gebäuden die Wahrnehmung – regional und global. Wie geht die EPFL mit dieser Herausforderung um?
20 URBANE INSZENIERUNG
Christophe Catsaros
Das neue Swiss Tech Convention Center bereichert den Campus. Es bringt ein Stück Stadt in die Agglomeration.
23 FACETTENREICHES TRAGWERK
Jacques Perret et al.
Unter dem Riesendach des Kongresszentrums sammeln sich einige Erfindungen. Die Ingenieure berichten.
29 SIA
SIA-Form Fort- und Weiterbildung | Vakanzen | Rekursfrist Publikationsfreigaben | Stellungnahme zur Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Raster und Punkt
Vor fünfzig Jahren weideten noch Schafe und Kühe auf den Wiesen zwischen Lausanne und Ecublens, auf denen sich heute der Campus der Université de Lausanne (Unil) und der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) erstreckt. Beide Schulen – in den Anfängen separat, dann ab 1869 gemeinsam – waren einst in Altbauten im Stadtzentrum eingepfercht. Hundert Jahre später erfolgte nicht nur die neuerliche Trennung, sondern auch der Auszug aus der Innenstadt. Was anfangs auf die grüne Wiese verbannt zu sein schien, gewinnt inzwischen mehr und mehr Urbanität.
1969 fielen drei Entscheidungen: Die Ecole Polytechnique de l’Université de Lausanne (EPUL) wurde in eine der ETH Zürich angeschlossene eidgenössische Institution mit der Bezeichnung Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) umgewandelt, von der Universität (Unil) losgelöst und gemeinsam mit dieser in die Agglomeration verlegt.[1]
Die bauliche Entwicklung teilt sich in drei Phasen auf.[2]
Die erste Etappe folgte einem Raster, der gleichzeitig eine klare Gliederung und innerhalb dieser eine dynamische Flexibilität gewährleisten sollte. Die zweite brach mit diesem Raster und suchte ihn mittels Diagonalen aufzuweichen. Die dritte, heutige Strategie oszilliert zwischen passgenauen Solitären und einer Reparatur des ursprünglichen Masterplans. Damit widerspiegeln diese Phasen nicht nur wechselnde Tendenzen in der Planung. Sie dokumentieren auch Veränderungen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Hochschule. Das Resultat ist ein Patchwork aus unterschiedlichen Architekturstilen, die deutlich die Sprache ihrer jeweiligen Zeit sprechen.
Phase 1: auf der grünen Wiese (rot)
1970 wurde der Wettbewerb für den Masterplan für die EPFL ausgelobt, 1978 fanden auf dem neuen Gelände die ersten Vorlesungen statt. Der Masterplan war das Resultat eines vom Bund organisierten Wettbewerbs. Ihm ging eine bewegte Diskussion voraus, denn es lag bereits ein Überbauungsplan vor, der 1968 von einem Team um Professor Pierre Foretay entworfen worden war. Nachdem die nunmehr eidgenössische Hochschule in die Zuständigkeit des Bundes fiel, beharrten dessen Behörden jedoch auf einem Wettbewerb, der unter sieben eingeladenen Teams ausgelobt und vom Zürcher Architekturbüro Jakob Zweifel (1921–2010) und Heinrich Strickler (1922–2010) gewonnen wurde.[3] Die beiden skizzierten einen strukturalistischen Plan, der auf der strikten Trennung der Verkehrswege basierte – die Autos fahren auf Terrainniveau, die Fussgänger bewegen sich auf Passerellen, die die Gebäude miteinander verbinden. Das Credo lautete: Flexibilität, Vielfalt der Nutzung, Variabilität, Wachstum, Einführung neuer Bautechniken, Realisierung neuer architektonischer Ausdrucksweisen.
Dazu legten sie ein weitmaschiges Netz aus quadratischen Feldern von 87.60 m über den gesamten Perimeter, in das sich ebenso clusterartige Strukturen wie Hochhäuser einschreiben lassen sollten. Die Bauten der ersten Etappe, die das Zürcher Büro realisieren konnte, waren wiederum nach einem Raster von 7.20 m in Nord-Süd- und in West-Ost-Richtung gegliedert – mit Ausnahme der Versuchshallen, wo er auf 14.40 bis 21.60 m gedehnt wurde.[4] Die Bauarbeiten begannen 1974, die ersten Gebäude wurden 1977 bezogen, und im Herbst 1978 startete der Lehrbetrieb. Zwei markante Achsen prägen die erste Etappe von 1974 bis 1983: Von Norden nach Süden orientiert, trennt die heutige Avenue Piccard die beiden Gebäudecluster, die mit einer Art Rückgrat die Ausrichtung von West nach Ost definieren. Wie Finger docken die Fakultäten, Institute und Labors an diesen Riegel an. Dort, wo die beiden Hauptachsen aufeinandertreffen, überbrückt das Gebäude die Strasse auf einer Höhe von acht Metern.
Phase 2: Erweiterung der Regel (gelb)
Eine Änderung dieses Plans läutete die zweite Phase ein: Der Zugang zum Gelände wurde nach Westen verlegt – daher zeigt die Avenue Piccard heute ins Nichts – und die Esplanade als neues Zentrum der Anlage gestaltet. Aus politischen Gründen wurden für die Entwicklung der nächsten Etappe nicht mehr Jakob Zweifel und Heinrich Stickler hinzugezogen, sondern es wurde ein Ideenwettbewerb unter Westschweizer Büros veranstaltet.
Elf Arbeitsgemeinschaften wurden mittels Präqualifikation für das Verfahren ausgewählt. Bernard Vouga in Zusammenarbeit mit Jean-Pierre Cahen und Michel-Robert Weber hiessen die Gewinner des Wettbewerbs. Sie schlugen zwei diagonale Achsen vor, die von der Place de l’Esplanade ausgehend die beiden Ecken im Südwesten und Nordwesten erschliessen. Realisiert wurde indes lediglich die Achse gegen Südwesten und die daran anschliessenden Gebäude, der Bauplatz im Norden blieb vorläufig unbebaut.
Phase 3: Passstücke und Lückenfüller (blau)
Der dritten Etappe liegt ebenfalls eine Veränderung der Rahmenbedingungen zugrunde. Die Linienführung der Tramway du sud-ouest lausannois, der heutigen M1, wurde 1986 festgelegt und der Bahnhof im Nordwesten des Campus angeordnet. Damit veränderte sich erneut der Zugang zum Gelände. In einer ersten Etappe war vorgesehen, die Haltestelle durch einen Neubau mit der Esplanade zu verbinden. Ein zweistufiger Wettbewerb wurde 1992 ausgelobt mit dem Ziel, die Tugenden des ursprünglichen Masterplans wieder aufzunehmen: Das neue Projekt sollte wieder klare und einheitliche Strukturen schaffen.
Dolf Schnebeli, Flora Ruchat, Tobias Ammann und Sacha Menz gewannen den Wettbewerb und errichteten von 1996 bis 2002 einen Gebäudekomplex, der einen Eingang zum Gelände formt und in klaren Linien einen Platz fasst. Er orientiert sich an den Strukturen des Masterplans, agiert aber mit städtischen Elementen. Die weiteren Bauten dieser dritten Phase waren punktuelle Erweiterungen, die keine Anpassung des Masterplans nach sich zogen: das Bâtiment des communications (2000–2004) von Rodolphe Luscher, die Erweiterung der Fakultät Sciences de la Vie von Patrick Devanthéry und Inès Lamunière (2005–2008) und schliesslich das Rolex Learning Center nach Plänen von Sanaa, das 2010 eingeweiht wurde. Gegenwärtig befindet sich auf der Rückseite des Bahnhofs das Kongresszentrum mit Wohnungen für Studierende von Richter · Dahl Rocha im Bau (vgl. «Urbane Inszenierung», S. 20 und «Facettenreiches Fachwerk», S. 23).
Dieselben Architekten entwarfen auch den Wissenschaftspark im Süden des Geländes.
Spagat in Raum und Zeit
Die jüngsten Projekte stammen von Dominique Perrault und Kengo Kuma in Zusammenarbeit mit Holzer Kobler Architekturen (vgl. «Tout est à inventer», S. 17). Perrault schlägt zur Stärkung des Campuscharakters drei unterschiedliche Projekte vor, die Teil einer einheitlichen Strategie sind: Die ehemalige Bibliothek ist bereits zum neuen Verwaltungszentrum umgebaut, das mechanische Labor wird erweitert und soll dereinst um seinen geräumigen Innenhof herum Platz für mehrere Fakultäten bieten.
Für seinen dritten Vorschlag werden gegenwärtig die finanziellen Mittel geäufnet: Das Projekt der «Teaching Bridge», mit dem er 2011 den Wettbewerb gewann, soll bis 2017 die alte Überdachung an der Avenue Piccard ersetzen. Das zerklüftete Gebäude übernimmt den ursprünglichen Raster der ersten Etappe von Zweifel und Strickler von 7.20 m, schreibt dessen clusterartige Struktur fort und dockt auf der West- und der Ostseite an deren Bauten an. Es schafft im wahrsten Sinn des Worts den Spagat zwischen den 1970er-Jahren und der Gegenwart. Einen vorläufigen Endpunkt bildet der Ausstellungspavillon von Kengo Kuma und Holzer Kobler Architekturen, der bis Herbst 2014 erstellt werden soll.
Anmerkungen:
[01] Treibende Kraft der Aufwertung zur eidgenös sischen Hochschule war Maurice Cosandey, der 1963 Direktor der Schule wurde, in: Francesco Della Casa, Eugène Meiltz: Rolex Learning Center, Lausanne, 2010, S. 50.
[02] www3.unil.ch/wpmu/dorigny40/ unite et diversite des batiments de lepfl/
[03] Vgl. «Sieben Projektaufträge für die ETH L in Dorigny», in: Werk, 57 (1970), H. 10, S. 646–661, und Claude Grosgurin: «Die baulichen Aspekte einer Neuanlage der ETH Lausanne in Ecublens (erste Etappe) und Ausbau der ETH Lausanne», in: SBZ, 91 (1973), H. 13, S. 323–324
[04] F. Matter, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Ecublens VD, in: IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke, 3 (1979), H. C 7, S. 5TEC21, Fr., 2013.11.29
29. November 2013 Marko Sauer
«Tout est à inventer»
«Es gilt, alles zu erfinden.»[1] So lautete der Tenor in dem Buch über das Rolex Learning Center, das zu dessen Einweihung 2010 erschien. Die bauliche Entwicklung der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) im Lauf der 45 Jahre ihres Bestehens zeugt von diesem Erfindergeist. Der strukturalistische, clusterartige Gründerbau von Zweifel und Strickler war ebenso ein Wurf wie die städtisches Flair einfangende, hofartige Bebauung von Dolf Schnebeli, Flora Ruchat, Tobias Ammann und Sacha Menz und die mit der Landschaft flirtende Welle von Sanaa. Die aktuelle Strategie, deren Protagonist Dominique Perrault ist, versöhnt den anonymen Raster mit namhafter Architektursprache.
Die EPFL hat in den letzten Jahren auf ihrem Campus ein architektonisches Feuerwerk gezündet. Die Vielfalt an einzigartigen Gebäuden ist eng mit einem Namen verbunden: Patrick Aebischer leitet seit der Jahrtausendwende als Rektor die Geschicke der EPFL. Für ihn spielt die Architektur eine wichtige Rolle. In der Begleitpublikation zur Ausstellung im Sommer 2013 an der EPFL über Dominique Perrault, der einige der Bauten der jüngsten Generation auf dem Campus realisiert, schreibt der Rektor: «Im 21. Jahrhundert werden die Universitätsanlagen zu Orten des Architekturschaffens werden. Sie sind experimentelle Baustellen für neue Funktionen, Orte, die man besichtigt, genauso wie man in der Vergangenheit gebaute Kathedralen besucht.»[2] Aebischer betrachtet die Gebäude «seiner» EPFL als Aushängeschilder für die Kompetenzen der Institution, als Pilgerstätten für Architekturinteressierte und als Brennpunkte des architektonischen Experiments. Und sie sollen die besten Forscher nach Lausanne locken. Das Konzept ist bekannt: Vitra und Novartis gehen ähnliche Wege, um sich von ihren Konkurrenten abzuheben.
Es erstaunt daher nicht, dass in der aktuellen Phase der Fokus auf Gebäuden liegt, die individuelle Lösungen anstreben und sich vom ursprünglichen Masterplan aus den 1970erJahren lösen. Was sind die Motive, die hinter dieser Entwicklung stehen? Es lässt sich nicht genau belegen, wann das Universitätsgelände zum «Campus» umgetauft wurde, aber die Bezeichnung passt hervorragend zur Strategie von Rektor Aebischer. Die Wochenzeitschrift «L’Hebdo» aus Lausanne kommentierte in ihrer Ausgabe von 28. 9. 2006 diese Entwicklung. Der Ausdruck «Campus» sei lang mit den amerikanischen Hochschulen verknüpft gewesen. Erst in der letzten Zeit sei der Begriff auch in der Schweiz gefallen: eine Folge der globalen Ausrichtung der Hochschulen, die sich nicht mehr nur auf dem heimischen Markt behaupten, sondern im globalen Wettbewerb der Bildungsstätten mit den ganz Grossen mithalten müssten.[3] Als mustergültiges Beispiel dieser Strategie kann das Learning Center des japanischen Büros Saana gelten (vgl. TEC21, 26/2010), das von 2007 bis 2009 errichtet und 2010 eingeweiht wurde. In ihm bündeln sich alle Aspekte wie in einem Brennglas.
Poesie und Pioniergeist
Das Learning Center hat das Potenzial, weltweite Strahlkraft zu entfalten. Dass Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa, die beiden Köpfe von Sanaa, im Jahr seiner Eröffnung den PritzkerPreis entgegennehmen konnten, hat diesen Effekt sicher befördert und das Ansehen der Institution gestärkt. Neben seiner räumlichen Poesie bietet das Learning Center zudem ein gerüttelt Mass an ingeniösem Pioniergeist. Dieser belegt die Leistungsfähig keit des Ingenieurwesens, der Bauindustrie und der Architektur. Es wurde enorm viel Auf wand betrieben, um dieses einzigartige Gebäude zu erstellen, an dem sich indes auch die Geister scheiden.[4]
Der Angreifbarkeit des Projekts war sich die Wettbewerbsjury sicher bewusst, als sie im November 2004 Sanaa den ersten Preis verlieh. Doch das Gebäude leistet weit mehr, als eine Bibliothek zu beherbergen und im internationalen Wettstreit als Markenzeichen für die EPFL zu dienen. Es verkörpert die zweite Vision, die Patrick Aebischer im oben genannten Text skizziert: «Der Universitätscampus des 21. Jahrhunderts soll ein Ort zum Leben, ein Ort des Austauschs, ein allen zugänglicher Ort sein. Früher bestanden Universitätsgelände hauptsächlich aus der Lehre und der Forschung gewidmeten Bauten. […] Die Universitä ten müssen sich neu erfinden, sie müssen Räume schaffen, die den Austausch und soziale Aktivitäten fördern, und dürfen dabei ihre Hauptaufgaben – Lehre und Forschung sowie Innovation und Technologietransfer – nicht vernachlässigen.»2 Der Rektor ist nicht bloss auf der Jagd nach Preziosen, er möchte die Funktionalität des Campus und das Wesen der neuen Universitäten revolutionieren.
Sich diesen generösen Raum im Learning Center zu leisten war also wesentlicher Teil des Programms. Die alten Vorlesungssäle schrumpfen im Learning Center auf einen Bildschirm, der Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden auf ein Glasfaserkabel. Deshalb sind die neuen Räume von Universitäten keine Hörsäle mehr, sondern Orte der ungezwungenen Begegnung, an denen die kostbarste Ressource der Schweiz gefördert wird: die Idee. Unter diesem Blickwinkel erfüllt das Center ein Bedürfnis, das vital ist für den Campus.
Neue Bezugspunkte
Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa kümmerten sich offensichtlich nicht um den ursprünglichen Masterplan von 1970. Das Learning Center liegt auf der Wiese im südlichen Teil des Geländes wie ein auf dem See treibendes Blatt Papier. Die Wege rund um das Gebäude wollen nirgends richtig am Bestand anschliessen. Weder Höhe, Materialisierung noch Ausdruck nehmen irgendeinen Bezug auf die umliegende Gebäude. Um es mit Rem Koolhaas zu sagen: «Fuck context.»[5] Im Fall von Sanaa geschieht dies höflich und beflissen, doch das Learning Center bleibt ein Solist. Vielleicht ist der Kontext der neuen Bibliothek einfach auf einer anderen Ebene zu suchen. Sie misst sich an anderen emblematischen Gebäuden von global agierenden Hochschulen oder solchen mit ähnlicher Nutzung, etwa an der Mediathek im japanischen Sendai (1998–2000) von Toyo Ito.[6] Doch der Bezug des Hauses ist in diesem Fall auch ein direkter: Es zitiert die Landschaft, die den Campus umgibt, den See und die Berge. Damit weist es über das Universitätsgelände hinaus, sprengt dessen Grenzen und hebt sich selbst über die Agglomeration und die Stadt hinweg.
Gebäude wie das Learning Center haben Auswirkungen auf den Masterplan: Sanaa löst sich komplett von dessen Regeln und stellt das Gebäude mit seinen spezifischen Bedingungen in den Vordergrund. Demgegenüber leitet Dominique Perrault eine Kehrtwende ein oder wagt einen Blick zurück – aber nicht im Zorn, sondern mit Sensibilität für die Qualitäten des ursprünglichen Bebauungskonzepts von Zweifel und Stickler. In dessen Rigidität entdeckt Perrault die robuste Logik und Nutzbarkeit, die Flexibilität, die der 7.20-m-Raster für die unterschiedlichsten Nutzungen bietet. Nach der in der zweiten Etappe initiierten Aufweichung des Masterplans und dessen völliger Negierung durch Sanaa schafft Perrault bis 2017 mit der «Learning Bridge» eine Synthese der beiden Welten. Sie verbindet die Logik der 1970erJahre mit den Bedürfnissen der Gegenwart. Perrault beweist, dass auch innerhalb dieser Grenzen ein innovatives und poetisches Projekt seinen Platz finden kann. Behutsam erweitert er die Möglichkeiten des dreidimensionalen Rasters und verbindet die auf zwei verschiedenen Niveaus angelegten Verkehrswege miteinander. Auch für die Fragmentierung durch die zweimalige Verschiebung des Haupteingangs zum Campus schafft Perrault Remedur: Er kreiert einen neuen Zusammenhang, anstatt einen weiteren Stein zum vielgestaltigen Mosaik hinzuzufügen.
Anmerkungen:
[01] Francesco Della Casa, Eugène Meiltz: Rolex Learning Center, Lausanne 2010, S. 111.
[02] «Vers le Campus du 21 e siècle» in: Anna Hohler (Hrsg.): Dominique Perrault Architecture, Territoire et horizons, Lausanne 2013, S. 15, deutscher Text in der Beilage zum Buch.
[03] Mireille Descombes: La Suisse invente ses cam pus, Artikel online seit dem 28.09.2006 www.hebdo.ch/la_suisse_invente_ses_cam pus_23903_.html
[04] In der Deutschschweiz nahm die Kritik teilweise geharnischte Züge an: Der Landverbrauch sei enorm, der Nutzen fraglich. Erst die aquariums ähnlichen Büroeinbauten ermöglichten, dass in dem Gebäude überhaupt gearbeitet werden könne. Geländer, Treppen und regelrechte Bergbahnen konterkarierten die Idee einer sanft ondulierenden Landschaft.
[05] «Bigness or the problem of Large» in: Rem Koolhaas: S, M, L, XL, The Monacelli Press, New York 1995, S. 495. Koolhaas postuliert in seinem Aufsatz, dass Gebäude ab einer gewissen Grösse, man mag auch ihre Bedeutung dazu zählen, ihren eigenen Kontext schaffen. Ihr «Impact» ist genü gend gross, um sich nicht darum kümmern zu müssen, was sie umgibt.
[06] Auch die Mediathek in Sendai ist ein ingenieurs technisches Meisterwerk, an dem der Ingenieur Mutsuru Sasaki beteiligt war. Das achtgeschossi ge Gebäude besteht aus prägnanten Fachwerken in Form von durchgehenden Röhren.TEC21, Fr., 2013.11.29
29. November 2013 Marko Sauer