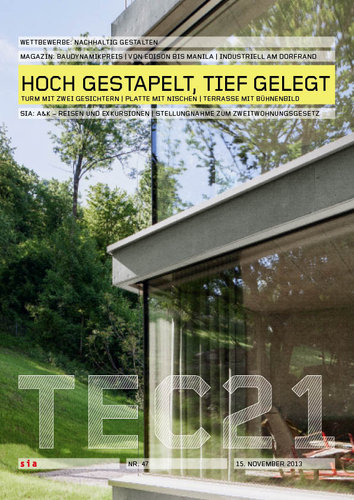Editorial
Einfamilienhäuser zu bauen erscheint im Umfeld der Verdichtungsdebatte nachgerade politisch unkorrekt – und deren architektonische Qualitäten publizistisch zu beleuchten erst recht. Wir gehen das Risiko in dieser Ausgabe ein. Genügt doch ein Blick auf die Hänge etwa über dem Zürich- oder dem Vierwaldstättersee, um sich davon zu überzeugen, dass das EFH höchstens auf dem Papier ein Auslaufmodell ist. Die Architektur der meisten dieser mit Vorliebe als Terrassen ausgebildeten Häuser ist allerdings von bedenklicher Banalität und Einförmigkeit: ein Copy-and-paste von viel Glas, weissem Anstrich und Schubladenbalkonen.
Da und dort zeitigt der Druck auf knapp werdendes Bauland, der auch an Standorten wächst, deren exklusive Lagen für Villenarchitektur prädestiniert sind, indes auch originelle Lösungen. Architekten ersinnen Modelle von verdichtendem Charakter, die mit dem Bauland haushälterisch umgehen bzw. in denen viel Volumen auf möglichst geringer Fläche untergebracht ist.
Dazu gehören die Architekten der hier präsentierten Villen. Sie haben versucht, an attraktiver Lage zu bauen, ohne diese zu verschandeln, auf bescheidener Fläche viel Raum zu generieren, eine verdichtete Form von EFH mit dem Wunsch nach Privatheit, Aussicht und Wohnen in der Landschaft zu verbinden – in einer Weise, die auch architektonisch etwas zu bieten hat.
Es mutet an wie Hexerei, der Zone W2 vier Geschosse abzutrotzen, aus einer Restfläche durch Abparzellierung zweier bestehender vier neue Grundstücke zu generieren oder bei einem Gefälle von 45 % drei Häuser zu bauen, um eins zu behalten. Da war die Versuchung gross, die Beiträge mit Adaptionen des Hexeneinmaleins aus Goethes «Faust I» zu betiteln: das Turmhaus von Michael Meier und Marius Hug mit «Aus zwei mach vier», die fast den Hang hinunter fliessenden Platten von Lischer Partner Architekten mit «Aus zwei mach sechs, behalte vier» und Daniele Marques’ Terrassen mit «Nimm drei, zwei lass gehn, eins lass stehn».
Rahel Hartmann Schweizer
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Nachhaltig gestalten
12 MAGAZIN
Industriell am Dorfrand | Von Edison bis Manila | Ausgezeichneter Ingenieurnachwuchs
17 PERSÖNLICH
Baudynamikpreis an Ehrfried Kölz
22 TURM MIT ZWEI GESICHTERN
Jutta Glanzmann Gut
Um eine Villa in Zürich zonenkonform (W2) und dennoch viergeschossig zu bauen, entwarfen Michael Meier und Marius Hug Architekten ein Haus, das sich von vorn als Turm präsentiert und von hinten einen breiten Rücken zeigt.
27 PLATTE MIT NISCHEN
Katja Hasche
Wie lässt sich eine Restfläche an attraktivster Hanglage mit vier Stadtvillen bebauen und dabei ein Höhenlimit von gerade einmal 3.60 m für die Baukörper einhalten? Architekt Daniel Lischer grub die Häuser so in den Hügel, dass sie nur mit einem Geschoss ins Terrain ragen.
32 TERRASSE MIT BÜHNENBILD
Katja Hasche
Ein Gefälle von 45 % machte das Baugrundstück in Luzern mit Blick auf See und Berge zu einer echten Herausforderung für den Architekten: Daniele Marques meisterte sie, indem er einen Grossteil des Volumens unterirdisch anlegte.
38 SIA
A&K – Reisen und Exkursionen | Tagung: Neue SIA-Norm Dachbegrünung | Stellungnahme zum Zweitwohnungsgesetz
43 PRODUKTE
Kaldewei | Velux | Lenzlinger
53 IMPRESSUM
54 VERANSTALTUNGEN
Turm mit zwei Gesichtern
Sowohl im Auf- als auch im Grundriss schert die Villa in Albisrieden am Fuss des Uetlibergs aus dem strengen Bebauungsmuster des Einfamilienhausquartiers aus. Ihre Form leitet sich aus Anforderungen ab, die einander fast ausschliessen: In der Zone W2 gelegen, sollte sie vier Geschosse aufweisen. Michael Meier und Marius Hug Architekten haben das Problem mit einer Volumetrie gelöst, die sich von vorn als Turm präsentiert und von hinten einen breiten Rücken zeigt. Damit haben sie die Hanglage in dem Aussenquartier der Stadt Zürich explizit thematisiert.
Oberhalb des Einfamilienhausquartiers, das sich entlang des Lyrenwegs parallel zum Hang entwickelt, steht seit Anfang dieses Jahres ein bemerkenswerter Neubau. Entworfen haben ihn die Zürcher Architekten Michael Meier und Marius Hug. Das Zweifamilienhaus steht auf einem Grundstück in der zweiten Reihe der regelmässig angeordneten Parzellen, das sich schmal und steil den Hang hinaufzieht und an seinem oberen Rand in Wald übergeht. Damit befindet sich das Gebäude an der Grenze zwischen Stadt und Land. Diese Tatsache haben die Architekten genutzt und zum Thema des Hauses gemacht. Durch die steile Lage am Hang tritt das Gebäude auf allen Seiten unterschiedlich in Erscheinung. Von der Stadt, d. h. von Norden, wirkt das Haus hoch und schmal wie ein Turm. Auf der Rückseite, von Süden, nimmt man es als zweigeschossiges Gebäude mit Attika wahr, das sich in die Breite entwickelt. Eine Herausforderung war es, das Volumen gesetzeskonform auf dem Restgrundstück zu platzieren. Was heute selbstverständlich aussieht, war ein schwieriges Unterfangen: Die Gebäudehöhe von insgesamt 8.50 m stand aufgrund der Zone W2 fest. Gleichzeitig durften maximal 50 % des untersten Geschosses über Terrain liegen,. Das Haus sollte zudem über vier Stockwerke verfügen, damit sich das Konzept von zwei Familienwohnungen realisieren liess. Diese sind paarweise über je zwei Geschosse organisiert. Bewerkstelligt haben das die Architekten, indem sie zunächst die vier äussersten Punkte der Fassadenabwicklung in der Höhe festlegten und den Baukörper danach entlang der Höhenkurven quasi ins Gelände einpassten.
Roh und geschliffen
Der annähernd symmetrische Zuschnitt der Grundrisse und die Fenster, die übers Eck laufen, sind laut Michael Meier eine Reminiszenz an die Wohnhäuser des Lyrenquartiers aus den 1930er-Jahren – diese sind ebenfalls symmetrisch organisiert und mit Eckfenstern ausgestattet. An der Längsseite verengt sich die achteckige Grundfigur jeweils, während die kürzeren Seiten sich mittig nach aussen stellen. Dadurch entstehen erkerartige Ausschnitte, die geschossweise mit leicht zurückversetzten Gläsern ausgefacht sind. Die ohnehin eindrückliche Weitsicht von den talseitig gelegenen Räumen über die Stadt im Osten und das Siedlungsgebiet des Limmattals im Norden wird dadurch noch spektakulärer. Indem die übrigen Aussenflächen des Baukörpers vollständig geschlossen gestaltet und sowohl Aussentreppen als auch auskragende Vordächer durchwegs in Beton gegossen sind, entsteht eine prägnante Form. Einzig die Abdeckungen der Brüstungen aus eloxiertem Aluminium sowie die Staketengeländer des Attikageschosses, der Dachterrasse und der Aussentreppen in gespritztem Metall bestehen aus einem anderen Material – mit ihrer dezenten Gestaltung treten sie jedoch in den Hintergrund. Damit bleiben trotz der Rohheit der Form die präzisen gestalterischen Entscheide der Architekten spürbar. Diese wiederum machen die roh geschnittene Form erst möglich – und das trotz der hohen technischen Anforderungen, die das Gebäude mit dem Minergie-Standard erfüllt.
Die zwei Gesichter von Hang- und Talseite
Im Innern gliedern zwei nicht rechtwinklige Erschliessungskerne die Grundfigur im Erd- und im Obergeschoss und lassen im Bereich der vier geschosshoch verglasten Ecken des Raums halboffene Nischen entstehen. Im Erdgeschoss gehen diese in einen zur Stadt orientierten, offenen Wohnraum über. Im Obergeschoss ergänzen raumbildende Leichtbauwände die abgeschlossenen Zimmer, die zur Fassade hin alle im Stil einer Enfilade miteinander verbunden sind. Im Dachgeschoss treten in den Gebäudeecken an Stelle der Erker vier Aussenräume, die unterschiedliche Ausblicke ermöglichen (Abb. 04).
Während das Kellergeschoss mit Garage und Technikräumen vollständig im Berg liegt – was eine aufwendige Fundation notwendig machte –, beherbergt das Sockelgeschoss die Schlafräume der Gartenwohnung sowie ein Badezimmer und einen Arbeitsraum. Da dieser zum Hang hin liegt, wird er durch eine in die Decke eingelassene, horizontale Glasfläche belichtet (Abb. 08).
Durch die allseitige Ausrichtung entstehen in beiden zweigeschossigen Wohnungen überraschende räumliche Abfolgen. So bleibt, auch wenn man sich in einem zum Hang orientierten Raum aufhält, die Stadtseite des Hauses spürbar – ebenso ist die Aussicht in den Grünraum präsent, während man den Blick über die Häuser der Stadt schweifen lässt. Diese Gleichwertigkeit der Ausrichtung des Hauses schafft zwei unterschiedliche Wahrnehmungen: eine urbane, auf die dicht bebaute Stadt bezogene und eine ländliche mit Blumenwiese und Wald. Die schlichte Materialität der Räume mit Leichtbauwänden und Möbeleinbauten in furnierter Braunkernesche, den schalungsglatten, lasierten Betonoberflächen, den Terrazzoböden und den eloxierten Fensterrahmen schafft eine dezente, beige-goldene Farbigkeit und sorgt für eine angenehme Raumatmosphäre. In der oberen Wohnung sind alle Leichtbauwände in einem warmen Grauton gestrichen, entlang der Erschliessungszonen sind diese mit Holz verkleidet. Konstruktiv notwendige Elemente wie Fensterprofile oder Absturzsicherungen sind zurückhaltend gestaltet
Vom Betonbau zum berankten grünen Körper
Die grosszügige Wirkung der Räume täuscht darüber hinweg, dass die begrenzte verfügbare Fläche von je ca. 103 m² pro Geschoss zu radikaler räumlicher Optimierung zwang. So haben die Treppen beispielsweise alle maximale Steigungsverhältnisse. Auch handwerklich war der Bau des Hauses anspruchsvoll. Laut Architekt Michael Meier war insbesondere die Schalung der teils schräg gestellten Betonwände eine Herausforderung, die jedoch dank der guten Zusammenarbeit mit dem Unternehmer habe gemeistert werden können. Statisch ist der Baukörper so konzipiert, dass die Fassade tragend ist. Die innen liegenden Betonwände der Erschliessungskerne werden praktisch nicht aktiviert, sondern sind nur aus gestalterischer Absicht in Beton ausgeführt. Die Betondecken liegen örtlich auf der einschaligen Betonfassade auf und sind mit 18 bis 22 cm Stärke vergleichsweise schlank.
Das Zweifamilienhaus erfüllt den Minergie-Standard und ist mit einer Bedarfslüftung ausgestattet. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Wärmepumpe mit Erdsonden. Während die im Hang liegenden Geschosse aussen gedämmt sind, ist der gegen aussen sichtbare Teil mit einer Innendämmung versehen. Das erste Jahr im Haus habe gezeigt, dass das Raumklima trotz der grossen Fensterflächen äusserst angenehm sei, so Michael Meier. Der Garten rund ums Haus soll sich über die Jahre entwickeln und der jetzt noch rohe Betonbau mit der Zeit zu einem berankten, grünen Körper werden, der sich im Herbst zu einem intensiven Rot wandeln wird. Auch die Blumenwiese mit Obstbäumen und Büschen braucht Zeit, bis sie sich voll entfalten wird.TEC21, Fr., 2013.11.15
15. November 2013 Jutta Glanzmann
Platte mit Nischen
Um einer Restfläche an attraktivster Luzerner Hanglage Bauland für vier Stadtvillen abzutrotzen, wurde die Fläche zweier bebauter Grundstücke um je die Hälfte gekappt, sodass insgesamt sechs Parzellen entstanden. Zur höheren Mathematik der Parzellierung gesellte sich die Kalkulation mit der auf 3.60 m limitierten Höhe der Baukörper. Architekt Daniel Lischer grub die vier zwischen dem Hotel Palace am See und dem Hotel Montana gelegenen Villen daher so in den Hang, dass sie das Terrain mit nur einem Geschoss überragen.
Das Grundstück befindet sich an zentraler Lage in Luzern, im sogenannten Haldengebiet, einem grossbürgerlichen Villenquartier am rechten Seeufer. Das Gebiet zwischen Vierwaldstättersee und Hitzlisbergstrasse, in dem auch die Adligenswilerstrasse liegt, gilt als «Aussichtstribüne» Luzerns.1 Die Südhanglage ist durch den Blick auf See und Alpen privilegiert. Anfang des 20. Jahrhunderts etablierten sich hier Pensionen, Sanatorien und Hotels. So grenzt das Grundstück der Stadtvillen direkt an das 1908–1910 von den Architekten Möri & Krebs erstellte Jugendstilhotel Montana (Abb. 02). 2009 erhielten Lischer Partner Architekten den Auftrag, die benachbarte spätklassizistische Villa an der Adligenswilerstrasse 18 zu sanieren. Im Lauf des Projekts entstand bei den Bauherren der Wunsch, ein Bebauungsprojekt für die brachliegende Freifläche des eigenen sowie des benachbarten Grundstücks zu erstellen.
Die Bedingungen waren indes alles andere als komfortabel: In den zugehörigen Grunddienstbarkeiten gab es die Auflage, dass auf dem Grundstück nicht höher als 3.60 m gebaut werden darf. Mit solchen privatrechtlichen und schwer angreifbaren Mitteln schützen Eigentümer von Liegenschaften am Hang ihren Blick auf See und Berge. Ausserdem mussten sich die Architekten mit einem Gefälle von 20 % arrangieren.
Sie schlugen daher eine Bebauung mit vier in den Hang geschobenen Stadtvillen vor und strebten eine Einheit von Garten und Bauten an. Die Gebäude platzierten sie wie Findlinge in den Garten. Verstreut liegen die vier Villen auf dem Gelände. Die im Innern zweigeschossigen Bauten ragen gerade einmal eingeschossig aus der Erde. Die Dachlinie verläuft parallel zum Hang. Was städtebaulich nach einer unauffälligen Lösung klingt, bedurfte eines massiven Eingriffs in das Erdreich. Heute ist jedoch von der Adligenswilerstrasse aus nur das Eingangstor sichtbar. Von hier führt kaskadenartig eine steile Treppe zwischen den bestehenden Bauten hindurch zu den vier Neubauten hinunter, gabelt sich und erschliesst diese jeweils paarweise. Die beiden unteren Häuser sind nach der Haldenstrasse ausgerichtet, die beiden oberen liegen parallel zur Adligenswilerstrasse. Durch die abwechselnde Setzung in Höhe und Winkel entstehen unterschiedliche Zwischenräume und Sichtachsen, und trotz der Nähe bilden sich Rückzugsnischen.
Die Landschaftsgestaltung ist ruhig und unauffällig. Das Wegenetz inklusive Treppen besteht aus grossformatigen Betonelementen. Die Bepflanzung mit Bodendeckern bildet einen ruhigen Rahmen für die Architektur, höhere Büsche setzen einzelne Akzente. Die privaten Gärten sind als offene Wiesen gestaltet und wegen ihrer bescheidenen Grösse und starken Steigung eher Abstandsgrün als Nutzflächen.
Die Stärke des Projekts liegt im handwerklichen Detail. Die Architekten formten ihre Neubauten zu klaren Baukörpern. Um eine möglichst massive Wirkung zu erzielen, sind die Fassaden dreiseitig geschlossen. So bleibt man auch vor Blicken der angrenzenden Nachbarn geschützt. Statt Fenstern sind Oberlichter, Terrassen und Loggien eingeschnitten. Als Material wählten die Architekten gelben Jurakalk, der mit seiner Oberflächenstruktur den Gebäuden einen steinernen Ausdruck verleiht. Allseitig sind die Gebäude mit diesem Stein verkleidet. Die Wände bestehen aus massivem Mauerwerk, Dächer und Loggien sind mit Platten aus dem gleichen Material ausgeführt. An den Ecken zeigen speziell geformte, von unten nach oben leicht angeschrägte Steine die präzise Massarbeit. Den Architekten war wichtig, den umliegenden klassizistischen Villen ein handwerklich hochwertiges Gegenüber zu bieten.
Da die Villen nicht parallel zum Hang stehen, sondern wie früher die Bauernhäuser mit der Schmalseite zum See weisen, mussten die gewünschten Quadratmeter durch eine Grundrisstiefe von 18 m erzielt werden. Das erforderte eine durchdachte Raumaufteilung und Kreativität, um das Licht ins Innere zu führen. Die Architekten erreichten dies, indem sie die Räume mittels Schiebe- und Drehelementen durchlässig gestalteten. Heute sind die Gebäude zu zwei Dritteln natürlich belichtet. Als Lichtquellen dienen die grossflächigen Verglasungen auf der Südfassade, die Loggia und die Oberlichter. Die Sicht auf den See ist durch die relativ geringe Höhe der Gebäude gemindert, aber ausschnitthaft immer wieder präsent.
Drehelemente verbinden Räume und schaffen Blickachsen
Man betritt die Stadtvillen auf der Ebene des Wohngeschosses. Unter dem hohen, gefalteten Dach liegt jeweils ein grosszügiger zweigeschossiger Wohnraum mit offener Küche, der über ein gebäudelanges Oberlicht erhellt wird. Seeseitig schliesst sich eine aus dem Gebäude geschnittene Terrasse an, die durch ihre flächige Steinverkleidung wie eingehauen wirkt. Eine Herausforderung stellte die Belichtung des unteren Geschosses dar. Hier sind die Schlafräume zum Garten hin orientiert. Hangseitig befinden sich die Sanitär- und Nebenräume. Da die Bauten extrem in die Tiefe entwickelt sind, entwarf Daniel Lischer spezielle räumliche Verbindungen, um Licht ins Innere zu holen bzw. Blickachsen nach aussen zu schaffen. So ist das Elternschlafzimmer durch Drehelemente mit dem – ähnlich grossen – Badezimmer verbunden, das wiederum in das rückwärtige Ankleidezimmer übergeht. Auch das Arbeitszimmer befindet sich im hintersten Bereich, profitiert jedoch durch den davor liegenden, nicht abgetrennten Flur von einem Stück Seeblick. Die Farbtöne im Gebäudeinnern sind erdig und verstärken den Charakter des eingegrabenen Hauses. An den Wänden ist ein weisser, teilweise hydrophobierter Schlämmputz aufgebracht.
Die Villen sind ein typisches Beispiel für den aktuellen Wunsch, auf grossflächigen innerstädtischen Grundstücken nachzuverdichten. Ein kompaktes Bauvolumen auf kleinerer Grundfläche war aufgrund der Dienstbarkeiten nicht möglich. Selbstverständlich ist ein Einfamilienhaus in der Stadt mit Seeblick in dieser Lage für die potenziellen Bewohner erstrebenswert. Doch gerade im Sinn einer Nachverdichtung ist eine solch flächenverbrauchende Bauform in der Stadt infrage zu stellen. Die Stadtvillen behindern zwar weder den Seeblick der angrenzenden Nachbargebäude noch treten sie in der Höhe massiv in Erscheinung. Aber sie besetzen einen grossen Teil der Fläche, die als grüne Topografie wichtiger Bestandteil der klassizistischen Villenbebauung am rechten Seeufer ist. Die ehemals zwei grossen Bauparzellen haben jeweils etwa die Hälfte ihrer Grundstücksfläche zugunsten vier neuer Parzellen abgegeben, sodass insgesamt sechs Grundstücke entstanden sind. Umso mehr sind die Stadtvillen als Einzellösung für ein Grundstück mit schwierigen baugesetzlichen Einschränkungen zu betrachten und nicht als städtebauliches Patentrezept.TEC21, Fr., 2013.11.15
15. November 2013 Katja Hasche