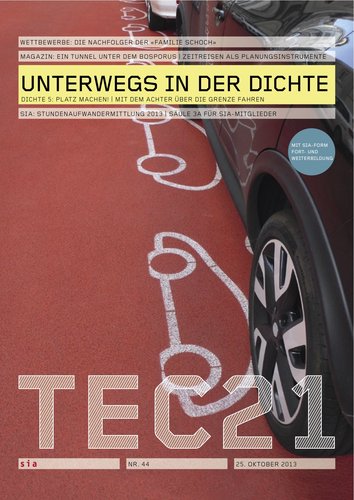Editorial
Unter Verkehrsproblemen leidet so gut wie jede Grossstadt. Sie sind für alle Bewohner spürbar, jeder ist betroffen. Unsere Umgebung wird dichter und enger, der Verkehr und die verschiedenen Ansprüche nehmen zu – und damit auch die Konflikte. Ein Zurück zu verkehrseinsparendem Verhalten ist allerdings eher unwahrscheinlich. Genauso wenig, wie die Technologisierung zum papierlosen Büro geführt hat, entwickelt sich durch steigende Bewohnerzahlen in den Städten die Gesellschaft, in der jeder still sitzen bleibt.[2]
Im internationalen Vergleich geht es in den Schweizer Städten noch verhältnismässig «ruhig» zu. Doch auch hier lohnt es, sich Gedanken um die Zukunft zu machen. Aus- und Umbauten bestehender Infrastrukturanlagen sind eine wichtige Aufgabe. Das Versprechen kurzer Wege, lebendiger Plätze, ansprechend gestalteter Strassen, einfacher Umsteigebeziehungen und guter Infrastruktur für Velos und Fussgänger lassen beim Verzicht auf das Auto weniger Verlustgefühle aufkommen.
Die Verkehrsplaner begreifen die Mobilität heute als System und Zusammenwirken aller Verkehrsmittel. Um unterirdische Anlagen, urbane Seilbahnen oder zweistöckige Strassen als Lösung gegen den Verkehrskollaps geht es in dieser Ausgabe nicht, eher um Optimierung und Ausbau bestehender Strukturen. Ganz konkret: die Verlängerung der Tramlinie 8 in Basel ins angrenzende Deutschland. Sie soll helfen, den Verkehr in der trinationalen Region in den Griff zu bekommen – und vielleicht auch einen Wandel im Kopf bei der Verkehrsmittelwahl zu erreichen.
Daniela Dietsche
Anmerkungen:
[01] Weert Canzler, «Verkehr beginnt im Kopf» in: Michael Braum, Wilhelm Klauser (Hg.), Baukultur Verkehr, Orte/Prozesse/Strategien, Bundesstiftung Baukultur, Zürich, 2013.
[02] Ton Venhoeven, Rick ten Doeschate, «Die mobile Stadt – auf Holländisch», a. a. O. Weitere Informationen zum Buch:
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Die Nachfolger der «Familie Schoch»
10 MAGAZIN
Ein Tunnel unter dem Bosporus | Sport und Bewegung in der Dichte | Planungshilfe Güterverkehr | Zeitreisen als Planungsinstrumente | Der Garten als Wissensraum
16 PLATZ MACHEN!
Rupert Wimmer, Jonas Bubenhofer
Wer fährt und wer nicht? Wie und wie oft fahren wir? Welche Anreize braucht es, damit mehr Menschen auf das Auto verzichten?
20 MIT DEM ACHTER ÜBER DIE GRENZE
Michael Bont
Die Tramlinie 8 in Basel wird derzeit über die Grenze nach Weil am Rhein verlängert. Ziel ist es, den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtaufkommen zwischen Basel und den südbadischen Agglomerationsgemeinden zu erhöhen.
26 SIA
SIA-Form Fort- und Weiterbildung | Stundenaufwandermittlung 2013 | Säule 3a für SIA-Mitglieder | Beitritte zum SIA im 3. Quartal 2013 | Kurzmeldungen
31 FIRMEN | PRODUKTE
IMP Bautest | Peri | Hydroplant | Podpod Design | Zaunteam | SPV Schweizerischer Plattenverband | Hawa | Zumtobel Licht | Armstrong Building Products
37 IMRPESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Platz machen!
In dichten Stadträumen ist das Auto die falsche Wahl. Mit dem Velo, dem öffentlichen Verkehr oder zu Fuss bewegt man sich stadtverträglich und kommt schneller voran. Das klingt logisch, funktioniert in der Praxis aber nicht allerorts gleich gut. Welche Anreize braucht es, damit mehr Menschen auf das Auto verzichten? Verkehrsplaner müssen auf Mittel zurückgreifen, die über ihr klassisches Handwerkszeug hinausreichen – zum Beispiel auf Öffentlichkeitsarbeit.
Das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum stellt die Verkehrsplanung vor neue Herausforderungen. Immer mehr Menschen und Arbeitsplätze auf demselben Raum: Wie soll das funktionieren? Schon heute sind die Verkehrsinfrastrukturen überlastet. Der Verteilkampf um den knappen Strassenraum und das Pendeln zwischen den Siedlungen bestimmen die öffentliche Diskussion. Ein Blick auf den Mikrozensus Mobilität und Verkehr[1] von 2010 hilft, das System Verkehr und die Zusammenhänge zwischen Siedlung und Verkehr zu verstehen. Dabei wurden die befragten Haushalte nach dem Siedlungstyp ihrer Umgebung (vor allem die mittlere Einwohnerdichte) gruppiert und ihr Mobilitätsverhalten ausgewertet. Damit kann man sich von einer Kategorisierung nach dem Raumtyp – also Grossstadt oder ländliche Gemeinde – lösen und neue Kategorien bilden, die den Siedlungstyp – Einfamilienhaus oder dichte Siedlung in der Agglomeration – besser abbilden.
Systemzusammenhänge verstehen
Die Auswertung zeigt, dass die Anzahl Wege[2], die wir täglich ausser Haus zurücklegen, unabhängig vom Wohnort mit 3.3 bis 3.5 konstant ist. Sie kann individuell schwanken, vor allem das Alter hat einen Einfluss auf die Ausserhausmobilität. «In der Masse» bewegen wir uns relativ konform. Unabhängig vom Wohnort sind wir durchschnittlich rund 80 bis 90 Minuten ausser Haus unterwegs. Diese Zahl ist seit 30 Jahren konstant. Das bedeutet nichts anderes, als dass schnellere Verkehrsinfrastrukturen, wie zum Beispiel die Neubaustrecke Olten–Bern, nicht zu Zeitersparnissen der Reisenden führen, sondern dass wir längere Wege zurücklegen. Weiter zeigt sich, dass bei steigender Bebauungsdichte der Anteil der Wege zunimmt, die zu Fuss, mit dem Fahrrad und dem öffentlichen Verkehr (öV) zurückgelegt werden; gleichzeitig nimmt der Anteil der Autofahrten ab. In Siedlungsgebieten mit höherer Bebauungsdichte nehmen dank der Konzentration der Nutzungen auch die Weglängen ab. Interessant ist, dass das Mobilitätsverhalten weniger stark durch den Raumtyp bestimmt wird, sondern viel stärker durch den Siedlungstyp und die Lage. Die Bewohner von Einfamilienhausgebieten fahren schweizweit ähnlich viel Auto – unabhängig, ob sich dieses Einfamilienhausgebiet in der Stadt oder auf dem Land befindet. Analog ist der Anteil von öV, Fuss- und Veloverkehr in den dichten Siedlungen in der Agglomeration gleich hoch wie in dichten Siedlungen in der Stadt.
Auf den eigenen Füssen durch dichte Räume
Die Fortbewegungsmittel der Dichte sind die eigenen Füsse, das Velo und die öffentlichen Verkehrsmittel. Diese haben nicht nur eine höhere Leistungsfähigkeit und somit einen geringeren Flächenbedarf, sie sind auch umweltfreundlicher als das Auto. Standorte, die gut mit dem öV erschlossen sind, eignen sich also besonders für die bauliche Verdichtung. Darüber hinaus braucht es gemischte Quartiere mit einem Mix an Arbeitsplätzen, Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen und Freizeitangeboten. Ein Beispiel ist die Siedlung Sihlbogen der Baugenossenschaft Zurlinden in Zürich-Leimbach. An dem durch die Sihltalbahn gut erreichbaren Standort entstand bis Sommer 2013 ein Areal mit 220 Wohnungen und Gewerbeflächen. Ein spezielles Mobilitätsmanagement soll ein nachhaltiges Verkehrsverhalten fördern: Jeder Haushalt erhält jährlich einen Gutschein über 800 Fr. für den öffentlichen Verkehr, und die Bewohner verpflichten sich im Mietvertrag, kein eigenes Auto zu besitzen, sondern Carsharing zu nutzen, das schrittweise nach dem tatsächlichen Bedarf ausgebaut wird.
Sicher und komfortabel von A nach B
Um öV, Rad- und Fussverkehr zu fördern, sind leistungsfähige, sichere und komfortable Infrastrukturen nötig. Dementsprechend müssen die Gemeinden und Städte die Trottoirs verbreitern und die Aufenthaltsflächen vergrössern, den Radfahrern durchgehende Radstreifen und -wege anbieten und den öV ausbauen. Dazu braucht es einen klaren politischen Willen. Da unsere Strassenräume nach wie vor stark auf die Anforderungen des motorisierten Individualverkehrs ausgerichtet sind, geht es meist nicht ohne Einschränkungen für diesen wie die Reduktion von Fahrstreifen oder kürzere Grünzeiten. Als Paradebeispiele im Radverkehr dienen Amsterdam oder Kopenhagen, die seit Jahrzehnten die Radverkehrsinfrastruktur sukzessive ausbauen. In Kopenhagen, das im Alltagsverkehr einen Radverkehrsanteil von 50 % anstrebt (heute rund 35 %), sind auf den wichtigen Einfallsachsen die Lichtsignalanlagen (LSA) so koordiniert, dass Radfahrende eine «Grüne Welle» haben. Aber auch eine Autostadt wie München verfolgt seit einigen Jahren eine Verkehrsplanung mit dem Ziel, den Radverkehr zu fördern. Begleitet werden die Infrastrukturmassnahmen durch ein entsprechendes Marketing. Als Folge davon hat in München der Anteil der Wege, die mit dem Rad zurückgelegt werden, in den letzten zehn Jahren von 10 auf 17 % zugenommen. Im Vergleich dazu liegt der Radverkehrsanteil in Zürich oder St. Gallen nur bei 6 bzw. 3 %, in typischen Radverkehrsstädten wie Basel oder Winterthur bei 16 bzw. 13 %.
Dem Bewusstsein auf die Sprünge helfen
Um das Umsteigen vom Auto auf die Verkehrsmittel der Dichte zu erleichtern, braucht es handfeste Anreize. Aus diesem Grund ist Mobilitätsmanagement wichtig. Es gilt, Alternativen zum gewohnten Verhalten schmackhaft und die positiven Aspekte des Gehens, Velofahrens und des Bahn- und Busfahrens bewusst zu machen. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten helfen zudem, die Verkehrsspitzen zu brechen. Dass das funktionieren kann, hat das Kantonsspital Baden vorgemacht. Aufgrund der zeitlichen Überlappungen der verschiedenen Dienste (Tag-, Spät- und Nachtdienst) kam es zu Engpässen beim Parkplatzangebot. Eigentlich hätte man das Parkhaus erweitern müssen. Dem Kantonsspital gelang es aber nach der Einführung des Mobilitätsmanagements Mitte der 2000er-Jahre, mit einer differenzierten Parkplatzbewirtschaftung, einem Ökobonus, Carsharing und gezielten Informationen, 30 % der Beschäftigten, Patienten und Besucher zum Umsteigen auf die Verkehrsmittel der Dichte zu animieren. Der Anteil von öV, Fuss- und Radverkehr erhöhte sich zwischen 2005 und 2007 von 17 auf 47 %, das Parkhaus musste nicht erweitert werden.
Verkehrsregeln durch Sozialverhalten ersetzen
Der Strassenraum in unseren gewachsenen Siedlungsstrukturen ist begrenzt. Mit Verkehrsmanagement kann er effizient genutzt werden: Dosierstellen verlagern den Stau an weniger sensible Orte und lassen nur so viel Verkehr in die Stadtzentren, wie dort verarbeitet werden kann. Dank einer entsprechenden Steuerung der LSA kann der öV auch ohne Eigentrasse priorisiert werden, und es bleibt Platz für Radstreifen oder grössere Fussgängerflächen. Die Sicherheitsanforderungen an die Verkehrsinfrastrukturen (z. B. Verkehrstrennung oder Sichtweiten) steigen mit den Fahrgeschwindigkeiten. Geschwindigkeitsbegrenzungen ermöglichen Lösungen nach dem Prinzip der Koexistenz, die weniger Platz benötigen und eine höhere Gesamtleistungsfähigkeit aufweisen. Geringere Geschwindigkeiten leisten zudem einen positiven Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur Lärmbekämpfung.
Ein Beispiel aus Biel: Der Centralplatz wird täglich von rund 10 000 Fahrzeugen und 1200 Bussen befahren. Mit einer Umgestaltung im Jahr 2002 konnte der Verkehrsknoten in einen Platz verwandelt und Raum für Fussgänger und Aufenthalt zurückgewonnen werden. Die niedrigen Geschwindigkeiten in der Begegnungszone erlauben ein Miteinander von Autoverkehr, Fussgängern und Velofahrern. Solche Ansätze scheitern leider oft, da vor allem das Gewerbe befürchtet, dass Behinderungen des Autoverkehrs ihm schaden könnten.
In Wirklichkeit passiert das Gegenteil: So zeigen die Vorher-nachher-Untersuchungen für die Schwarzenburgstrasse in Köniz, dass die Autos flüssiger und schneller verkehren, seit die Fussgängerstreifen aufgehoben und die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt wurden. Die Umgestaltung der Kantonsstrasse hat das Zentrum von Köniz und das lokale Gewerbe gestärkt. Die aktuellen Erfahrungen mit Umgestaltungen nach dem Koexistenzprinzip zeigen: Gewisse Randbedingungen müssen eingehalten und die Strassenräume gut geplant und sorgfältig ausgeführt werden (vgl. Kasten S. 19).
Gängiges Vorurteil widerlegt
Fälschlicherweise gehen wir davon aus, dass Stadtbewohner zur Erholung «ins Grüne» fliehen. Die Auswertung des Mikrozensus zeigt das Gegenteil: Bewohner von Siedlungen mit geringer Dichte legen viel längere Freizeitwege zurück. Mit höheren Bebauungsdichten steigen jedoch die Anforderungen an den Aussenraum. Neben verkehrlicher Funktion und Sicherheit wird die Gestaltung wichtiger. Der Strassenraum ist auch Lebensraum. Zur Aufenthaltsqualität gehört, dass man sich vor dem motorisierten und dem Veloverkehr sicher fühlt. Die Geschwindigkeit zu reduzieren hilft, ein Gleichgewicht zwischen den Nutzungsansprüchen herzustellen und die Dominanz des motorisierten Verkehrs zu brechen. So wird die Kommunikation und die gegenseitige Rücksichtnahme gefördert. Die angesprochenen Vorher-nachher-Untersuchungen in Köniz zeigen, dass die Automobilisten bei Tempo 30 rücksichtsvoller agieren. Unter- und Überführungen können zurückgebaut, LSA durch Kreisverkehre oder Vortrittsknoten ohne LSA ersetzt und die strikte Trennung der Verkehrsarten aufgeweicht werden. Wie wichtig die Gestaltung und die Verkehrsberuhigung für die Siedlungsqualität beim untergeordneten Strassennetz[3] ist, weiss man. Entsprechende Ansätze werden auch vielfach umgesetzt. Hingegen herrscht beim übergeordneten Strassennetz nach wie vor die Lehrmeinung, dass sich hohe Verkehrsbelastungen und gute Strassenraumgestaltung ausschliessen. Dabei gibt es genügend Gegenbeispiele. Die Champs-Elysées in Paris oder der Gürtel in Wien sind grossstädtische Exempel für gestaltete, integrierte Hauptverkehrsstrassen, die Verkehrsbelastungen von über 100 000 Mfz/Tag aufweisen. Trotzdem wenden sich die Siedlungen nicht von diesen Strassenzügen ab, und die Strassen können à Niveau überquert werden. Ein Beispiel im kleineren Massstab ist die Seebahnstrasse in Zürich, die im Zuge der flankierenden Massnahmen zur Westumfahrung (TEC21 40/2008) umgebaut wurde. Trotz hoher Belastungen von 25 000 bis 30 000 Mfz/Tag konnte die Barrierewirkung stark reduziert werden. An den Plätzen wie z. B. beim Bahnhof Wiedikon entwickelt sich zunehmend städtisches Leben.
Frische Ideen gefragt
Mit der geschilderten Entwicklung gehen auch neue Anforderungen an die Verkehrsingenieure einher. Neben Verkehrsplanung, -technik und -wegebau sind beim Strassenraumentwurf auch Kenntnisse im Städtebau, der Gestaltung und der Soziologie nötig. Dies erfordert, wenn nicht das Wissen, so zumindest das Verständnis des Verkehrsingenieurs für diese Disziplinen und die Fähigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Und es braucht Zeit, Mittel und Geduld für die Arbeit mit anderen Disziplinen und mit der betroffenen Bevölkerung. Ideenreiche Verkehrsingenieure sind gefragt. Und es bedarf mutiger Entscheidungsträger, die neue Wege beschreiten. Denn der Verkehr in der Dichte stuft die Funktion und Bedeutung des Autos zurück: Der stadtverträgliche Verkehr stellt den Menschen und das menschliche Mass in den Mittelpunkt.
Anmerkungen:
[01] Mit dem Mikrozensus Mobilität und Verkehr erhebt das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) gemeinsam mit dem Bundesamt für Statistik (BfS) alle fünf Jahre das Mobilitätsverhalten der Schweizer Bevölkerung. Rund 60 000 Haushalte bzw. Personen werden nach einem standardisierten Verfahren (CATI-Technik) telefonisch hinsichtlich ihres Verkehrsverhaltens an einem Stichtag, der über das ganze Jahr verteilt ist, befragt. Hierbei werden unter anderem die an diesem Stichtag zurückgelegten Wege, die genutzten Verkehrsmittel, der Wegezweck (Arbeit, Einkauf etc.) und der Zeitaufwand für die Ausserhausmobilität erhoben.
[02] In der Moblilitätserhebung werden Ausgänge, Wege und Etappen unterschieden. Ein Ausgang dauert vom Weggang vom Wohnort bis zur Rückkehr und kann aus verschiedenen Wegen bestehen. Zu jedem Weg gehört ein Zweck am jeweiligen Zielort. Ein Zweck ist zum Beispiel Arbeit. Frau Schweizerin legt z. B. mit einem Ausgang zwei Wege zurück, und zwar von zu Hause zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Dabei setzt sich ein Weg z. B. aus drei Etappen zusammen: Etappe 1 – mit dem Velo zum Bahnhof, Etappe 2 – mit der S-Bahn in die Stadt, Etappe 3 – zu Fuss zum Arbeitsort.
[03] Untergeordnetes Strassennetz: Erschliessungs- und Sammelstrassen mit geringen Verkehrsbelastungen von bis zu 5000 Mfz/Tag, übergeordnetes Strassennetz: Hauptverkehrsstrassen mit überörtlicher Verbindungsfunktion und Belastungen über 5000 Mfz/TagTEC21, Fr., 2013.10.25
25. Oktober 2013 Rupert Wimmer, Jonas Bubenhofer
Mit dem Achter über die grenze fahren
Das Tramnetz der Region Basel ist seit Langem kaum verändert worden. Nun wird die Tramlinie 8 nach Weil am Rhein (D) verlängert. Der Ausbau erfolgt in einem Gebiet mit dichtem Verkehr. Anwohner, Gewerbe-, Industrie- und Logistikunternehmen mussten in den Planungsprozess einbezogen werden.
Der grenzüberschreitende Tramverkehr in Basel ist keine Erfindung der jüngsten Zeit. Zwischen 1900 und 1919 begannen Trams aus Basel, in das benachbarte Ausland nach St-Louis (F), Huningue (F), Lörrach (D) und zurück zu fahren. Der Betrieb war immer von den wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der Schweiz zu Frankreich und Deutschland abhängig. So fuhren während der beiden Weltkriege keine Trams über die Grenze. In der Zeit dazwischen war Basel das unbestrittene Zentrum der Region. Die umliegenden elsässischen und badischen Gemeinden waren auf eine schnelle, verlässliche und günstige Anbindung an die Metropole am Rhein angewiesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Wirtschaftswunder entflochten sich die Beziehungen langsam. Die Gemeinden in Frankreich und Deutschland entwickelten mehr Selbstbewusstsein und emanzipierten sich vom Zentrum Basel. Der Fokus der Verkehrsentwicklung lag auf der eigenen Gemeinde. Gleichzeitig kamen Schienen und Bauten in ein kritisches Alter und mussten kostspielig erneuert oder an neues Rollmaterial angepasst werden. Die dazu nötigen Mittel waren jedoch nicht zurückgestellt worden. Die Euphorie für das Auto tat ein Übriges: Fortan verkehrten Busse von den Dörfern in die florierenden Zentren von St-Louis und Lörrach.
Grenzüberschreitender Netzausbau, um Verkehr zu bewältigen
Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden. Der Regio-Gedanke und das Bewusstsein für den Umweltschutz wachsen. Der Kanton Basel-Stadt versteht sich als Teil eines trinationalen Wirtschafts- und Lebensraums. Von dieser internationalen Verflechtung profitiert die ganze Nordwestschweiz, wirtschaftlich und kulturell. Einerseits arbeiten viele Elsässer und Deutsche in Basel, andererseits verbringen viele Basler ihre Freizeit im Elsass und in Südbaden. Der vereinfachte Grenzverkehr in Europa mit den Abkommen von Schengen und Dublin erleichterte und intensivierte die internationale Verflechtung.
Die Region Nordwestschweiz besteht heute aus der Kernstadt Basel und einer trinationalen Agglomeration. Die wachsende Bevölkerung in der Agglomeration führte dazu, dass der Anteil des Verkehrs zwischen Kernstadt und Agglomeration am gesamten Verkehr gestiegen ist. Das Tramnetz dagegen wurde seit den 1930er-Jahren kaum noch erweitert und entspricht deshalb nicht mehr der sozioökonomischen Realität. Während es im Süden und im Osten Teile des angrenzenden Kantons Basel-Landschaft erschliesst, endet es im Norden und Westen an der nahe gelegenen Landesgrenze. Erhebungen des Kantons Basel-Stadt haben ergeben, dass der Modal Split[1] zwischen Basel und dem schweizerischen Teil der Agglomeration zwar bei rund 37 % öV-Anteil liegt. Im Verkehr mit den südbadischen Agglomerationsgemeinden liegt der Modal Split jedoch lediglich bei etwa 17 % und bei 12 % zwischen Frankreich und der Schweiz. Die Herausforderung besteht darin, das Verkehrswachstum möglichst ökologisch zu bewältigen, das heisst zu einem hohen Prozentsatz auf den öffentlichen Verkehr zu lenken. Politik und Verwaltung des Kantons sehen das grösste Potenzial dafür im grenzüberschreitenden Netzausbau. Richtung Deutschland ist dieser Ausbau mit der Verlängerung der Tramlinie 8 bereits in vollem Gang. Um die zentrumsnahe Agglomeration an die Kernstadt anzubinden, wurde dem Tram gegenüber der S-Bahn der Vorzug gegeben. Die Tramnetzplanung sucht aber Anknüpfungspunkte mit dem übergeordneten Regio-S-Bahn-Netz[2].
DIe Tramverlängerung als Teil des Agglomerationsprogramms
Das Projekt der Tramverlängerung der Linie 8 von Kleinhünigen nach Weil am Rhein ist so organisiert, dass sämtliche strategischen Entscheide zwischen Basel-Stadt und Weil am Rhein partnerschaftlich im Rahmen der Projektleitung (technisch) respektive der Projektsteuerung (politisch) gefällt werden; die eigentlichen Projektarbeiten erfolgen jedoch territorial getrennt in den beiden Abschnitten Basel und Weil am Rhein. Die Teilprojekte werden in regelmässigen Koordinationssitzungen unter der Federführung des Kantons Basel-Stadt aufeinander abgestimmt. Den Grundstein für das Projekt legte im Jahr 2005 der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt mit dem öV-Programm 2006 bis 2009[3], das als strategisches Ziel diverse grenzüberschreitende Tramverlängerungen nach Frankreich und Deutschland festsetzte. Eine Nutzwertanalyse[4] beurteilte die Verlängerung der Linie 8 als positiv. Der Bund nahm daraufhin das Vorhaben in die Liste der dringlichen Agglomerationsverkehrsprojekte auf, die durch den Infrastrukturfonds gefördert werden. Bedingung dafür war; Baubeginn vor Ende 2008. So entstand Termindruck, und man gab viele Arbeiten parallel in Auftrag, um das Dossier für das Plangenehmigungsverfahren Ende September 2007 einreichen zu können. Parallel zum Plangenehmigungsverfahren wurden im Sommer 2008 die ersten Baumeisterarbeiten ausgeschrieben. Das Planungsrecht wurde im Oktober 2008 erlangt. Nur so konnte der Baubeginn am 6. Dezember 2008 mit der Aufrichte des ersten Fahrleitungsmasts in der Kleinhüningeranlage gefeiert werden.
Welchen Weg nimmt das Tram 8?
Die Verlängerung der Tramlinie 8 um 2.8 km wird ab der Gärtnerstrasse in Basel Kleinhünigen über die neu gebaute Gärtnerstrassenbrücke (Abb. 05), die Kleinhüningeranlage und die Hiltalingerstrasse zum Zoll Weil am Rhein/Friedlingen geführt. Die Gleise werden auf diesem Abschnitt auf der Fahrbahn mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) geführt. Um einen flüssigen Trambetrieb zu gewährleisten, muss Kleinhünigen daher vom Verkehr entlastet werden. Insbesondere soll die Kleinhüningeranlage ab Inbetriebnahme des Trams für den Schwerverkehr gesperrt werden. Deshalb werden vor der ersten der drei neu gebauten Hiltalingerbrücken zwei Rampen auf die Südquaistrasse gebaut. Sie leiten den Schwerverkehr und auch einen gewissen Anteil des MIV ab Zoll in Richtung Schweiz und von der Schweiz in Richtung Zoll. Vertreter der Quartierbevölkerung von Kleinhüningen wurden eng in die Projektentwicklung einbezogen. So konnte man das Projekt massgeblich verbessern und gut auf die Bedürfnisse des Quartiers abstimmen.
Ab der Grenze wird das Tram am Rheincenter vorbei durch die Hauptstrasse von Weil-Friedlingen fahren, die Autobahnbrücke unterqueren und beim Bahnhof Weil am Rhein enden. Auf der deutschen Seite werden die Gleise mehrheitlich auf einer separaten Spur als Rasengleis geführt. Parallel zur bestehenden Friedensbrücke wird derzeit beim Bahnhof in Weil eine neue Trambrücke mit direkten Abgängen zu den Bahnsteigen der Regio-S-Bahn gebaut. Die Inbetriebnahme der verlängerten Tramlinie ist auf den Fahrplanwechsel 2014/2015 vorgesehen. Am Anfang ist ein 15-Minuten-Takt geplant, das heisst, jedes zweite Tram fährt in Kleinhünigen weiter nach Deutschland.
Für den öffentlichen Verkehr gestalten
Im Rahmen des Projekts wurden drei Wettbewerbe durchgeführt und so gestalterisch ansprechende Lösungen für eine Brücke, eine Tramwartehalle und eine Zollanlage gefunden. Hier zeigte sich, dass sich mit dem «Werkzeug» Wettbewerb ganz unterschiedliche Ziele erreichen lassen.
Die Möglichkeit, die Gärtnerstrassenbrücke (Abb. 5) vom verkehrstechnischen Umfeld abzugrenzen, bot die Chance, eine Totalunternehmer-Submission als Gesamtprojektwettbewerb durchzuführen. Diverse sowohl städtebaulich als auch technisch unterschiedliche Lösungen konnten in einer hohen Reife miteinander verglichen werden. Umgesetzt wurde die asymmetrische Spannbetonbrücke (C30/37) von Implenia Bau mit der Ingenieurgemeinschaft Synaxis Bauingenieure, Preisig Bauingenieure, Höltschi & Schurter und Architekt Eduard Imhof. Ihre Spannweite beträgt 36 m und ist auf den alten Widerlagern der früheren Brücke fundiert. Um die Auflagerkräfte beim rechtsufrigen Widerlager zu reduzieren, ist rund 10 m hinter dem linksufrigen Widerlager eine Zugpfahlreihe angeordnet. Die Brücke wurde 2012 eröffnet.[5]
Ein Architekturwettbewerb fand unter der Federführung der Basler Verkehrs-Betriebe statt, um diverse vorgegebene Nutzungen wie Wartehalle, Kiosk und Diensträume in einem neuen Betriebsgebäude zu vereinen. Im März 2011 entschied sich die Jury für das Projekt «auf der Mauer» von Rüdisühli Ibach Architekten. Die Konstruktion besteht aus einem massiven Sockel und vorfabrizierten Holzelementen für Wand und Dach. Die Anlage ist seit Ende 2012 in Betrieb (Abb. 04).
Schliesslich bot sich im Architekturwettbewerb zum neuen Zollgebäude (Abb. 01) an der Landesgrenze ein passendes Gefäss, um unterschiedlichste Anforderungen der Behörden und Nutzer beider Länder wie Zoll, Grenzwache und Bundesämter gebührend zu berücksichtigen. Die Jury befand im Jahr 2011, dass dies Zickenheiner Architekten und Jauslin Stebler am besten gelungen sei. Durch die Verknüpfung von Mittelkabine und Dach tritt die Zollstation als kompakter Solitär in Erscheinung. Das Dach ist auf acht Stützen abgestellt. Die Tragstruktur besteht aus zwei Hauptträgern aus Stahl und Sekundärträgern aus Brettschichtholz in Querrichtung. Für die Stabilität in Querrichtung sind zwei zusätzliche Stahlrahmen im Baukörper integriert. Die Stützen sind in Köcherfundamenten eingespannt, die von einem umlaufenden Frostriegel eingefasst sind. Am 12. September 2013 wurde die neue Grenz- und Zollanlage – vorerst nur in Richtung Schweiz – in Betrieb genommen. Reisende nach Deutschland müssen noch bis spätestens Anfang Dezember diesen Jahres die provisorische Anlage benutzen.
Stark frequentierter Betonkreisel
Als besonders herausfordernd innerhalb des Gesamtprojekts entpuppte sich die Projektierung und Realisierung des neu zu erstellenden Kreisels beim Rheincenter, rund 300 m nördlich des Zolls in Weil am Rhein (Abb. 06 und 07). Der bestehende Knoten in der Verbindung von Hafen, Gewerbegebiet, Einkaufszentrum und Hauptstrasse zeichnete sich durch eine generell hohe Verkehrsbelastung mit einem starken Lkw-Anteil aus. Zudem müssen über 400 Schwerlastverkehre pro Jahr den Knoten passieren. Neu führt nun auch noch das Tramtrassee mit sehr engen Gleisbögen (R = 22 m) durch den Knoten.
Aufgrund dieser grossen Belastungen des MIV hat sich die Stadt Weil am Rhein entschieden, einen Betonkreisel mit Tramdurchfahrt zu projektieren. Beton hat den Vorteil, dass er härter und dauerhafter ist als Asphalt. Da es sich für Deutschland um eine wenig bekannte Lösung handelte – es gibt im ganzen Land nur eine Handvoll Referenzprojekte dafür –, wurde ein Schweizer Unternehmen mit der Ausführungsplanung beauftragt. Parallel dazu gaben die Stadtwerke Weil am Rhein den Basler Verkehrs-Betrieben den Auftrag, die Planung und den Bau der Gleisanlagen im Abschnitt Weil am Rhein auszuführen. Zusammen mit dem Planer des Betonkreisels galt es nun ebenfalls ein speziell auf diese Verhältnisse ausgelegtes und angepasstes Gleisoberbausystem zu evaluieren. Es handelt sich dabei um einen Schienentrog mit durchgehend elastisch gelagerten und eingebetteten Schienen. Dieses spurhalterlose System[6] besticht vor allem durch die völlige Entkoppelung der Schienen vom Beton des Kreisels (C30/37). Der spätere Wechsel der verschlissenen Schienen in dem geschlossenen Schienentrog ist ohne Betonaufbruch möglich. Das System hat sich vor allem auch in Bereichen mit schwerem querenden MIV als langlebig und robust erwiesen.
Tram 8 als Teil der GEsamtstrategie
Die Verlängerung der Tramlinie 8 ist eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten: Gebaut wird in einem Gebiet, das von dichtem Verkehr beherrscht wird. Entlang dem Bauperimeter gibt es viele Anwohner und viele Gewerbe-, Industrie- und Logistikunternehmen. Zudem überquert das Projekt die Grenze zu Deutschland. Es hat sich positiv auf den Projektverlauf ausgewirkt, dass alle potenziell Betroffenen frühzeitig und kontinuierlich in das Projekt einbezogen wurden. Derzeit wird die Verlängerung der Tramlinie 3 nach Frankreich als weiteres grenzüberschreitendes Projekt geplant. Sie soll via Bourgfelden-Grenze nach St-Louis führen.
Bei aller Nähe der betroffenen Gemeinden bestehen doch erhebliche kulturelle Unterschiede, wie sich auch in der Zusammenarbeit mit Weil am Rhein gezeigt hat, sei es zum Beispiel bezüglich anderer Aufsichtsbehörden oder der Sitzungskultur. Diese Unterschiede sind zu respektieren und in der Arbeit zu berücksichtigen, um ein grenzüberschreitendes Projekt rasch vorantreiben zu können. Ein weiterer Faktor sind die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedinungen. Ein intensiver Austausch hilft mit, den Einfluss all dieser Faktoren rechtzeitig zu erkennen und einzuplanen.
Diese Erkenntnisse werden aber auch kommende Ausbauvorhaben beeinflussen, zum Beispiel «Tramnetz Region Basel 2020» (vgl. Kasten) im schweizerischen Teil der Agglomeration. Wichtig wird es sein, die Betroffenen frühzeitig einzubinden. Denn sie sind später die Kundinnen und Kunden, die das neue Transportsystem nutzen sollen.
Anmerkungen:
[01] Modal Split: Aufeilung von Verkehrsleistungen, Wegzeiten oder Anzahl Wegen auf verschiedene Verkehrsträger bzw. Verkehrsmittel.
[02] Weitere Informationen zum Herzstück Regio-S-Bahn Basel: www.herzstueck-basel.ch
[03] öV-Programm 2006–2009, Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, verabschiedet 27. September 2005.
[04] Nutzwertanalyse der Firma Intraplan Consult, München.
[05] Seit Juli 2013 ist an der Gärtnerstrasse die erste Basler Tramhaltestelle fertiggestellt, die den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) entspricht. Das BehiG sieht vor, dass Menschen mit einer Behinderung alle öffentlichen Einrichtungen selbstständig benützen können. Für den öffentlichen Verkehr bedeutet dies, dass die Türen von Trams und Bussen auf der gleichen Höhe wie die Kanten der Haltestellen liegen müssen, damit sie kein Hindernis für Rollstühle oder Rollatoren sind. Natürlich wird damit auch das Einsteigen mit einem Kinderwagen oder für betagte Mit menschen einfacher.
[06] Um den Abstand von 1 m zwischen den Schienen eines Gleises zu garantieren, werden in Basel alle 2 m Spurstangen angeordnet. In dem neu gewählten System gibt es keine Spurstangen. Jede Schiene ist separat in den Stahltrog eingelassen, gerichtet, fixiert und dann ausgegossen worden.
[07] Vortrag von Dr. Jörg Jermann beim Trinationalen Bahnkongress Basel am 16. Mai 2013.TEC21, Fr., 2013.10.25
25. Oktober 2013 Michael Bont