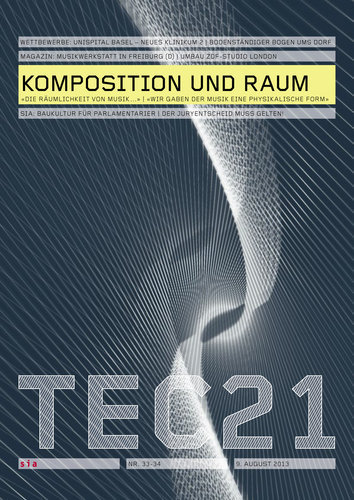Editorial
Der Komponist, Maler und Filmer Fred van der Kooij, «einer der originellsten Köpfe zwischen Film und Musik, Bild und Ton, Theorie und Praxis in Wort und Ohr in der Schweiz»,[1] stellte vor einer Weile eine berückende These auf: Der französische Komponist Nicolas Gombert (1495–1560) habe seinerzeit die Akustik in seine Musik integriert: «Ich glaube, Gombert hat die Akustik in seine Stücke hineinkomponiert. Sie sind sehr basslastig, haben einen sehr, sehr dicken akkordischen Klang, sodass man fast sagen könnte, sie seien gepanzert gegen die Räume, in denen sie stattfinden. Er hat sozusagen eine mobile, transportable Akustik geschaffen.[2]
Diese Kompositionsweise habe Gombert auf Reisen mit dem Hofstaat Karls V. entwickelt, um seine Musik gewissermassen gegen eine sich immer wieder ändernde, unberechenbare Akustik zu wappnen – je nachdem, ob sie in Kirchen, Palästen, Zelten oder auf Schiffen gespielt wurde.
Vergleichbares tut der Basler Komponist Beat Gysin – allerdings nicht, indem er seine Stücke so komponiert, dass sie überall gespielt werden können, sondern indem er auf die je spezifischen akustischen Gegebenheiten eines Raums eingeht. Komposition und Raum bilden also eine Einheit, beziehungsweise dasselbe Stück klingt je nach Raum immer wieder anders. Damit verleiht er der Musik, was ihr im Zeitalter der Musikkonserve abhanden gekommen ist: Flüchtigkeit. Umgekehrt experimentiert der Architekt Philippe Rahm mit dem stofflichen Aspekt der Musik und presst sie förmlich in eine architektonische Form. In diesem fünften Heft unserer Reihe zum Thema Akustik geht es denn auch unter anderem um den materiellen Aspekt der Musik und den immateriellen der Architektur.
Dr. Rahel Hartmann Schweizer
Anmerkungen:
[01] Michael Sennhauser, http://sennhausersfilmblog.ch/2012/01/04/fred-van-der-kooij-ueber-das-filmische/
[02] Fred van der Kooij im Gespräch mit Roland Wächter, DRS2, 25. 7. 2010, 16.03–18.00 Uhr
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Das Primat des Nutzens | Bodenständiger Bogen ums Dorf
10 MAGAZIN
Musikwerkstatt in Freiburg (D) | Umbau ZDF-Studio London (GB)
16 «DIE RÄUMLICHKEIT VON MUSIK: EIN LEBENSPROJEKT»
Rahel Hartmann Schweizer
Der Basler Komponist Beat Gysin lotet den Raum akustisch aus. Er passt die Räume der Musik oder die Musik den Räumen an.
21 «WIR GABEN DER MUSIK EINE PHYSIKALISCHE FORM»
Rahel Hartmann Schweizer
Der Architekt Philippe Rahm verkörperlicht die Musik und entmaterialisiert die Architektur.
27 SIA
Baukultur für Parlamentarier | Der Juryentscheid muss gelten! | Denkmal und Energie | Wert schaffen statt Claims managen | Konzepte für nachhaltige Sanierungen | A & K – Reisen und Exkursionen | Vernehmlassungen
33 FIRMEN | PRODUKTE
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
«Die Räumlichkeit von Musik: ein Lebensprojekt»
Während Architekten den Raum optisch ausleuchten, lotet der Basler Komponist Beat Gysin ihn akustisch aus. Unter dem Begriff «aurale Architektur» versammelt er Projekte, in denen er Raum, Musik und Szenografie verbindet. Er passt die Musik den Räumen oder die Räume der Musik an. Dabei spielt die Bewegung eine entscheidende Rolle: Im Konzert «Feigels Mosaik» 2012 bewegten sich die Interpreten, ebenso in der aktuellen Produktion «NUMEN». In einem unter dem Titel «Chronos» für 2015 geplanten Festival will Gysin auch das Publikum mobilisieren. Aber nicht nur dieses: Die Aufführungsstätte selber, konzeptionell als Karussell gedacht, soll sich bewegen. Von da ist der Weg nicht mehr weit zum veränderbaren Raum.
Wenn Beat Gysin «Wassermusik» macht, spielt er nicht auf die gleichnamige Komposition von Georg Friedrich Händel an – Gysin meint es wörtlich. 2001 hat er für diese Kunstform die Oper «Skamander» komponiert und im Hallenbad Rialto in Basel zur Aufführung gebracht. Dabei hat er zwei der Disziplinen, die er studiert hat – Musik und Chemie – in kunstvoller Weise miteinander verbunden: Experimente mit flüssigen Substanzen, speziell Wasserbewegungen, mit akustischen Analysen von Wirbelformationen. Als Naturwissenschafter interessiert ihn, wie sich Wasser bei der Schallübertragung von Luft unterscheidet.
Als Musiker setzt er die Stimme ein, um das Medium auszuloten. Die Stimme über das Wasser hörbar zu machen verweist darauf, dass die Stimmbänder in einem Feuchtbiotop liegen. Zusätzlich Perkussion einzusetzen darauf, dass sie beim Singen oder Sprechen aneinanderschlagen. Der Oper vorausgegangen war zwei Jahre davor eine Komposition, die er auf die Akustik eines stillgelegten Wasserreservoirs ausrichtete. In vollkommener Dunkelheit aufgeführt, provozierte es bei den Hörerinnen und Hörern wahre Feuerwerke von inneren Bildern. Heute sucht Gysin die Verbindung zwischen akustischem und visuellem Raum. Er entwirft Szenarien, in denen der Raum – vorgestellt als eine chemische Apparatur aus gläsernen Röhren, Kolben, Flaschen, durch die Wasser fliesst und Luft strömt, angereichert mit Farben und Gerüchen – gleichzeitig das Instrument ist. Das Projekt, ein dreidimensionales akustisches Happening, das ein Raumgefühl wie im Wald, im Dschungel oder in der Stadt, im Gewühl von Geräuschen und Ereignissen jedenfalls, vermitteln soll, liegt fertig durchdacht in der Schublade und wartet auf eine Veranstaltung ...
TEC21: Sie befassen sich seit Jahren mit raumakustischen Phänomenen, komponieren für den Raum, loten akustische Potenziale aus. Ihre Projekte drehen sich um die Beziehung zwischen der Musik, dem Raum und dem Publikum. Woher rührt diese Leidenschaft?
Beat Gysin: Nun, ich hatte einige zündende Erlebnisse: In jungen Jahren pflegte ich beim Velofahren innerlich zu komponieren. Dabei steigerte ich mich eines Tages so sehr in den Orchesterklang hinein, dass er sich aufblähte, bis er in meinem Kopf explodierte. Das Orchester wurde dreidimensional. Ich war so überwältigt, dass ich vom Velo absteigen musste. Denn die 3-D-Vorstellung konkurrierte die 3-D-Rezeption der Umwelt. Inzwischen kann ich dieses Erlebnis der räumlichen Musikimagination heraufbeschwören. Dann spielte ich in einem Schlagzeugensemble, das die Komposition «First Construction (in Metal)» von John Cage aus dem Jahr 1939 einstudierte. Als Aufführungsort schlug ich – nachdem ich ganz Basel abgeklappert hatte – eine Garage vor. Deren Betreiber bauten eine Kulisse aus verschrotteten Autos auf, sodass eine Verbindung zwischen der Raumatmosphäre und der Komposition entstand, die das Publikum begeisterte. Ich wurde also immer wieder mit dem Faszinosum der Beziehung zwischen Klang und Raum konfrontiert. Das hat mich grundsätzlich über dieses Verhältnis nachdenken lassen. Ein Ton lässt sich zwar allein mit den Parametern Frequenz, Dauer, Lautstärke (Amplitude) und Klangfarbe definieren – aber sobald wir als Individuen diesen Ton wahrnehmen, gibt es auch eine Räumlichkeit. Rein physikalisch ist die Räumlichkeit kein Parameter des Tons, aber sobald wir von Kunst reden, geht es um Wahrnehmung, und da gehört dieser fünfte Parameter dazu. Wenn man einmal mit dem Gedanken infiziert ist, kann man nicht mehr anders. Und für die kompositorische Forschung ist es ein offenes Feld; würde ich über Klangfarben forschen, wäre dort schon fast alles gemacht, auch über Dynamik gibt es nicht mehr viel Neues zu entdecken. Daher schätze ich mich glücklich, dass ich durch Zufall auf etwas gestossen bin, das auch im 21. Jahrhundert noch etwas Neues ist in der Musik. Das macht es spannend – so sehr, dass sich das nicht in einem Projekt umsetzen lässt. Die ganze Räumlichkeit von Musik ist für mich ein Lebensprojekt.
TEC21: Damit verbinden Sie wieder, was Johann Gottfried Herder einst geschieden hat: die Raum- und die Zeitkünste. Herder verstand Architektur, bildende Kunst etc. als Raumkünste, Musik dagegen als Zeitkunst. Was er dabei nicht thematisiert hat, ist, dass Musik, Zeitkunst also, hauptsächlich auf die Ohren bezogen ist, Raumkunst dagegen auf die Augen zentriert. Das verweist auf den potenziellen Konflikt zwischen Architekten und Akustikern.
Gysin: Wir werden ausgebildet mit dem Diktum, dass es in der Wissenschaft das Phänomen gibt und den Raum, in dem dieses Phänomen stattfindet. Objektiv gesehen stimmt das, aber, wenn ich Kunst mache, brauche ich den Hörer; und das subjektive Erleben trennt nicht zwischen Ereignis und Raum. Ereignis und Raum ist eine Einheit. Der akustische Raum ist ein Ereignisraum. Es braucht eine Aktivität, eine Bewegung, um einen Ton entstehen zu lassen, einen Windhauch oder ein Lebewesen, das sich rührt und die Luft in Schwingung versetzt. Man hört nicht die Violine, sondern die Violine, deren Saiten angeschlagen werden. Der visuelle Raum hingegen ist ein Daseinsraum, den gibt es immer. Ausserdem hört man in Klangräume hinein, aber sehen tut man immer nur die Oberfläche. Im Gespräch mit Architekten ist das schwierig zu erläutern.
TEC21: Und, wie stellen Sie es an, den Architekten diesen Unterschied nahezubringen?
Gysin: Das in architektonischer Hinsicht spannendste Projekt habe ich in einem stillgelegten Reservoir durchgeführt, das eine enorme Nachhallzeit hat, und zwar in totaler Dunkelheit: Das Publikum sah den Raum nie – weder vor noch nach der Aufführung. Wir geleiteten die Besucher an ihre Plätze, und für die Interpreten spannten wir ein Netz von Seilen und Fäden auf, damit sie sich orientieren konnten. Interessanterweise haben anschliessend alle von ihren visuellen Erlebnissen gesprochen und keiner hat von der Musik geredet. Ausgerechnet wenn Menschen nichts sehen, erleben sie visuell enorm viel. Nun wollten drei Architekten den Raum à tout prix vorher sehen. Sie insistierten so lange, bis wir nachgaben – nicht ohne sie zu warnen, dass sie sich das Erlebnis vermasseln würden. Denn es handelte sich um einen aus optischer Sicht grausigen Raum. Und so kam es denn auch: Die Enttäuschung stand den Architekten ins Gesicht geschrieben, und sie räumten ein: «Oh nein, waren wir dumm.» Wenn ich von Raum spreche, meine ich den gehörten Raum, der Architekt meint den gesehenen Raum. Dem Unterschied zwischen Hören und Sehen auf den Grund zu gehen – das wäre ein unglaubliches Forschungsprojekt: die hörende versus die sehende Wahrnehmung.
TEC21: An Forschungsprojekten herrscht bei Ihnen kein Mangel – allein wenn man sich Ihre aktuellsten Projekte anschaut: 2012 «Feigels Mosaik», 2013 «NUMEN», 2015 der drehbare Raum. Liest man deren Konzeptionen, gewinnt man denn auch den Eindruck einer durchkomponierten Forschungsanlage.
Gysin: Als ausgebildeter Chemiker bin ich auch noch Wissenschafter und denke sehr abstrakt, was für mich kein Widerspruch ist: Wasser besteht aus dreieckigen Molekülen, und das ist kein Widerspruch zu der wunderbaren Flüssigkeit, in der man badet. Ich mag es, Ideen zuerst einmal auf einer ganz abstrakten Ebene festzuzurren. Das hat etwas Kristallines, das sich verbinden und das wachsen kann und das eben auch Assoziationen generiert.
TEC21: Dabei stehen grundsätzlich zwei Forschungsanlagen im Vordergrund, oder?
Gysin: Ja. Auf der einen Schiene liegen Experimente, mit denen wir den vorhandenen Raum akustisch ausloten, auf der anderen Projekte, in denen wir ihn akustisch adaptieren – und zwar, indem wir entweder die Musiker/Sänger, das Publikum oder den Raum bewegen. Drei Ideen stehen dabei im Moment im Vordergrund: Die eine Idee ist, dass man Räume kompositorisch ausleuchtet. Die andere Idee ist, einen echten mit einem virtuellen Raum zu überlagern und die beiden Räume dann miteinander interagieren zu lassen, und die dritte Idee ist, Räume zu bauen.
TEC21: Mit der ersten Idee sprechen Sie auf das Projekt «NUMEN» an, nicht wahr? Mit diesem testen Sie den Raum akustisch aus, indem sie die Sängerinnen und Sänger, Musiker und Musikerinnen an verschiedenen Orten aufstellen. Ausserdem haben sie dafür verschiedene Kirchen gewählt, die wiederum je eigene akustische Qualitäten haben.
Gysin: Mit «NUMEN» möchten wir, das heisst die vier Komponisten Lukas Langlotz, Daniel Ott, Ludovic Thirvaudey und ich, verschiedene Kirchenräume kompositorisch ausleuchten. Wir haben fünf Kirchen ausgewählt: die Jesuitenkirche in Luzern, die Kathedrale in Lausanne, die Leonhardskirche in Basel, das Grossmünster in Zürich und das Münster in Bern. Musiker und Sängerinnen werden nicht gewohnheitsmässig vor dem Publikum stehen, sondern im Raum verteilt und teilweise sogar in Bewegung sein. Wir komponieren die Stücke von Anfang an so, dass sie sich je nach Kirchenraum verändern. Also, wenn jemand fünfmal ins Konzert geht, gewinnt er oder sie idealerweise den Eindruck, fünf verschiedene Kompositionen gehört zu haben. Es ist fast eine Art Forschungsprojekt, weil wir eruieren wollen, wie stark wir beim Komponieren auf den Raum eingehen können, und umgekehrt, wie sich der Raum auf die Komposition auswirkt. Hinzu kommt, dass in einem Kirchenraum mit seiner reichhaltigen szenografischen Kulisse ein solches Platzieren und Bewegen mehr ist als ein rein akustisches oder geometrisches Hinstellen. Es wird eine starke Wechselwirkung zwischen der Musik, der Akustik und dem szenografischen Raum stattfinden. Ziel ist es, das Publikum hörend auf eine Entdeckungsreise des Kirchenraums mitzunehmen.
TEC21: Das zweite Experiment, die Überlagerung verschiedener akustischer Räume haben Sie in «Feigels Mosaik» erprobt – einem äusserst intimen Musikerlebnis.
Gysin: In «Feigels Mosaik» haben wir den realen akustischen Raum mit einem virtuellen Raum überlagert, indem wir Teile der Komposition über Kopfhörer abspielten und die beiden Räume dann miteinander interagieren liessen.
TEC21: Die dritte Idee, die Sie angesprochen haben, verweist auf «Chronos», das Sie 2015 realisieren möchten. Dabei werden sich nicht die Musiker bewegen, sondern die Zuhörer – und zwar auf einer Art Karussell. Dieser drehbare Raum bildet ausserdem die Schnittstelle zum wandelbaren Raum, an dem Sie ebenfalls bereits tüfteln.
Gysin: Der wandelbare Raum, in dem wir akustisch-kompositorisch-räumliche Konzepte verwirklichen können, ist recht weit gediehen. Es bestehen bereits Modelle von Raumkonzeptionen, die ich unter dem Titel «Adyton» – zum Teil in Eigenregie, zum Teil in Zusammenarbeit mit Architekten – entwickelt habe. Die Umsetzung ist indes noch Zukunftsmusik. Konkretere Gestalt nimmt gegenwärtig der Karussell-Gedanke im Projekt «Chronos» an. Stellen Sie sich vor, das Publikum sitzt auf einem Karussell und dreht sich um eine Mitte, wo sich das Ensemble befindet. Nun gibt es folgende Szenarien: 1. Die Leute fahren um das Orchester herum. 2. Einzelne Instrumentalisten oder Sänger treten aus dieser Mitte hinaus auf das Karussell und fahren mit dem Publikum mit. 3. Leute aus dem Publikum verlassen das Karussell und bleiben nun stationär, wie die Musiker – nur ausserhalb des Karussells statt innerhalb. Und die andern Zuhörerinnen und Zuhörer fahren an ihnen vorbei. Wenn man vom Hörer aus denkt, dann hört er eigentlich drei Dinge; 1. jemanden, an dem er, der Hörer, quasi immer wieder vorbeikommt, 2. jemanden der im gleichen Teilraum ist wie er, sich aber in diesem Teilraum verschieben kann, und 3. jemanden, der immer gleich weit von ihm entfernt ist. Interessant daran ist, dass die Leute ganz verschiedene Hörperspektiven auf das Musikstück haben. Ich glaube, daraus resultiert eine andere Art von Musik. Die Zuschauer gehen im Idealfall in ganz verschiedene Welten hinein. Faszinierend wäre auch, das zum Beispiel mit einer Frauenstimme zu kombinieren, die ganz nah am Publikum vorbeikommen, jeweils für einen Moment kaum 20 cm hinter dem Ohr des einzelnen Zuhörers auftauchen und wieder weggehen würde. Wenn das noch dazu eine besonders schöne Stimme ist, wird sich ein intensiver Musikgenuss einstellen. Und dann ist vielleicht ganz in der Mitte ein einzelnes Instrument, eine Geige etwa, als konstantes Element, und ausserhalb der Drehscheibe befindet sich vielleicht noch ein Bläserklang, der wie von weit weg ins Ganze eindringt, usw. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man das kompositorisch umsetzen könnte.
TEC21: Als Zuschauer hört man die Musik also aus verschiedenen Perspektiven – von nah und von fern, sich nähernd und entfernend. Gibt es auch eine Bewegung in der Vertikalen, wie es das Karussell ja eigentlich beinhaltet?
Gysin: Daran denkt man natürlich auch … Und auch daran, dass jeder Stuhl um sich selbst drehbar sein sollte. Doch versuche ich die verschiedenen Ideen für sich zu behandeln. Jede einzelne davon hat ausreichend Spannung, sodass es gar nicht nötig ist, alles innerhalb einer Aufführungssituation umzusetzen.
TEC21: Wie muss man sich diese vorstellen?
Gysin: Geplant ist, «Chronos» im Rahmen eines zweitägigen Festivals aufzuführen – mit vier Ensembles und jeweils zwanzigminütigen Kompositionen. Es soll so sein, dass man in dieses Karussell nach Lust und Laune einsteigt und selber entscheidet, wann man wieder aussteigt, wie eben an einer Herbstmesse. Das finde ich passend. TEC21: Um die Vielfalt Ihrer Projekte auf ihre Prinzipien zu kondensieren: Sie stimmen die Musik auf den Raum ab – wie etwa bei «NUMEN» –, den Raum auf die Musik – bei Chronos (Karussell) und «Adyton» – oder kombinieren beides, wie bei «Feigels Mosaik». Einmal verändern Sie den architektonischen Raum nicht, wohl aber seine akustischen Implikationen. Das andere Mal greifen Sie auch in den architektonischen Raum ein, um die akustische Qualität zu beeinflussen. Dieses Potenzial wird mit dem Karussell nicht erschöpft sein, nicht wahr?
Gysin: Auf diesem Gebiet gibt es weitere Raumideen. Die Richtung, in die ich vorstossen möchte, lässt sich an einem berühmten Projekt illustrieren, das der in Österreich tätige Schweizer Komponist Beat Furrer 2005 an den Donaueschinger Musiktagen realisiert hat.
TEC21: Sie meinen das Projekt «Fama»1, in dem Furrer einen Raum konstruierte, den er wie ein riesiges Instrument bespielte?
Gysin: Der Raum bestand aus Drehtüren und einer Drehdecke. Eine Seite der Drehtüren war schallhart, die andere schallweich. Je nachdem, auf welcher Seite der Drehtüren man stand, befand man sich in einem halligen oder in einem akustisch «trockenen» Raum. Bedauerlicherweise schlugen die Veranstalter die Limitierung auf 60 Personen, wie sie die Akustiker errechnet hatten, in den Wind. Daher wurde die Schallabsorptionsfläche der Körper, Kleider etc. im Vergleich zur Fläche der Drehtüren so gross, dass man den Unterschied zwischen schallhartem und schallweichem Raum kaum mehr bemerkte, was die intendierte Wirkung beeinträchtigte. Trotzdem war es eine tolle Idee, und die Disziplinen Szenografie, Architektur und Bühnenbild sind so weit, solche Räume zu entwickeln, auch mit Robotertechnik, wie wir es mit dem «Adyton» vorhaben. Das wird auf unsere Hörgewohnheiten einwirken; es wird die Konzertrituale verändern, mit kleineren Gruppen, dafür mehrmaligen Aufführungen; es wird Komposition und Interpretation beeinflussen und mehr ums Intime gehen, weniger um den grossen Star auf der Bühne...TEC21, Fr., 2013.08.09
09. August 2013 Rahel Hartmann Schweizer
«Wir gaben der Musik eine physikalische Form»
Der Architekt Philippe Rahm interessiert sich weniger für die formalen Aspekte der Architektur als für ihre physiologischen. Er definiert die Qualität von Räumen nicht über ihre Volumetrie und Materialisierung, sondern indem er sie auflädt – elektromagnetisch, chemisch und akustisch. Mit seinen Projekten und Ausstellungen beflügelt er den Architekturdiskurs. Nun wird ein Projekt im grossen Massstab realisiert, das er zusammen mit der französischen Landschaftsarchitekin Catherine Mosbach entworfen hat: ein 68 Hektar grosser Park in Taiwan.
Ausgangspunkt von Rahms Annäherung an die Architektur waren seit je ihre unsichtbaren Aspekte. Die physiologische Komponente stand beim Projekt des «Melatonin Room» (2000) im Vordergrund (vgl. TEC21, 43/2004, S. 7–11), meteorologische bei dem 2002 für den Künstler Fabrice Hybert entworfenen Haus «Jardin d’Hybert», akustische bei dem 2009 projektierten temporären Konzertsaal «Portico Acoustique». In dem nun in Realisierung stehenden Projekt für den Taichung-Gateway-Park in Taiwan verbinden sich die drei Aspekte. Er wurde nach physiologischen, klimatischen und akustischen Kriterien konzipiert.
TEC21: In Ihren Vorträgen verweisen Sie auf den deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dessen Diktum, dass die Architektur an die Materialität gebunden ist, heben Sie aus den Angeln, indem Sie Räume entmaterialisieren und Klänge verkörperlichen.
Philippe Rahm: In seiner Kunsttheorie entwarf Hegel eine Hierarchie der Künste: Er betrachtete die Musik als die reinste und schönste aller Kunstformen – im Gegensatz zur Architektur, die er für die niedrigste der Künste hielt. Das Kriterium dieser hierarchischen Klassifizierung leitete er von der Beziehung der jeweiligen Kunst zu ihrer Materialität ab – angesiedelt zwischen Abhängigkeit und Freiheit. Für Hegel galt, dass je mehr eine Kunstform ihre Materialität hinter sich lässt, desto weniger ist sie durch die Phänomene der natürlichen Welt eingeschränkt, beziehungsweise desto mehr erhebt sie sich über und umso näher kommt sie dem reinen, gewichtslosen, transparenten Geist, und umso transzendenter und schöner ist sie. Architektur ist ihrer Materialität verhaftet – ihrer Dichte, Schwere, Undurchdringlichkeit. Das gilt für die Bildhauerei zwar auch, aber bei ihr ist die schöne Form entscheidend. Noch stärker – und zwar auf die Farbe – reduziert ist der materielle Aspekt bei der Malerei. Poesie und Musik sind dieser Materialität gänzlich entledigt. Musik ist nichts anderes als Wellen und Dichtung nichts anderes als Worte. Heute wissen wir, dass Klang und Stimme weder abstrakt noch entmaterialisiert sind, auch wenn sie ätherisch und unsichtbar sind. Sie sind nicht transzendenter als ein Stein oder die Erde, und sie besitzen eine physikalische, chemische und biologische Dimension. Die physikalische Dimension des Klangs ist eine handfeste Luftbewegung entlang einer spezifischen Wellenlänge. Er ist ein Druckpunkt in der Luft in einem definierten Raum. Er ist eine körperliche Temperatur von rund 37° C, die die Lungen in die Luft abgeben als Resultat der Atmung. Die chemische Dimension der Stimme besteht aus einem gasförmigen Inhalt, messbar über den Anteil an Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und einigen anderen, in Spuren vorhandenen Gasen sowie Wasser in Form von Dampf, mit dem die Atmosphäre mit jedem einzelnen Atemzug angereichert wird. Musik und Dichtung haben ausserdem eine biologische Dimension, bestehend aus Pollen, Mikroorganismen, Samen, die in der Luft schweben, Bakterien und Viren.
TEC21: Etwas grösser sind die Organismen – Käfer und Nachtfalter – in dem Traum, den der Komponist György Sándor Ligeti (1923–2006) als Inspirationsquelle für seine Werke nannte.1 Weltweit bekannt wurde er, als Kompositionen von ihm als Filmmusik in «2001 – A Space Odyssee» von Stanley Kubrick verwendet worden waren – unter anderem als Ouvertüre eine knapp dreiminütige Sequenz aus «Atmosphères» von 1961.2 In ihm haben Sie den kongenialen Komponisten zu Ihrer Vorstellung von Raum und Musik gefunden, nicht wahr?
Rahm: Ja, die Komposition «Atmosphères» für Orchester war für uns von besonderem Interesse. Ligeti hat die Musik als ein In-Schwingung-Versetzen und Deformieren der Luft und als eine Art Vibration des Raums verstanden, was physikalisch ja zutrifft. In gewisser Weise hat das eine Beziehung zur Architektur, weil man mit dem Bauen auch die Luft skulpturiert: Man macht hier ein bisschen wärmer, dort ein bisschen kälter. Man skulpturiert das Klima.
TEC21: Ligeti legt diese Analogie umso näher, als er sein Stück als Klangwolken beschrieb …
Rahm: … die sich in der Partitur als Cluster, als Trauben von Noten, abbildeten. Eine solche Gestalt wollten auch wir der Musik geben, wobei wir mit der Physik an sich arbeiten und die Deformation der Luft erfassen wollten. Konkretisiert hat sich dies im Projekt «Pulmonary Space», das wir im Sommer 2009 auf Einladung des Barbican Museum in London in der von Francesco Manacorda kuratierten Ausstellung «Radical Nature» realisierten: Wir gingen davon aus, dass Musik nichts Abstraktes, Entmaterialisiertes ist, sondern dass sie sich in physikalischer Realität – Schwingungen, Wellen, Luftbewegungen – manifestiert. Musik ist also eine Physik der Luft – und es spielen bei ihr auch physiologische Qualitäten mit, wenn man an die Organismen denkt, welche die Atmosphäre bevölkern. Wir liessen also Ligetis 1968 komponiertes Kammermusikstück «Zehn Stücke für Bläserquintett» aufführen. Dazu steckten wir alle Instrumente in luftdichte Verpackungen und liessen diese in einen grossen Kunststoffsack münden. Während des Spiels bliesen die Musiker mit ihrem Atem durch die Instrumente den Sack auf, der im Laufe des Stücks eine gewisse Form und Grösse annahm. Wir konservierten die Musik also in diesem aufgeblasenen Sack gewissermassen. Durch dieses Konservieren fällt die Musik auf das materielle Niveau, sie wird re-materialisiert – durch das Volumen der gespeicherten Luft, durch die darin enthaltenen Viren und Bakterien, ihre Feuchtigkeit etc. Wir gaben der Musik eine physikalische Form, entrissen sie der Vergänglichkeit …
TEC21: … verliehen ihr eine räumliche Qualität – so wie sie umgekehrt der Architektur durch Eingriffe in die Physiologie eine zeitliche Dimension gaben: die Musik als Raumkunst, die Architektur als Zeitkunst. In beiden Fällen gingen Sie von der Naturwissenschaft aus, um die Architektur zu entkörperlichen beziehungsweise die Musik zu verleiblichen.
Rahm: Löchert man aber am Schluss den Sack, entweicht die konservierte Musik wieder.
TEC21: Ob der Sack seine Form verändert hätte, wenn ein anderes Stück intoniert worden wäre? Spielt es eine Rolle, ob tonlos in einen Sack gepustet oder Klänge durch die Schläuche gepresst werden? Das heisst: Verkörpert der Sack zumindest mittelbar ein Klangbild?
Rahm: Vielleicht, das haben wir noch nicht überlegt.
TEC21: Im selben Jahr haben Sie sich mit der Verkörperung akustischer Voraussetzungen befasst, im Projekt «Portico Acoustique», einem temporären Konzertsaal im südfranzösischen Brive-la-Gaillarde, der während der Renovation des Théâtre municipal als Ersatzspielstätte hätte dienen sollen. Aus finanziellen Gründen wurde er nicht realisiert.
Rahm: Hier war die Idee, die Qualität des Innenraums nach aussen zu projizieren, das heisst, um den Inhalt lesbar zu machen, haben wir ihn nach aussen gestülpt – und zwar nicht auf der visuellen, sondern auf der auditiven Ebene. Das heisst, die Akustik sollte vor dem Eingang des Gebäudes ebenso gut sein wie im Innern. Formal übertrugen wir das Prinzip, das die Akustiker für den Innenraum empfahlen – parallele Wände zu vermeiden –, auf die Gestaltung der Gebäudehülle. Vor dem Eingang des Theaters verlaufen zwei Strassen, deren Lärm an den Fassaden reflektiert wird und zu unangenehmen, sich aufschaukelnden Echos führt. Wir haben die Positionen und Formen aller Gebäude in der Umgebung des Theaters analysiert und die Richtungen der stärksten Reflexionen des Strassenlärms in Richtung des Theaters bestimmt. Wir haben also die Akustik des Aussenraums gleich behandelt wie die Akustik des Innenraums und schliesslich auf drei Ebenen interveniert: Reflexion, Isolation und Absorption. Um die Reflexionen des Strassenlärms zu reduzieren, haben wir die Fassaden so deformiert, dass die tiefen Frequenzen reflektiert und gestreut werden. Damit der Strassenlärm nicht ins Innere und die Musik im Saal nicht nach draussen dringt, haben wir gegen die hohen und mittleren Frequenzen eine Isolation aus Steinwolle vorgesehen. Mit diesen Massnahmen versuchen wir, einen Dämpfungsgrad von 60 db zu erreichen. Aussen planten wir dieselbe schallschluckende Leinwand aus poröser Mineralwolle wie im Innern. Um eine möglichst grosse Absorptionsfläche zu erzielen sowie die Distanz zwischen Leinwand und Isolation zu variieren, sollte sie eine komplexe Oberflächenstruktur bekommen – eine, die der Wellenlänge des Schalls entspricht, der absorbiert werden soll. Diese hätte sich auch an der Fassade abgebildet und gleichermassen funktional dämpfend gewirkt wie formal die Identität des Baus signalisiert.
TEC21: In Ihrem jüngsten Projekt, dem Taichung-Gateway-Park in Taiwan1, übertragen Sie die physiologischen Konzepte Ihrer Installationen wie des «Hormonoriums» auf den grossen Massstab.
Rahm: Das könnte man so sagen. Beim Taichung-Gateway-Park, den wir zusammen mit Catherine Mosbach und Ricky Liu planen, sind wir von der Funktion des Parks ausgegangen, wie sie der französische Stadtplaner Georges-Eugène Baron Haussmann verstand, der im 19. Jahrhundert die grossen Alleen und Parks in Paris anlegte: unter utilitaristischem Blickwinkel. Ein Baum war eine Maschine, um Schatten zu erzeugen – und nicht ein Symbol der Natur, wie es romantische Vorstellungen transportierten. Auch der Central Park in New York hat primär eine utilitaristische Funktion: die Reinigung und Erneuerung der Luft. Das ist eine rein physiologische, hygienistische Betrachtungsweise der «Natur», die man seit den 1960er-Jahren aus den Augen verloren hat. Man fasste die städtischen Parks nicht mehr – fast wie ein Antibiotikum – als Medizin auf, um die Städte und ihre Bewohner zu «heilen». Wir verstehen einen Park in den Breitengraden von Taiwan primär als Klimaanlage und betrachten alle Elemente eines Parks des 19. Jahrhunderts – Kiosk, Springbrunnen, Eremitage, Grotte etc. – unter dem Gesichtspunkt der Klimatisierung und haben sie als «climatic devices» adaptiert. Die Hauptparameter des taiwanesischen Klimas sind hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Luftverschmutzung und hoher Lärmpegel. Wir haben drei Karten des Parks mit den relevanten vier Parametern erstellt: je eine gegen die Hitze, gegen die hohe Luftfeuchtigkeit und gegen die Luft- und Lärmverschmutzung. Als «climatic devices» fungieren zunächst die Bäume: Sie leisten den Hauptanteil von drei Vierteln der Klimaregulierung. Sie spenden Schatten, kühlen die Luft durch Verdunstung, absorbieren Wasserdampf aus der Luft, filtern Schadstoffe aus der Luft und dämpfen den Lärm aus der Umgebung. Die technischen Installationen – grosse Ventilatoren, Lufttrockner und Springbrunnen – tragen zu einem Viertel zur Klimaregulierung des Parks bei, wobei die Energie für den Betrieb der Apparate im Park selbst u. a. mit Photovoltaik gewonnen wird. Dann haben wir uns die natürliche Temperaturverteilung zunutze gemacht. Es gibt kühlere Luftströmungen von ausserhalb des Parks, die wir zuführen und für die gezielte Kühlung ausgewählter Bereiche mit «climatic devices», z. B. Windtürmen, unterstützen. Die Luftfeuchtigkeit im Bereich der Seen sollen Entfeuchtungsaggregate oder wasserabsorbierende Materialien reduzieren. Zur Eindämmung der Luftverschmutzung agieren etwa photokatalytische Systeme, aber auch Pflanzen, die bestimmte Schadstoffe absorbieren.
Gegen die Verschmutzung durch Lärm planen wir neben konventionellen Mitteln, wie Akustikwänden und -platten, den Einsatz von Schallgeneratoren, die die störenden Frequenzen durch Interferenz mit Gegenfrequenzen auslöschen.TEC21, Di., 2013.08.06
06. August 2013 Rahel Hartmann Schweizer