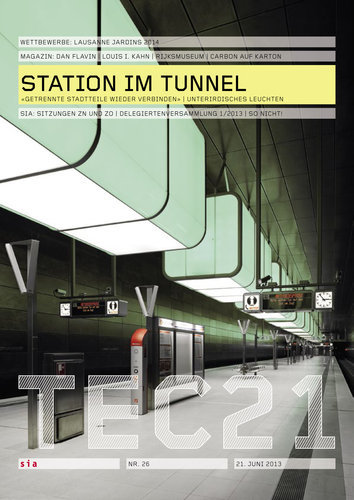Editorial
Naturgefahren wie Hochwasser, Lawinen, Bergstürze oder Hangrutschungen bedrohen seit Jahrhunderten Teile der Schweizer Bevölkerung. Bis in die Neuzeit erduldeten die Menschen diese Naturereignisse passiv und machten übernatürliche Mächte dafür verantwortlich. Man kannte meist nur lokale, wenig wirksame bauliche Abwehrmassnahmen, zur Alarmierung dienten Kirchenglocken. Die Entwicklung des Ingenieurwesens im 19. Jahrhundert ermöglichte erstmals wirksame Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren. In jahrzehntelanger Arbeit sind unzählige Bauwerke und Verkehrswege geschützt und immense Schäden verhindert worden. Im 21. Jahrhundert wird nun die bisherige reine Gefahrenabwehr durch eine Risikokultur abgelöst.
Die höchsten Risiken bestehen in Städten mit hoher Bevölkerungs- und Sachwertdichte und mit stark beanspruchten Infrastrukturen. Aktuelle Modellrechnungen für Zürich zeigen dies exemplarisch: Schon bei geringfügiger Überflutung ist wegen der hohen Wertekonzentration mit gewaltigen Schäden zu rechnen, was die Stadt zum nationalen Klumpenrisiko macht («Wie viel ein Hochwasser in Zürich kostet»). Diese Erkenntnis kann sich in den nächsten Jahren in lokalen Objektschutzmassnahmen, aber auch in höheren Versicherungssummen niederschlagen.
Ein hundertprozentiger baulicher Schutz vor Naturgefahren ist unrealistisch. Entscheidend ist deshalb eine rechtzeitige Warnung. Das setzt voraus, dass kritische Vorgänge, die zu Naturereignissen führen können, frühzeitig erkannt werden. Früher basierten die Gefahreneinschätzungen auf Beobachtung, Erfahrung und Intuition.
Erst die Einführung technischer Hilfsmittel zur Überwachung ermöglichte ausreichende Vorwarnzeiten. Heute stehen Sensoren zur Verfügung, die Veränderungen kritischer Parameter als Vorboten von Naturereignissen erkennen, bevor den Menschen etwas auffällt, und die heutigen Kommunikationsmittel ermöglichen eine Alarmierung über grosse Distanzen («Elektronisch warnen»).
Im Gegensatz zu den relativ gut bekannten und auch modellierbaren Verhältnissen bei Hochwasser und Überschwemmungen sind die kritischen Parameter für die Auslösung von Hangrutschungen heute noch nicht vollständig erforscht. Für diese bedeutende Naturgefahr gibt es daher noch keine exakten Modelle und Prognosen, obwohl sie von grosser Bedeutung für die langfristige Sicherheit unserer Siedlungen und Infrastrukturen wären. Ein Schwerpunkt der aktuellen geotechnischen Forschung sind die Beziehungen zwischen Klimaveränderungen und der Gefährdung durch Rutschungen von instabilen Hängen («Warum Hänge rutschen»). Hoffentlich können die daraus gewonnenen Erkenntnisse rechtzeitig in die Praxis umgesetzt werden – wie es beim Umgang mit Hochwasser bereits der Fall ist.
Claudia Carle, Aldo Rota
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Haus am Turm in Lenzburg
10 MAGAZIN
Über sieben Brücken | Kurzmeldungen | Leitbild Zürichsee 2050
16 ELEKTRONISCH WARNEN
Martina Sättele, Lorenz Meier
Ein Überblick über die verschiedenen elektronischen Warnsysteme und ihre Funktionsweise zeigt, wo welches System am besten eingesetzt werden kann.
20 WIEVIEL EIN HOCHWASSER IN ZÜRISCH KOSTET
Bernhard Kuhn, Dörte Aller, Jérôme Wider, Martin Detert
Das Hochwasserrisiko für die Stadt Zürich wurde lange unterschätzt. Eine Risikoanalyse ermittelte nun Ausmass und Verteilung möglicher Schäden.
23 WARUM HÄNGE RUTSCHEN
Christian Bommer, Hansruedi Schneider
Geotechniker an der Hochschule Rapperswil entwickeln physikalische Modelle, die aufzeigen, wie Rutschungen in instabilen Hängen durch Niederschläge ausgelöst werden.
27 SIA
Baugesuch: Achtung Naturgefahren! | Vernehmlassung Norm SIA 416/1 | Vernehmlassung Merkblatt SIA 2047 | Vernehmlassung NDP zu Eurocodes | Neue Vizepräsidenten SIA | SIA-Form Fort- und Weiterbildung | Entwicklung mit Bestand
33 PRODUKTE | FIRMEN
Geze | Gilgen Door Systems | Allega
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Elektronisch warnen
In den letzten Jahren haben elektronische Warnsysteme zur Reduktion der Risiken durch Naturgefahren beigetragen. Sie sind kostengünstiger und schneller realisierbar als bauliche Massnahmen wie Steinschlagnetze, Dämme und Galerien; zudem erfordern sie geringere Eingriffe in die Landschaft.[1] Wo welche Bauart am besten eingesetzt werden kann, zeigt der folgende Überblick über die verschiedenen Systeme und ihre Funktionsweisen, der im Rahmen einer Dissertation am Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos erarbeitet wurde.[2]
Warnsysteme liefern vor einem Schadenereignis Warninformationen und ermöglichen dadurch, das potenzielle Schadenausmass zu minimieren.[3] Dabei sollen lokale Systeme dafür sorgen, dass sich keine Personen, Tiere oder mobilen Objekte im Gefahrenbereich aufhalten. Das erste automatische Warnsystem in der Schweiz war die im Jahr 1937 von der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn (BLS) installierte Lawinenmeldeanlage Mahnkinn an der Lötschberg-Südrampe im Kanton Wallis (Abb. 01). Heute sind zahlreiche Systeme zur lokalen Warnung vor Murgängen, Steinschlag und Bergstürzen, Schneelawinen und spontanen Flutwellen aus Gletscherseen in Betrieb. Moderne Warnsysteme bestehen aus drei technischen Hauptelementen – Monitoring, Dateninterpretation und Ausgabe der Warninformation –, sie beziehen aber auch menschliche Entscheidungen ein. Trotz ihrer Vielfältigkeit lassen sich die derzeit eingesetzten Systeme zwei Typen zuordnen, nämlich Grenzwert- und Analysesystemen (Abb. 04). Beide Typen besitzen ein jeweils charakteristisches Systemdesign, das durch die Wahl der Monitoringparameter vorgegeben ist. Oft sind beide Typen in einer Anlage kombiniert.
In diesem Artikel werden charakteristische Systemkomponenten und aktuelle Technologien für beide Typen mit ihren Einsatzmöglichkeiten und Vor- und Nachteilen erläutert. In einem zweiten Schritt entwickeln die Autoren derzeit eine Methode zur Bewertung der Zuverlässigkeit dieser Warnsysteme, damit sie sich mit altbewährten Massnahmen wie Schutznetzen und Dämmen vergleichen lassen und als Standardmassnahme in das Integrale Risikomanagementkonzept des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) eingebunden werden können.
Monitoring
Die Monitoringeinheit von Warnsystemen besteht aus mehreren gleich- oder verschiedenartigen Sensoren. Die Sensoren erfassen spezifische Parameter der Natur und übersetzen sie in elektronische Signale, die die Grundlage für einen späteren Warnentscheid bilden.
In entlegenen Gebieten ist die Energieversorgung oft nur mit grösserem Aufwand sicherzustellen, daher werden hier bevorzugt autarke und wartungsarme Energiequellen wie Solarzellen oder Batterien eingesetzt. Die Stromversorgungseinheit, der Datenlogger und die Sensoren sind im Feld meist über Kabel verbunden. In seltenen Fällen kommunizieren die Sensoren und der Logger über Funk (Abb. 04).
Analyse- und Grenzwertsysteme unterscheiden sich in der Art der Sensoren in der Monitoringeinheit und folglich in der Wahl der Parameter, die überwacht werden. Sensoren von Analysesystemen registrieren indirekte Veränderungen in der Umgebung vor dem Ereignis und zugehörige Prozesse, die das eigentliche Ereignis einleiten – etwa das langsame, kontinuierliche Öffnen einer Kluft im Berg, bevor es zu einem Felssturz kommt (Abb. 02). Sensoren von Grenzwertsystemen erfassen direkte dynamische Parameter, die durch den Prozess selbst erzeugt werden und nur während eines Ereignisses auftreten, bei einem Murgang etwa die ansteigenden Pegelhöhen im Gerinne und die Erschütterungen im Boden.
Je nach Naturgefahrenprozess können verschiedene Parameter überwacht werden (Abb. 05). Neben direkten und indirekten Monitoringparametern gibt es solche, die sowohl die Funktion eines direkten als auch eines indirekten Parameters übernehmen können.
Die Überwachung des Seepegels in einem Gletschersee ist beispielsweise ein indirekter Parameter und Input für ein Analysesystem, das das verfügbare Wasservolumen einer Flutwelle ermittelt. Kommt es durch das Ausbrechen einer Flutwelle plötzlich zu einem Absinken des Pegels, ist der Seepegel ein direkter Monitoringparameter, und das System mutiert zu einem Grenzwertsystem (Abb. 03). Da sich mit dem Zustand des Parameters auch die Systemklasse ändert, ist der Übergang zwischen den Systemtypen oft fliessend.
Dateninterpretation
Der Datenlogger bildet die Schnittstelle der Bereiche Monitoring und Dateninterpretation. Er steuert die Sensoren, liest die von ihnen erfassten Daten aus und dient ausserdem als Zwischenspeicher und Interpretationstool für diese Daten, initiiert deren Übertragung oder die Ausgabe von Warninformationen. Im Bereich Dateninterpretation unterscheiden sich die Komponenten von Grenzwert- und Analysesystemen deutlich.
Grenzwertsysteme müssen die Warnung schnell und zuverlässig übermitteln, denn die Sensoren erfassen Parameter, die sich durch das stattfindende Ereignis verändern. Die Überschreitung von Grenzwerten, die im Datenlogger vor Ort gespeichert sind, löst automatisch eine Warnung aus. Je nachdem, wie schnell der Naturgefahrenprozess verläuft und wie weit entfernt sich die gefährdeten Objekte befinden, liegt die Warnzeit typischerweise zwischen Sekunden und Stunden.
Bei Analysesystemen hingegen können die Daten zusätzlich von einem Experten beurteilt werden, da das Messen von Parametern vor dem Ereignis ausreichend Warnzeit bietet. Die Warnung wird daher erst auf dem Datenserver im Büro der Experten generiert, z. B. durch die automatische Interpretation von Webcambildern oder die Analyse der Messdaten von mehreren Niederschlagsstationen in einem Gebiet. Der Server gibt die Warnung an die zuständigen Experten in unterschiedlichen Gefahrenstufen (z. B. Vorwarnung, Hauptwarnung, Alarm) aus, die er anhand vorgegebener Grenzwerte berechnet. Die Experten führen dann detaillierte Analysen der verfügbaren Messdaten durch und bewerten diese mithilfe von Modellen. Bei Bedarf definieren sie indirekte Parameter neu als direkte Parameter und verkürzen die Messintervalle.
Unabhängig vom Systemtyp werden die Messdaten auf einem Server gespeichert und von Kontrollsystemen analysiert. Diese überwachen die Sensoren und andere Systemkomponenten und geben zusätzlich Warnungen aus, falls Komponenten nicht funktionieren oder Daten nicht plausibel sind.
Die Übertragung erfolgt über kurze Distanzen häufig per Kabel. Damit sie zuverlässig funktionieren und weniger schadenanfällig sind, werden die Kabel durch zusätzliche Massnahmen (Zäune, Rohre etc.) geschützt. Zur Überbrückung grösserer Distanzen können Informationen auf Sicht über Funk versendet werden. Internet und Mobilfunknetze von privaten Anbietern haben heute eine gute Netzabdeckung, sind aber häufig mit Verzögerungen behaftet. Sofern sie ohne Redundanz genutzt werden, sollten diese Kanäle nur zur Informationsübermittlung innerhalb der weniger zeitkritischen Analysesysteme zum Einsatz kommen.
Informationsausgabe
Die Ausgabe der Warninformation unterscheidet sich bei Analyse- und Grenzwertsystemen grundlegend. Bei Analysesystemen werden die Massnahmen durch die Experten initiiert. Meist gehen diese anhand eines vorher festgelegten Schemas vor, das genau vorgibt, wann welche Massnahmen (z. B. Evakuierung, Aufgebot von Einsatzkräften) zu ergreifen sind. Bei Grenzwertsystemen wird die Warninformation automatisch ausgegeben. Die kurze Warnzeit erfordert eine schnelle Implementierung; hierfür werden beispielsweise optische oder akustische Signale ausgelöst. Im Schienenverkehr wird gegebenenfalls ein Streckenabschnitt gesperrt.
Einsatzmöglichkeiten
Analysesysteme werden eingesetzt, wenn sich im Zusammenhang mit dem Naturgefahrenprozess über eine längere Zeit eindeutige Indikatoren beobachten lassen. Sie haben sich als effiziente Massnahmen zur Überwachung von kontinuierlichen Felsbewegungen erwiesen. Bei grösseren Felsinstabilitäten kommt es vor dem eigentlichen Ereignis meist zu einer beschleunigten Bewegung der Felspartien, aus der sich der Absturzzeitpunkt ermitteln lässt. Die erhöhte Warnzeit erlaubt den Experten, die Situation ausführlich zu analysieren und gezielte Massnahmen einzuleiten.
Grenzwertsysteme kommen für die Detektion spontaner Prozesse zum Einsatz, die nur während des bereits stattfindenden Ereignisses eindeutige Parameter liefern. Sie bieten dadurch eine kurze Warnzeit, funktionieren aber autonom und generieren eine minimale Anzahl an Fehlalarmen. Sie werden hauptsächlich zur Sperrung von Strassen oder Gleisen an Lawinenzügen, Wildbächen oder an eindeutigen Felsinstabilitäten installiert und warnen Personen auf Baustellen, Strassen und Gleisen vor Steinschlag.
Zwittersysteme überwachen sowohl indirekte als auch direkte Monitoringparameter von meist spontanen Prozessen wie Murgängen oder Ausbrüchen aus Gletscherseen. Überschreitet eine indirekte Veränderung den Grenzwert, erreicht die zuständigen Experten wie bei den Analysesystemen eine Warnung. Eine Grenzwertüberschreitung von direkten Prozessparametern leitet wie bei einem Grenzwertsystem automatische Massnahmen ein. Zwittersysteme verlängern die Vorwarnzeit von spontanen Ereignissen und verringern Fehlalarme. Andererseits werden Zwittersysteme auch bei kontinuierlichen Prozessen eingesetzt, damit bei unerwarteten spontanen Ereignissen trotzdem eine schnelle Reaktion möglich ist.
Neben der Bestimmung der Monitoringparameter und der daraus resultierenden Warnzeit spielen bei der Wahl des richtigen Systemtyps auch andere Faktoren eine entscheidende Rolle. So müssen räumliche Gegebenheiten, Zugänglichkeit des Geländes, die Erreichbarkeit der gefährdeten Personen, Vorwarnzeiten, das mögliche Schadenausmass und auch der vertretbare finanzielle Aufwand in die Planung mit einbezogen werden.
Anmerkungen:
[01] D. Hattenberger, A. Wöllik, «Naturgefahren – Mess- und Frühwarnsysteme: Einzelne rechtliche Aspekte» in: Baurechtliche Blätter: bbl 11 (3), Springer-Verlag 2008, S. 89–101
[02] Die Autoren bedanken sich beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS für die finanzielle undbei Dr. Michael Bründl vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF sowie Prof. Dr. Daniel Straub von der Engineering Risk Analysis Group der Technischen Universität München für die fachliche Unterstützung.
[03] R. Schmidt, Warnsysteme in Wildbacheinzugsgebieten. Dissertation am Institut für Alpine Naturgefahren und Forstliches Ingenieurwesen, Universität für Bodenkultur, Wien 2002.TEC21, Fr., 2013.07.26
26. Juli 2013 Martina Sättele, Lorenz Meier
Wie viel ein Hochwasser in Zürich kostet
Das von der Sihl ausgehende Hochwasserrisiko für die Stadt Zürich wurde lange unterschätzt. Mit einer Risikoanalyse liess die Stadt nun Ausmass und Verteilung möglicher Schäden durch ein solches Ereignis ermitteln, um darauf aufbauend Schutzmassnahmen planen zu können. Die Analyse zeigte, dass Durchschnittswerte für Sachwerte und Schadenempfindlichkeiten ortsspezifisch angepasst werden müssen und dass die Stadt Zürich innerhalb der Schweiz ein unverhältnismässig grosses Klumpenrisiko darstellt.
In den letzten 20 Jahren gab es in der Schweiz eine Häufung von Hochwasserereignissen, bei denen die Stadt Zürich teilweise nur knapp grösseren Schäden entging. Dies veranlasste den Kanton, sich besser gegen derartige Ereignisse zu wappnen (vgl. TEC21 17-18/2011). Bevor jedoch Schutzziele und -massnahmen definiert und sinnvoll priorisiert werden können, müssen die Risiken bekannt sein. Im Februar 2009 beauftragte die kantonale Baudirektion die Stadt Zürich daher mit der Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser (Abb. 02). Die Gefahrenkarte zeigt zwar die Hochwassergefährdung eines Gebiets, spiegelt jedoch nicht das effektive Schadenrisiko wieder, da die gefährdeten Sachwerte nicht in die Gefahrenbeurteilung einfliessen. Daher wurde eine Risikoanalyse für ein Hochwasser der Sihl durchgeführt, die das grösste Hochwasserrisiko für die Stadt birgt. Sie dient als Grundlage für alle weiteren Massnahmen (Abb. 01).
Kalibrierung im Testgebiet Giesshübel
Für die Risikoanalyse verwendete die Stadt Zürich das vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) entwickelte Berechnungsinstrument EconoMe 2.1. Es berechnet die Risiken über schweizweit einheitliche Basiswerte (Sachwerte und Schadenempfindlichkeiten von einzelnen Objekttypen). Da diese Basiswerte schweizerischen Durchschnittswerten entsprechen, unterschätzt EconoMe in der Standardkonfiguration das Schadenpotenzial und die Schadenempfindlichkeiten für die innerstädtischen Gebiete Zürichs deutlich.
Für eine realitätsnahe Risikoberechnung passte die beauftragte Firma Geotest AG die Basiswerte daher an die Strukturen der Zürcher Innenstadt an: Anhand detaillierter hydraulischer Berechnungen (vgl. Kasten S. 22), Erhebungen mit den Gebäudeeigentümern und Expertenschätzungen kalibrierte sie die Werte im Quartier Giesshübel als repräsentativem Testgebiet. Für ein 300- und ein 500-jährliches Ereignis (HQ300 und HQ500) wurden rund 100 Objekte im Detail untersucht. Neben den Gebäudeschäden durch oberflächig eindringendes Wasser erhob die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) dort, wo die Eigentümer entsprechende Auskünfte gaben, auch die bedeutenden Mobiliarschäden.
Der Vergleich zwischen der Modellberechnung und der Expertenschätzung im Testgebiet Giesshübel zeigt, dass das Berechnungsinstrument EconoMe das Schadenausmass für ein 300-jährliches Hochwasserereignis im Pilotgebiet massiv unterschätzt (Abb. 03), da es Schäden in den Untergeschossen nicht berücksichtigt. In den Erhebungen durch die Experten der GVZ stellte sich jedoch heraus, dass bei einem Hochwasser in praktisch alle Gebäude im Pilotgebiet Wasser eindringen kann, da die Gebäudeöffnungen grösstenteils bodeneben sind. Aufgrund der vielen Untergeschosse, der intensiven Nutzung und des hohen Ausbaustandards ist auch bei geringen Überflutungshöhen mit grossen Schäden zu rechnen.
Bei einem Extremhochwasser EHQ – hier gleichgesetzt mit einem 500-jährlichen Ereignis – stimmen Modellberechnung und Expertenschätzung hingegen besser überein, da die Schäden in den Untergeschossen vom Anteil her weniger ins Gewicht fallen. Ausgehend von diesem Modellvergleich wurden die Standardwerte von EconoMe angepasst, um eine möglichst gute Annäherung an die Ergebnisse der Expertenschätzungen zu erreichen.
Extrapolation auf das gesamte Überflutungsgebiet der Sihl
Insgesamt stehen in Zürich über 3000 Gebäude im potenziellen Überflutungsgebiet der Sihl. Zur Berechnung des gesamtstädtischen Risikos eines Sihlhochwassers wurden die betroffenen Objekte für die Szenarien HQ300 und HQ500 nach der berechneten Ereignisintensität (Überflutungstiefen und Fliessgeschwindigkeiten) klassiert und mit den kalibrierten Schadenempfindlichkeiten verknüpft.
Eine flächendeckende Abklärung am Einzelobjekt der betroffenen Sachwerte (Schienenverkehr, Leitungen, Gebäude und Mobiliar) hätte den Zeit- und Kostenrahmen der Studie gesprengt. Deshalb wurden hier lediglich die Objekte mit einem herausragend hohen Risiko (Sonderrisiko-Objekte) – sei es durch ihren hohen Sachwert oder durch ihre Funktion – als Einzelobjekte vertieft untersucht. Für die restlichen Objekte wurden die Standardwerte aus EconoMe verwendet, jedoch mit angepassten Schadenempfindlichkeiten aus dem Testgebiet. Die abgeschätzten Werte sind mehrheitlich Minimalwerte, weil davon auszugehen ist, dass viele Gebäude sehr hohe Mobiliarwerte in den Erd- und Untergeschossen aufweisen und diese zudem sehr empfindlich sein können (z. B. Serverräume). Neben den grossen Sachschäden ist aufgrund der kurzen Vorwarnzeit von rund zwei Stunden, der hohen Arbeitsplatzdichte, der vielen Besucher und der grossen Wohnbevölkerung in Kombination mit Fehlverhalten (z. B. Retten von Waren aus dem Keller) auch mit Personenschäden zu rechnen. Auf eine Quantifizierung des individuellen und des kollektiven Personenrisikos wurde aber verzichtet.
Resultat Risikoanalyse
Die Extrapolation über das betroffene Gesamtgebiet zeigte das Ausmass des Risikos durch ein Sihlhochwasser in der Stadt Zürich: Im Fall eines 100- bis 300-jährlichen Ereignisses ist mit Sachschäden in der Höhe von 1.56 Mrd. Fr. zu rechnen, während die Schadenssumme bei einem 500-jährlichen Ereignis sogar 5.68 Mrd. Fr. beträgt. Der grosse Anstieg des Risikos zwischen den Wiederkehrperioden beruht hauptsächlich darauf, dass bei einem 500- jährlichen Ereignis ein wesentlich grösseres Gebiet vom Hochwasser betroffen ist. Aus dem ermittelten Schadenausmass für die jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit kann das jährliche Risiko berechnet werden. Dieses beläuft sich für die Stadt Zürich auf rund 16.5 Mio. Fr.
Der Vergleich mit dem gesamtschweizerischen Hochwasserrisiko verdeutlicht die unverhältnismässig grosse Risikokonzentration auf dem Gebiet der Stadt Zürich: Gemäss Überschwemmungsmodell der SwissRe muss in der Schweiz alle 100 Jahre mit Schäden in der Höhe von rund 4.4 Mrd. Fr. gerechnet werden. Das Stadtzürcher Hochwasserrisiko von 1.56 Mrd. Fr. für 100- bis 300-jährliche Ereignisse stellt in der Risikolandschaft Schweiz also ein substanzielles Klumpenrisiko dar.
Neben dem räumlich differenzierten Bild beleuchtete die Risikoanalyse auch die strukturellen Eigenschaften des städtischen Hochwasserrisikos (Abb. 04). Dabei zeigte sich, dass das Gesamtrisiko im Wesentlichen durch Schäden an Gebäuden inkl. Mobiliar zustande kommt und dass Objekte mit einem aussergewöhnlich hohen Einzelrisiko den Grossteil des Gesamtrisikos ausmachen: Bezogen auf die finanziellen Sachrisiken stellen rund 5 % der Objekte über 50 % des Gesamtrisikos dar. Im Gesamtkontext aller städtischen Hochwasserschutzmassnahmen gilt es auch die spezifisch städtischen Charakteristika (viele bodenebene Gebäudeöffnungen, Wertekonzentration in Untergeschossen und grosses Personenaufkommen) zu berücksichtigen und dem Risiko mit adäquaten Schutzmassnahmen zu begegnen.
Praktische Anwendungen der Ergebnisse
Für die Umsetzung der Gefahrenkarte in der Stadt Zürich wurde ein Masterplan «Naturgefahren Stadt Zürich» erarbeitet (vgl. Abb. 01), in dem alle notwendigen Informationen zusammengetragen und für die städtische Verwaltung zugänglich gemacht wurden.
Dies nicht nur für die Sihl, sondern auch für alle anderen Gewässer. Der Masterplan dient als Grundlage für die Planung des wasserbaulichen Hochwasserschutzes, Objektschutzmassnahmen (Abb. 05–06) sowie die Notfallplanung und die Gebäudebeurteilung im Bewilligungsverfahren.
Die Gebäudeversicherung kann dank der Risikoanalyse Objekte mit besonders hohen Sachwertrisiken identifizieren und die Eigentümer bestehender Gebäude bzw. Bauherren und Planer neuer Gebäude beraten. Dabei geht es um ein Abwägen zwischen der Investition in Objektschutzmassnahmen gegenüber der Bereitschaft, das Risiko selbst zu tragen. Bei den Sonderrisiko-Objekten können die Eigentümer mit der Beratung von Schutz & Rettung Zürich ihre Notfallplanung für ein Hochwasserereignis anpassen.TEC21, Fr., 2013.07.26
26. Juli 2013 Bernhard Kuhn, Dörte Aller, Jérôme Wider, Martin Detert