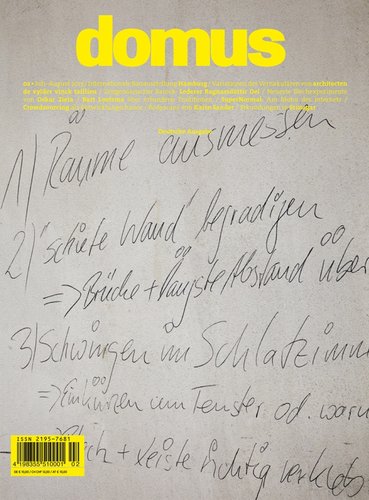Editorial
In Ballungsräumen verdichten sich urbane Utopien, Bauten aus diversen Epochen, Geschichte, Persönlichkeit und Lebenswirklichkeit einzelner Menschen zu Momenten besonderer Intensität. Wie das italienische Original setzt auch die deutsche Domus auf Inhalt und Substanz. Sie will wesentliche Themen aufgreifen. Die erste Ausgabe widmete sich dem Museum. Aus aktuellem Anlass – die Internationale Bauausstellung in Hamburg ist eröffnet – wendet sich dieses Heft nun der Stadt zu. Die Zukunft ist urban. Prognosen sehen die weltweite Stadtbevölkerung bis 2025 von heute rund 3,5 auf 4,5 Milliarden Menschen anwachsen. Das umfasst viele Alltagsrealitäten: Der mitteleuropäischen Stadt als dem humanen Maß aller urbanen Dinge mit ihren menschlichen Dimensionen, der relativen sozialen Sicherheit und Shared-Space-Konzepten stehen schrumpfende Städte in strukturell benachteiligten Regionen, vom Tourismus bedrängte Sehnsuchtsorte wie Venedig, der amerikanische Urban Sprawl, kommunistische Bandstädte, Metropolen wie New York, die Slums des Südens, Instant-Städte asiatischer Prägung und andere Modelle gegenüber.
Auf dem Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) 1933 wurden mit der Charta von Athen neue Kapitel des funktional entflochtenen Städtebaus aufgeschlagen. Heute sind diese Visionen der Moderne gescheitert, und der Glaube an die Planbarkeit von Stadt ist in seinen Grundfesten erschüttert. Städtebau aber ist eine Ur- und Kerndisziplin der Architektur. Der richtige Mix aus Planen, Bewahren, Eingreifen, neu Bauen, Kontrollieren und Zulassen von spontanen Prozessen ist essenziell. Eine große Qualität des Urbanen ist das Ephemere. Diese deutsche Domus feiert die vielen Möglichkeiten von Stadt. Das reicht vom urbanistischen Plan bis zur kleinen, feinen Intervention. Oliver Hamm klopft die IBA Hamburg auf ihre Zukunftsfähigkeit ab. Amber Sayah berichtet exklusiv, wie die Architekten Lederer Ragnarsdóttir Oei (LRO) das Bischöfliche Ordinariat zu einem integrativen Stück der Stadt Rottenburg ausbauten. In Wien wird ein Biedermeierhaus zum Schauplatz eines sozialen Experiments. Mit Adam Štĕch lässt sich eine organische Utopie von Jacques Gillet aus den 1960ern neu entdecken, die belgischen architecten de vylder vinck taillieu verzaubern mit sensiblen und originellen Transformationen alter Bausubstanz. Viel Freude mit den urbanen Facetten in diesem Heft!
Isabella Marboe
Zum Launch der ersten deutschen Domus im Mai haben wir auf Inhalte gesetzt, die mit dem Magazin verbunden sind. Unsere Coverthemen-Diskussionen in München in der Schaustelle und in der Kölner DesignPost haben Schlüsselthemen der Erstausgabe aufgegriffen und sie mit dem Publikum sowie mit Architekten, Designern und Kuratoren vertieft. Es war uns wichtig, Fragen nach der Zukunft von Museen noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen und der eigentümlichen Trennung zwischen Architektur und Design im deutschsprachigen Kulturraum auf den Grund zu gehen. Eine Debatte zu diesen Themen ist in unseren Augen wichtig, um Ziele für die Zukunft zu formulieren. Wir freuen uns, dass wir Sie begeistern konnten. Herzlichen Dank für Ihr überwältigendes Feedback zur ersten Ausgabe!
Einige unserer Diskussionspartner in München und Köln konnten Sie bereits in der ersten Ausgabe näher kennenlernen. Anderen begegnen Sie nun in unserer zweiten deutschen Domus: Oskar Zieta beispielsweise ist ein Grenzgänger zwischen Design und Architektur – und zwischen Polen und der Schweiz. Nora Schmidt hat ihn in seiner Werkstatt in Zielona Góra besucht und stellt seine Blechexperimente und die neueste Möbelkollektion 3 vor. Grenzen zu überwinden ist auch das Anliegen der beiden Designer Alvaro Catalán de Ocón und Francesco Faccin. Sie siedeln ihre Projekte jenseits der gängigen Konventionen des Copyrights an und konzentrieren sich dabei auf den Prozess, den die beiden Europäer in Nairobi und in Bogotà in Gang gesetzt haben. Ihr Ziel war es, für die beteiligten Menschen vor Ort eine konkrete Zukunftsaussicht zu schaffen. Für DUS Architects in Amsterdam hat die Zukunft bereits begonnen. Vielleicht mag ihr Vorhaben, mit einem 3-D-Drucker ein Haus zu errichten, heute noch verwegen klingen. Doch angesichts der rasanten Entwicklung der Technologie ist es sinnvoll, ihre Möglichkeiten zu erkunden. Die Berliner Künstlerin Karin Sander nutzt schon seit vielen Jahren 3-D Drucker für ihre Miniaturen. Im Interview mit Markus Zehentbauer berichtet sie über ihre Erfahrungen mit der Technologie. Viel Spaß beim Lesen der zweiten deutschen Domus – wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Sandra Hofmeister