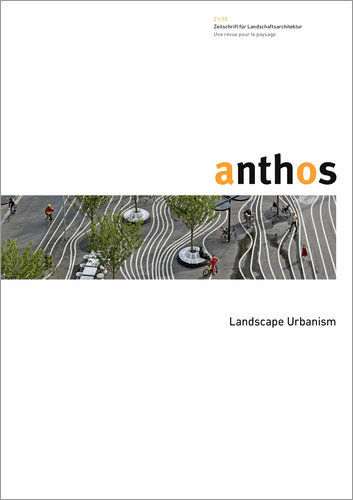Editorial
Ende der 1990er-Jahre, als der Urban Sprawl die Siedlungsentwicklung in den USA prägte, die Phase der Desurbanisierung voll in Gang war und Re-Urbanisierung nicht in Sicht, prägte der amerikanische Landschaftsarchitekt Charles Waldheim den Begriff des Landscape Urbanism. Er verband damit die Idee, Landschaft als Ausgangspunkt und ordnende Struktur für räumliche Entwicklungen zu begreifen; als «Grundbaustein des zeitgenössischen Städtebaus». In der Folge entspann sich vor allem in den USA eine lebendige Diskussion über die damit verbundene zentrale Position der Landschaftsarchitektur auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Siedlungsentwicklung.
Die Debatte prägt längst auch Europa und die Schweiz, ins Zentrum gerückt ist das Schlagwort der Nachhaltigkeit. Obgleich der Containerbegriff vielfach in der Erwartung überladen und in der Zielformulierung zu wenig präzise ist, bedeutet er im Kern jedoch unumstösslich: Ein Umdenken – auch jedes einzelnen – ist nötig; nachhaltige Siedlungsentwicklung muss als Gesamtraumentwicklung verstanden werden. Dabei geht es um die differenzierte Auseinandersetzung mit Systemen und Strukturen, Nutzungen und Funktionen – vor allem aber um Raumqualitäten.
Die zeitgemässe Übersetzung des Landscape Urbanism wäre entsprechend, die Siedlung künftig nicht nur aus der Landschaft heraus zu denken, sondern an und für sich als Landschaft zu entwickeln, als dynamischen Raum, integrativ per Definition. Dies hiesse auch: Stadtentwicklung als breit abgestützten Prozess zu verstehen. Pluralität zu suchen und Partizipation zu fördern.
Unplanbares zu ermöglichen und informelle Planungen wertzuschätzen. (Stoff)Kreisläufe zu unterstützen, transdisziplinär zu arbeiten, Vernetzung zu stärken und Überlagerungen zuzulassen. Über den eigenen Tellerrand zu schauen. Neue Wege zu gehen. Ökonomische, ökologische, politische, strategische, infrastrukturelle, stadtplanerische und umweltbezogene Aspekte stärker zu berücksichtigen. Und immer geht es dabei auch um Identität, den Ort und den Einbezug des kulturellen Erbes.
Ein so verstandener Landscape Urbanism wäre Instrument und Inhalt zugleich; ein disziplinen- und massstabsübergreifender Generationenauftrag. In dieser Ausgabe tragen wir exemplarische Realisierungen und Ansätze zusammen.
Viel Vergnügen!
Sabine Wolf
Inhalt
Antonio Da Cunha, Sonia Lavadinho�
Landschaft, öffentlicher Raum und urbane Qualität
Jessica Bridger�
Superkilen
Sabine Wolf�
Bishan-Ang Mo Kio
Alexandre Chemetoff�
Ile de Nantes oder die Stadt am Werke
Laure Aubert, Damien Butin�
Von Ufer zu Ufer
Klaus Overmeyer�
Stadtentwicklung selbst gemacht
Nicole Uhrig�
Grün als Wirtschaftsmotor?
André Schmid�
Neue Stadtparks – ausserhalb der Stadt
Lukas Schweingruber�
Glatt. Eine Identität abseits der Kernstadt?
Raimund Rodewald�
Zwischen Verdichtung und Lebensqualität
Ingo Golz, Matthias Wehrlin�
Räumliche Entwicklungsstrategien – Grundlage des freiraumbasierten Städtebaus
Stéphanie Perrochet�
Stadtentwicklung Zürich-Manegg
Superkilen
Noch selten wird in der Landschaftsarchitektur auf Schwarmintelligenz gesetzt, wenn es darum geht, ein neues, identitätsstiftendes Quartier zu gestalten. Der Mitte 2012 eröffnete Landschaftspark in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen wagt das Experiment breiter öffentlicher Beteiligung und könnte damit zum Vorbild werden.
Hedonismus ist nicht das erste Wort, das einem in den Sinn kommt, wenn man an Partizipation im öffentlichen Raum denkt. Dennoch ist die Idee, dass das Streben nach Vergnügung ein gutes und angemessenes Ziel für ein erfülltes menschliches Dasein ist, Kern des neuen Kopenhagener Parks. In Superkilen wird das Ziel mit Formen und Elementen ausgedrückt, die von jeglicher kultureller Norm abweichen. Stattdessen wird als multikulturelle Collage die Vielfalt der verschiedenen Möglichkeiten des Zeitvertreibs zelebriert – mit Rutschen, Hügeln oder lebhaften Farben. Hier bedeutet Stadtplanung Partizipation an der Seite anderer und die Anerkennung von Unterschiedlichkeit.
Die Struktur der Gestaltung ist einfach: Die lineare Anlage wurde in drei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, jeder mit einem klar definierten, eigenen Charakter und einem offenen Nutzungsprogramm, ermöglicht durch die Einbeziehung besonderer Objekte und einzigartiger landschaftlicher Elemente. Man könnte Superkilen als eine Kollektion klar definierter, einzelner Ideen beschreiben, die in diesem keilförmigen Park, im zentralen Viertel von Nørrebro in Kopenhagen, ihre Verwirklichung finden.
Zeichen, Erinnerungen und Andenken
Das Gewebe unserer Vergangenheit und unserer Herkunft besitzt eine gewaltige Macht. Die Gestalter von Superkilen, die Landschaftsarchitekten von Topotek1, die Architekten von BIG (Bjarke Ingels Group) und die Künstler von Superflex erschufen mit der Auswahl des Stadtmobiliars eine Hymne auf die Unterschiedlichkeit, indem sie die Anwohner in die Auswahl von Objekten aus deren kulturellem Hintergrund miteinbezogen. Ein Thai-Boxring, zum Beispiel, bringt diesen Sport in den Park, als aktive Veranschaulichung einer aussergewöhnlichen Art der Erholung. Das ist Crowdsourcing, und zwar nicht als akkumulierte Mittelmässigkeit, die oft das Resultat einer Gruppenanstrengung ist.
Hier wurde kein Gruppendenken umgesetzt, vielmehr sind Gruppendinge entstanden. Das grundlegende Konzept der Partizipation, mitsamt Versammlungen der Gemeinde und verschiedensten Bemühungen zur Öffentlichkeitsarbeit, erlaubte hier der Bevölkerung, Stadtmöbel und Objekte vorzuschlagen, die ihre Heimatländer oder ihre Herkunft repräsentieren. Die Gestalter fungierten als Kuratoren dieser Vorschläge, fügten eigene hinzu und liessen die meisten der Objekte in Dänemark herstellen, als eine Art der Übersetzung. Die Objekte repräsentieren die Freude am kulturellen Gedächtnis, an Dingen, die verloren waren und wiedergefunden wurden. Der Park ist ein Lobgesang und eine Anerkennung des Unterschieds.
Die Auswahl der Stadtmöbel ist, als Manifestation von Kultur, so mannigfaltig wie die Einwohner. Der Kontrast von verschiedensten Persönlichkeiten und Identitäten, hier zusammengemischt, bringt etwas komplett Neues nach Nørrebro. Das Projekt ist aber auch ein allgemeiner Beitrag zur Idee von Kulturvermittlung und Partizipation.
Schon die Wettbewerbsausschreibung für die Parkgestaltung war sich der Herausforderungen des Standorts bewusst: eine Nachbarschaft am Rande der Gesellschaft, wirtschaftlich entrechtet, mit Armutsproblemen und einer für Kopenhagen sehr hohen Kriminalitätsrate belastet. Ein Park kann komplexe soziale Probleme nicht lösen, aber er kann eine Gegend aufwerten. Er kann Dinge, die bis dahin unbemerkt geblieben sind, sichtbar machen und einfache Freuden dorthin bringen, wo einst nur ein Streifen Niemandsland war.
Superkilen ist mittlerweile ein Schauspiel in der Tradition der englischen Landschaftsgärten des 19. Jahrhunderts, wo «Follies» und eine sorgfältige Choreografie eine Naturversion mit Dramatik inszenierten. In diesem Fall dramatisiert Superkilen das Stadtbild.
Auch das Aussehen der Landschaft selbst ist faszinierend: Sie ist so präsent und verführerisch wie die Aussenhaut des neuesten Architekturwunders, aber sie ist voll funktionsfähig und einladend.
Ihre gewundenen Ebenen, die in drei Teile mit drei beherrschenden Farben – Rot, Schwarz und Grün – aufgeteilt sind, beinhalten keine Vorgaben, was man dort tun oder wie man sich verhalten soll. Stattdessen sind die Räume jeder Interpretation zugänglich, offen für die Erfindung neuer Spiele, offen auch dafür, sie auf neue Art und Weise zu benutzen. Landschaft ist sowohl Reflektion als auch Hintergrund von Kultur, und in Superkilen wurde diese als überbordende Fülle von Zeichen und Symbolen in einem einzigen – und einzigartigen – Raum zusammengefügt.
Die Teilnahme am öffentlichen Leben
Wir hinterfragen nicht oft die elementare Zusammensetzung der Orte, in denen wir uns befinden, wir akzeptieren öffentliche Räume einfach als gegeben. Selten sind sie eine so buchstäblich ablesbare Übersetzung von anderen Orten. Superkilens Reiz liegt in der spielerischen Fähigkeit, überall her stammen zu können, und doch nur in diesem spezifischen Kontext möglich zu sein – als Ergebnis der aktiven Teilnahme der Benutzer an seiner Gestaltung; global und doch ortsgebunden.
Eine Version des Parks könnte überall geschaffen werden, entwickelt aus denselben Methoden und Regeln, und doch wäre jede Version, durch die jeweilige Mitwirkung, von Natur aus verschieden. Die Landschaftsarchitektur von Superkilen passt in ihre urbane Umgebung und wurde gebaut, um deren Urbanität zu unterstreichen.
Nørrebros schwierige Lage – eine demographische Insel heterogener Minderheiten in einem homogenen Land – schuf eine neue Denkweise darüber, wie der öffentliche Raum zu einem partizipativen Element der Stadtkultur werden kann. Superkilen ist ein Prototyp für eine neue Art der Einbindung von Nutzern im öffentlichen Raum, für kulturelles Teilen und für die Ästhetik von Parks im 21. Jahrhundert.anthos, Mo., 2013.06.03
03. Juni 2013 Jessica Bridger