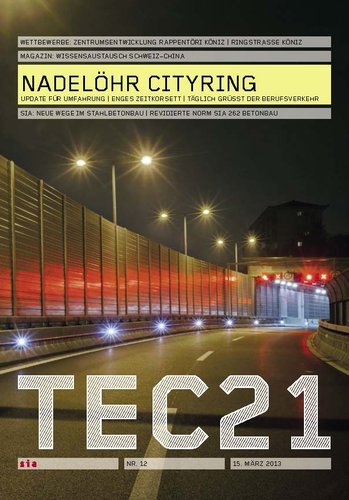Editorial
Als in den 1950er-Jahren der Autobahnbau begann, galt der Eidgenössischen Planungskommission für den Nationalstrassenbau eine Strecke bereits ab 5000 Fahrzeugen pro Tag für autobahnwürdig.[1] Der grösste Teil der Autobahnen wurde zwischen 1965 und 1975 gebaut. Inzwischen ist das Schweizer Nationalstrassennetz 1790 km lang, 60 km davon verlaufen durch den Kanton Luzern. Den Abschnitt zwischen Emmen und Kriens befahren täglich über 90 000 Fahrzeuge. Nach fast 40 Jahren waren die Verwitterung und die Schäden durch den Verkehr beträchtlich.
Ein Ende der Verkehrszunahme ist nicht abzusehen: Das Astra rechnet für die Region Luzern bis 2030 mit rund 20 % mehr Belastung. Demzufolge nutzen sich auch die Beläge stärker ab, besonders durch den Schwerverkehr. In den letzten Jahren wurden bereits viele Autobahnabschnitte erneuert, weitere stehen noch an. Der Aufwand steigt auch durch die heutigen Umweltvorschriften, die Störfallverordnung und andere Sicherheitsmassnahmen. Einer solchen Gesamterneuerung wurde der Cityring Luzern unterzogen: Das Entwässerungssystem wurde angepasst, Fahrbahnbeläge erneuert, Brücken verstärkt und instandgesetzt, Lärmschutzbauten ersetzt und die Betriebs- und Sicherheitsanlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Aber nicht nur in technischer Hinsicht steht die Umfahrung von Luzern exemplarisch für viele Erhaltungs- oder Erneuerungsprojekte, sondern vor allem aufgrund ihrer Lage mitten in der Stadt Luzern. Nachdem das Stimmvolk die Revision des Raumplanungsgesetzes angenommen und sich für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden ausgesprochen hat, dürften Projekte zur baulichen Verdichtung zunehmen. Im Strassenbau werden enge Platzverhältnisse und der laufende Verkehr die zuständigen Planer und Planerinnen künftig immer stärker beschäftigen.
In Luzern entschieden sich die Verantwortlichen vor allem aus verkehrstechnischen Gründen gegen eine Totalsperrung. Stattdessen wurde nachts und an ausgewählten Wochenenden gearbeitet. So wollte man verhindern, dass der Verkehr tagsüber stark eingeschränkt wird. Es war ein ambitioniertes Ziel, den Anforderungen gerecht zu werden und dennoch die Arbeiten in diesem engen Zeitkorsett auszuführen. Nun darf erst mal durchgeatmet werden: Nach der Eröffnung im Juni 2013 rechnet das Bundesamt für Strassen mit einer interventionsfreien Zeit von 20 Jahren, Verkehrsbehinderungen sollen während der kommenden 10 Jahre vermieden werden.
Daniela Dietsche
Anmerkung:
[01] Diese Aussage basiert auf den Dokumenten der Eidgenössische Planungskommission für den Nationalstrassenbau zu den «Konzepten» für das Autobahnnetz (Quelle: Staatsarchiv Luzern). Aus: Cityring Luzern INFO 4.
Inhalt
05 WETTBEWERBE
Zentrumsentwicklung Rappentöri Köniz | Ringstrasse Köniz
12 MAGAZIN
Wissensaustausch Schweiz–China
16 UPDATE FÜR UMFAHRUNG
Thomas Kloth, Stefan Matsch
Nach mehr als 30 Jahren Betrieb der A2 in und um Luzern wurden das Lehnenviadukt, der Reussporttunnel, die Sentibrücken mit Stadtanschluss und der Sonnenbergtunnel von 2009 bis 2013 erneuert.
20 ENGES ZEITKORSETT
Franz Koch, Matthias Neidhart
Die Baustellen am Cityring wurden jeden Abend neu eingerichtet, am frühen Morgen geräumt und für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten und Materialtransporte erfolgen unter knappen Zeit- und Platzverhältnissen.
23 UND TÄGLICH GRÜSST DER BERUFSVERKEHR
René Schnüriger
Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Bauarbeiter sowie die Verfügbarkeit der Autobahn hatten bei der Erneuerung Priorität. Aus diesem Grund wurden die nächtlichen Baustellen mit einem Monitoringsystem überwacht.
27 SIA
Neue Wege im Stahlbetonbau | Revidierte Norm SIA 262 Betonbau | Kurzmeldungen
31 WEITERBILDUNG
37 IMPRESSUM
38 VERANSTALTUNGEN
Update für Umfahrung
Nach gut vier Jahren Bauzeit wird die Autobahn A2 bei Luzern im Juni 2013 wieder baustellenfrei sein. Eine Totalsperrung für das Projekt Cityring Luzern kam nicht infrage, die Gesamterneuerung erfolgte unter Verkehr. Dank umfangreichen verkehrlichen und baulichen Massnahmen sowie intensiver Kommunikationsarbeit blieb ein Verkehrskollaps aus.
Mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von über 90 000 Fahrzeugen gehört die A2 bei Luzern zu den am meisten befahrenen Strassenabschnitten der Schweiz. Verschiedene Kunstbauten prägen den Autobahnabschnitt: das Lehnenviadukt entlang der Reuss im Norden, der rund 600 m lange Reussporttunnel, die Sentibrücken über die Reuss mit dem Stadtanschluss und der 1.5 km lange Sonnenbergtunnel im Süden. Die Witterung und stetig zunehmender Verkehr hatten nach knapp 40 Jahren Betrieb unübersehbare Spuren hinterlassen. Mit dem Projekt Cityring Luzern wurden die verschiedenen Bauwerke des Abschnitts Emmen–Luzern–Kriens zwischen 2009 und 2013 auf den Stand der Technik gebracht und an die heutigen Sicherheitsanforderungen angepasst. Der erneuerte Autobahnabschnitt soll entsprechend den Astra-Richtlinien[1] den Beanspruchungen der nächsten 20 Jahre standhalten und die Anforderungen an eine leistungsfähige Strasse bezüglich Verkehrssicherheit, Umweltverträglichkeit und Komfort erfüllen.
3.5 km Tunnel und Brücken
Das Kernstück der Gesamterneuerung war die Instandsetzung des Reussport- und des Sonnenbergtunnels. Neben den baulichen Arbeiten wie der teilweisen Erneuerung der Betonkonstruktion der Innenschale, dem Einbau von SOS-Nischen und dem Neubau der Entwässerung wurden die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) vollständig ausgetauscht. Das bisherige Be- und Entlüftungssystem wurde durch ein reines Abluftsystem ersetzt, das im Brandfall ein gezieltes Absaugen der Rauchgase über steuerbare Lüftungsklappen erlaubt. Rauchtrennwände an den Tunnelportalen verhindern, dass die Rauchgase in die vom Brand nicht betroffene Tunnelröhre zurückströmen. Das Nordportal des Reussporttunnels wurde aus Lärmschutzgründen mit Hilfe von Elementträgern um 130 m verlängert.
Die Sentibrücken zeigten typische Alterserscheinungen: Tausalz hatte die Brückenkästen angegriffen, undichte Fahrbahnübergänge führten zu Betonabplatzungen und Korrosion an den Widerlagern, sodass die gesamte Betonkonstruktion überholt und die Fahrbahnübergänge ersetzt werden mussten.
Aufgrund der kontinuierlichen Mehrbelastung war es beim 360 m langen Lehnenviadukt entlang der Reuss notwendig, die Tragfähigkeit mittels zusätzlicher Längsträger zu erhöhen. Die Betonquerträger wurden seitlich verbreitert und mit einer Vorspannung in der seitlichen Verbreiterung ausgerüstet. Auch neue Metallleitschranken, Entwässerungsleitungen und Kabelrohrblöcke galt es zu erstellen. Zudem wurden reussseitig (d. h. talseitig gegen die Siedlung) Lärmschutzwände aus Glas montiert. Ein neu erstellter zusätzlicher Fahrstreifen (vgl. S. 20, «Enges Zeitkorsett») ermöglichte es, den Verkehr auf dem Lehnenviadukt während der ganzen Bauzeit zweimal dreispurig zu führen. Dieser separat geführte Zusatzstreifen dient künftig als Rad- und Gehweg entlang dem Lehnenviadukt.
Verkehrskollaps Blieb aus
Der Abschnitt durch die Stadt Luzern ist eine Schlüsselstelle des schweizerischen Autobahnnetzes und ein zentraler Teil der Verkehrsinfrastruktur in der Agglomeration mit rund 200 000 Einwohnern. Die Sperrung jeweils einer Tunnelröhre für eine Tagbaustelle während eines Jahres hätte zu täglichen Verkehrszusammenbrüchen, kilometerlangen Staus in den Spitzenstunden und entsprechend grossen ökonomischen Schäden besonders für die Innenstadt Luzerns geführt. Damit der Verkehr tagsüber unbehindert rollen konnte, wurde ab Ende 2010 bis Mitte 2013 nachts von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens sowie an knapp 50 Wochenenden gearbeitet. Um grössere Verkehrsprobleme zu vermeiden, wurden die Sperrungen auf verkehrsarme Zeiten gelegt – nicht an Feiertagen und ausserhalb der Sommerferienreisezeit. Nachts und während der Wochenendarbeiten blieb jeweils eine Röhre des Sonnenbergtunnels gesperrt. Nachts wurde der Verkehr in der einen Richtung durch die Stadt Luzern geführt, an den Wochenenden wurde die offene Röhre im Gegenverkehr betrieben. Dank umfangreichen Verkehrs- und Kommunikationsmassnahmen, die das Bundesamt für Strassen (Astra) mit Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Politik und Verwaltung erarbeitet und umgesetzt hat, blieb ein Verkehrskollaps aus. Neben Angeboten zur grossräumigen Umfahrung bestand die Hauptmassnahme im Verkehrsbereich darin, die Autos mit Dosierstellen an den Ausfahrten auf der Autobahn zu behalten und dadurch einen Verkehrszusammenbruch auf dem Lokalnetz zu vermeiden. In einer breit angelegten Informationskampagne wurde die Bevölkerung im Vorfeld und während der Arbeiten auf die möglicherweise angespannte Verkehrssituation aufmerksam gemacht und um ein umsichtiges Verkehrsverhalten gebeten. Partner aus der Wirtschaft – Detailhandel, Eventveranstalter usw. – wurden individuell betreut. Die Kommunikationsmassnahmen trugen dazu bei, die Verkehrsmenge zu vermindern. Zeitweilige längere Rückstaus auf der Autobahn an den Wochenenden oder als Folge von Unfällen waren dennoch nicht zu vermeiden.
Auch bauliche Massnahmen trugen dazu bei, dass die Baustelle Cityring Luzern durchgehend unter Verkehr betrieben werden konnte. Zum Beispiel ermöglichten zwei vorgängig erstellte Werkleitungsstollen unter dem Reussport- beziehungsweise über dem Sonnenbergtunnel die redundante Verkabelung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (Abb. 3, S. 25). Sie sind die Voraussetzung dafür, dass die definitiven Installationen des Projekts ohne wesentliche Unterbrüche in Betrieb genommen werden können. Die Kosten für die Massnahmen, um den Verkehr während der gesamten Bauzeit aufrechtzuerhalten, sind beträchtlich. Sie belaufen sich auf rund 100 Mio. Franken oder auf rund ein Viertel der Gesamtkosten.
Im Zeichen des Neuen Finanzausgleichs
Das Projekt Cityring Luzern fiel in die Zeit, in der die Verantwortung für die Autobahnen aufgrund der Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) auf den Bund überging. Hatte noch der Kanton Luzern das Erneuerungsprojekt ausgearbeitet und die Werkleitungsstollen erstellt, so war die Astra-Filiale Zofingen für die Hauptarbeiten zuständig. Das Projekt war eines der ersten baureifen Grossprojekte, das das Astra als Bauherrschaft zu bewältigen hatte. Die Verantwortlichen begannen mit dem Bau in Fahrtrichtung Norden und sammelten Erfahrungen, die sie bereits für die Gegenrichtung nutzen konnten. Dadurch konnten die Arbeiten – auch zur Entlastung der Bevölkerung – um zwei Monate schneller abgeschlossen werden. Bis zum definitiven Abschluss der Bauarbeiten Mitte 2013 finden noch diverse betriebstechnische Tests statt.
Anmerkung:
[01] www.astra.admin.ch > Fachdokumente für Nationalstrassen > Standards, ForschungTEC21, Fr., 2013.03.15
15. März 2013 Thomas Kloth, Stefan Matsch
Enges Zeitkorsett
Der Verkehr soll im Baustellenbereich während der ganzen Bauzeit rollen: Dies war eine der wichtigsten Prämissen für das Projekt Cityring Luzern. Die damit verbundene zeitliche Beschränkung der Bauarbeiten auf eng definierte Zeitfenster – während der Nacht und an ausgewählten Wochenenden – bestimmte Planung und Ausführung.
Um in beiden Fahrtrichtungen auch während der Bauarbeiten drei Fahrstreifen anbieten zu können, galt es auf dem Lehnenviadukt über der Reuss einen Zusatzstreifen zu schaffen. Als Vorleistung dazu musste die angrenzende Stützmauer abgebrochen und zurückversetzt werden (Abb. 6, S. 19). Anschliessend konnten die Arbeiten Fahrbahn für Fahrbahn vom Hang zur Reuss hin verlagert werden. Damit verbunden war eine phasenweise angepasste Verkehrsführung. Im Reussporttunnel blieb auch während der Bauarbeiten stets einer der drei Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet, während auf den beiden anderen Fahrstreifen nachts und an den Sperrwochenenden gearbeitet wurde. Der vorbeirollende Verkehr sorgte für einen hohen Lärmpegel und eine entsprechende Belastung der Arbeiter. Besonders die Baustellenzu- und -wegfahrten direkt in den Autobahnverkehr forderten von allen Beteiligten höchste Aufmerksamkeit.
Schnell bauen dank geeigneten Geräten und Produkten
Nachts konnten die Arbeiten jeweils erst rund 45 Minuten nach der Sperrung, gegen 20.45 Uhr, aufgenommen werden und mussten bis rund eineinhalb Stunden vor der Verkehrsfreigabe, also bis um 4.30 Uhr, wieder beendet sein (vgl. S. 23, «Und täglich grüsst der Berufsverkehr»). Eine detaillierte Planung stellte sicher, dass die vorgesehenen Tätigkeiten bis zum Morgen abgeschlossen waren oder zumindest eine provisorische Lösung bestand, die ausreichend sicher der Belastung durch den Verkehr tagsüber standhielt. Die gesamte bauliche Erneuerung der beiden Tunnel erfolgte deshalb Schritt für Schritt in definierten Einzelabschnitten. Die seitlichen Arbeitsstellen wurden tagsüber mit Holzabdeckungen – provisorische Bankette, um den Fluchtweg zu gewährleisten – abgedeckt und mit Stahlleitelementen (Mini-Guards) abgetrennt. Für Arbeiten, die die Fahrbahn tangierten, etwa für den Neubau der Entwässerungsleitungen, reichte eine Nacht nicht aus. Sie fanden deshalb während der Sperrwochenenden zwischen Freitagabend und Montagmorgen statt, sodass es beispielsweise möglich war, einen provisorischen Belag einzubauen.
Der Einsatz geeigneter Maschinen trug dazu bei, den Arbeitsfortschritt zu beschleunigen. So ermöglichte eine Grabenfräse, den Aushub der Gräben für die neuen Entwässerungsleitungen zügiger voranzubringen, als dies durch Abspitzen möglich gewesen wäre.
Sie erzeugte wesentlich weniger Lärm als herkömmliches Abbruchgerät und konnte daher während der ganzen Nacht eingesetzt werden. Für bestimmte Aufgaben war aber sogar ein Sperrwochenende fast zu kurz. Dazu gehörte der Ersatz einer Rasterdecke im Sonnenbergtunnel durch eine konventionelle Tunneldecke. Die Rasterdecke gehörte noch zu den Installationen im Zusammenhang mit der Zivilschutzgrossanlage, als die der Sonnenbergtunnel hätte dienen sollen und die nun aufgegeben wurde (vgl. Kasten S. 22). Der Unterdruck des neuen Abluftsystems hätte die Decke stark beansprucht, weshalb eine stabilere Lösung eingebaut wurde. Obwohl ein schnell aushärtendender Polymerbeton verwendet wurde, reichte die vorgesehene Zeit nur knapp, um die Decke auf rund 22 m einzuschalen, zu betonieren und wieder auszuschalen. Bei tiefen Temperaturen wurden die Tunnelwände hinter einer mobilen Einhausung rund um die Uhr beheizt.
Ein spezieller, sehr widerstandsfähiger Polymerbeton, der schnell aushärtet, wenig schwindet und einfach eingebaut werden kann, kam auch beim Ersatz der Fahrbahnübergänge der Brücken zur Anwendung: Er ermöglichte den Ersatz der Fugen innerhalb der geplanten Wochenenden – eine Arbeit, die sonst bis zu drei Wochen in Anspruch nimmt.
Kampf dem Lärm
Über den Tunneln liegen Wohngebiete, weshalb die Projektleitung der Verringerung des Baulärms höchste Aufmerksamkeit schenkte. Besonders Abbrucharbeiten verursachten Körperschall. Aus Rücksicht auf die Anwohnenden konnten lärmintensive Bauarbeiten nur bis Mitternacht ausgeführt werden. Vor allem im Portalbereich der Tunnel und auf den Sentibrücken, von wo sich der Lärm auf die seitlichen Hanglagen ausbreitet, stand zudem der Luftschall im Fokus. Dank provisorischen Einhausungen liess sich der Schallpegel von Arbeiten mit Höchstdruckwasserstrahlen um bis zu 10 dB vermindern. Auch die bereits erwähnte Grabenfräse half die Lärmbelastung zu reduzieren. In den am meisten betroffenen Quartieren zeichneten Lärmmessgeräte den Luftschall rund um die Uhr auf. Ein monatlicher Bonus von 5000 Franken schuf für die Unternehmen den Anreiz, die Lärmwerte einzuhalten und bei Überschreitungen zu reagieren.
Die Projektleitung orientierte die Anwohnenden über anstehende Arbeiten und die mögliche Lärmbelastung. Für Einzelne waren hohe Lärmbelastungen jedoch nicht zu vermeiden, und so sah sich die Projektleitung auch mit Reklamationen konfrontiert.
Rhythmuswechsel
An das Personal stellte das Projekt ausserordentliche Ansprüche. Dazu beigetragen haben unter anderem die kurzen Nettoarbeitszeiten nachts, beengte Platzverhältnisse, Arbeiten unter Verkehr sowie winterliche Temperaturen. Als speziell belastend erwiesen sich die rund 50 unregelmässig verteilten Sperrwochenenden. Sie brachten einen Rhythmuswechsel von der Nachtschichtarbeit zu einem Dreischichtbetrieb mit sich, mit entsprechenden Wechseln vor bzw. nach den Wochenenden. Jede Nacht standen bis zu 100 Bauleute im Einsatz, parallel zur Tagesschicht auf den offenen Strecken. An Sperrwochenenden arbeiteten teilweise gar bis zu 250 Personen in sechs Schichten. Der grosse Personalbedarf, die unregelmässigen und ungewöhnlichen Arbeitszeiten sowie die Schichtplanung stellten die Unternehmen und Bauleitungen vor grosse Herausforderungen. Gleichzeitig verunmöglichten es die engen Platzverhältnisse den Unternehmen, das Personal zur Beschleunigung weiter aufzustocken.
Dank technischen Hilfsmitteln, dem Einsatz geeigneter Produkte und einem hohen Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein ist es gelungen, das Projekt weitgehend unfallfrei zum Abschluss zu bringen. So liefert der Cityring Luzern wertvolle Erfahrungen für das Bauen mitten in der Stadt. Gleichzeitig wurden aber die Grenzen eines derartigen Vorhabens vor allem auf Seiten des Personaleinsatzes deutlich. Für künftige Projekte sind andere Modelle zu prüfen, die den Belastungen des Personals insbesondere in Bezug auf den Rhythmuswechsel besser Rechnung tragen, indem beispielsweise nur ein Schichtarbeitsmodell zum Einsatz kommt, etwa ein Zweischichtmodell bei grösseren Baumassnahmen. Dies bedingt jedoch eine durchgehende Sperrung der Strasse. Bei kleineren Massnahmen kann auch eine durchgehende einfache Nachtschicht ausreichen.TEC21, Fr., 2013.03.15
15. März 2013 Matthias Neidhart, Franz Koch