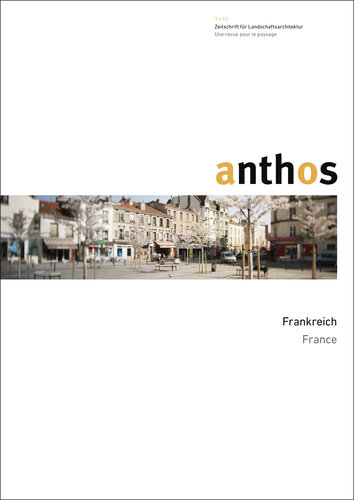Editorial
In Frankreich treffen zahlreiche der grossen geographischen Einheiten Europas zusammen. Tiefebenen und Berge, vier Meeresufer, ein vom ozeanischen zum mediterranen reichendes Klima. Die politische Verwaltung Frankreichs ist heute noch stark zentralisiert, lässt die Regionen jedoch zunehmend Platz einnehmen.
Das Land hat eine bedeutende Landschaftsarchitektur-Tradition – der französische Garten – welche seit der Mitte des 20. Jahrhunderts in eine kraftvolle Erneuerungsphase trat. Hier seien Corajoud, Clément, Lassus und Chemetoff genannt, deren Projekte und Theorien auf jene von Denkern wie Roger, Berque oder Le Dantec treffen, die heute noch das Wirken der zeitgenössischen Landschaftsarchitekten beeinflussen.
Das aus den 1960er- und 1970er-Jahren stammende gestalterische Erbe tritt in dieser Ausgabe als gemeinsame Grundlage mehrerer Projekte hervor. Nach etwa 50 Jahren Bestand gehen heute viele der grossen Siedlungen oder sogar ganze Städte ihre Transformation an: Rehabilitation, Umgestaltung oder Neuanbindung. Der Garten über der Pariser Ringautobahn oder der Garten-Platz am Eingang der Stadt Ivry-sur-Seine zeigen, wie der urbane Raum zugunsten von Fussgängern und besseren Sozialkontakten umgebaut wird. Parks entstehen, um den neuen Bedürfnissen nach Spielmöglichkeiten und Treffpunkten in den Stadtvierteln der 1960 Jahre zu entsprechen, oder um die weiterwachsende Stadt zu vernetzen. Die «Villes nouvelles» (Neuen Städte), aus dem Nichts erschaffene Einheiten dieser Epoche, beeinflussen heute noch die Rolle, die der Landschaft im Städtebau zukommt. Die Ausgabe beschäftigt sich auch mit dem Bereich der Planung: Die in der Schweiz vorgenommene Trennung der Planungs- und Baukompetenzen in der Landschaftsarchitektur ist in Frankreich wenig verbreitet. So werden die Landschaftsatlanten, Mittel zur Bestandsaufnahme, zum Schutz und zur Aufwertung der Landschaften auch zu Instrumenten des Entwurfs. Eng mit der Entwicklung der abendländischen Stadt im 19. Jahrhundert verbunden ist die Geburt der grossen öffentlichen und städtischen Stadtparks; ein Beitrag der Ausgabe untersucht die Entwicklung des 1867 eingeweihten Pariser Parks Buttes-Chaumont.
Unsere Autoren stellen die Frage nach dem Einfluss der französischen Landschaftsarchitekten auf die Gestaltung der Städte und leiten damit das Thema des kommenden anthos-Ausgabe «Landscape urbanism» ein.
Vor vierhundert Jahren wurde Le Nôtre geboren, Fackelträger des französischen Gartens. anthos zeigt eine Momentaufnahme der Profession, wie sie heute von unseren Nachbarn ausgeübt wird. Die Ausgabe ist zugleich eine Einladung, die französische Landschaftsarchitektur auch in situ neu oder wieder zu entdecken.
Emmanuelle Bonnemaison, Cécile Albana Presset